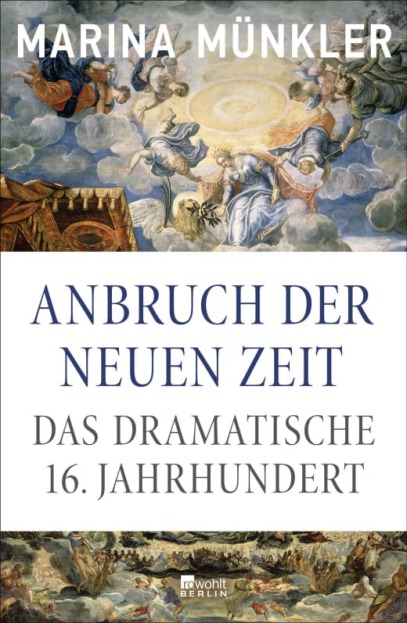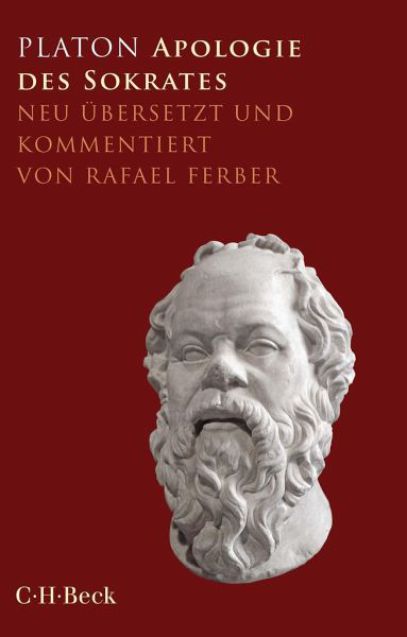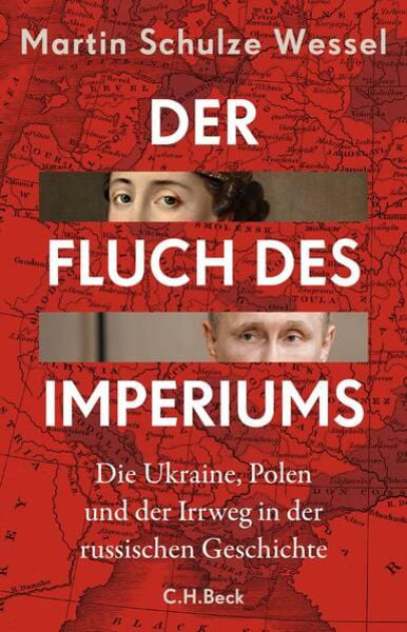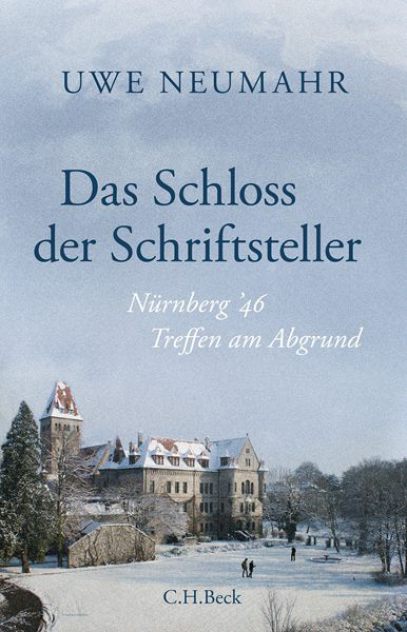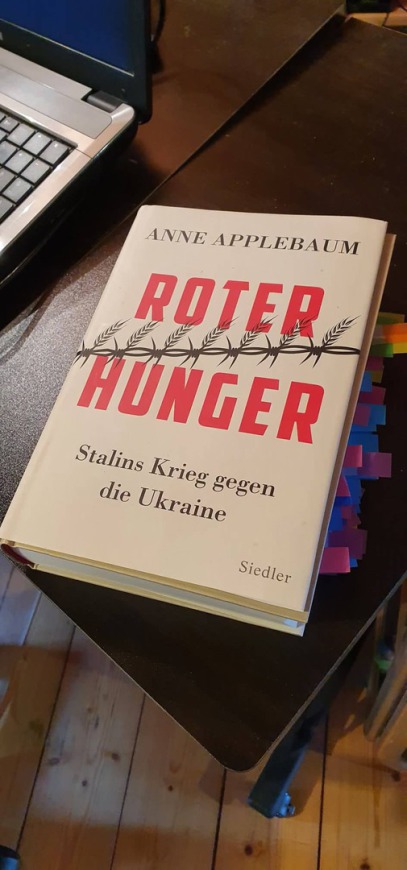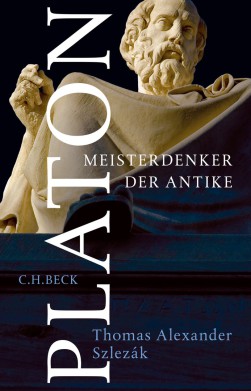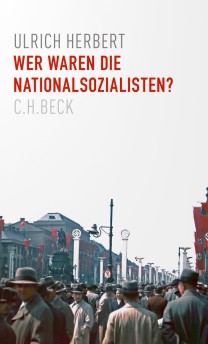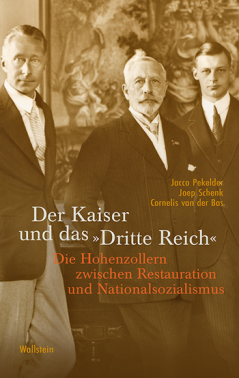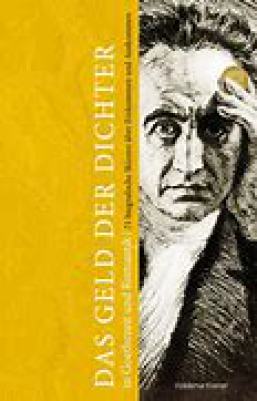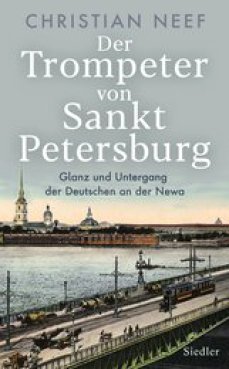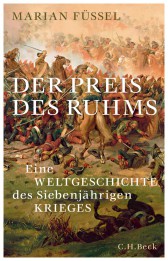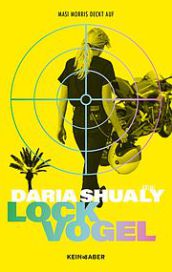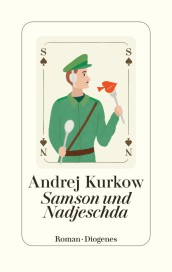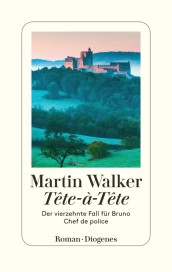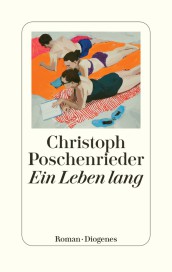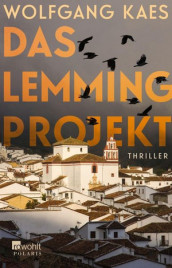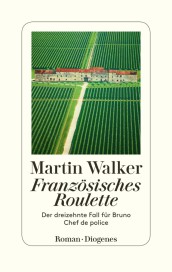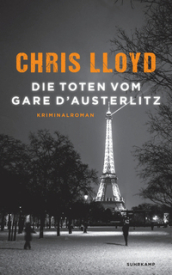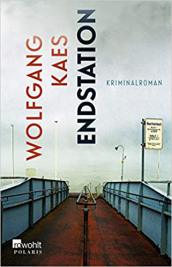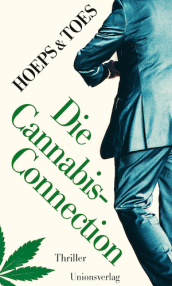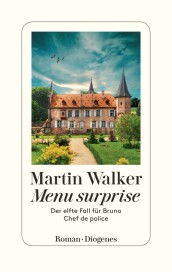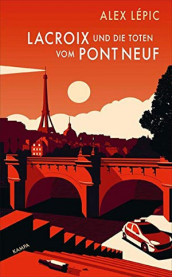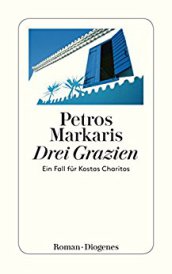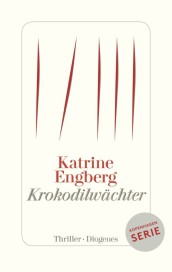Bücher über Geschichte
Back to the roots: ab ins 16.Jahrhundert
Globalgeschichte hat Konjunktur. Sie nimmt die ganze Welt in den Blick. Im „Anbruch der neuen Zeit“ der Dresdner Kulturprofessorin Marina Münkler ruht der Blick der Autorin auf Europa und das, was es im „dramatischen 16. Jahrhundert“ angestellt hat. Das ist nicht wenig und nimmt Teil an der größeren Weitwinkelaufnahme.
„Drei große Konfliktlinien prägen das Jahrhundert: das Vordringen der Spanier und Portugiesen auf den amerikanischen Kontinent und in den indischen Ozean, die Expansion des Osmanischen Reichs und der Zerfall der Christenheit in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Lager im Zuge der Reformation“, gibt Münkler ihr Programm vor.
Sie erfüllt es mit Detailkenntnis, sie stellt Zusammenhänge dar und beweist Urteilskraft. Im ersten Komplex behandelt sie das Eindringen der europäischen Seemächte Spanien und Portugal vor allem in Amerika. Hier kommt es ihr darauf an, zu zeigen, in welchem Maße die Europäer ignorant gegenüber den Indigenen waren, die sie dort antrafen. Nichts von den großartigen Kulturen, nichts von ihrer auch politischen Zivilisation nahmen sie wahr. Besser: Sie wollten es nicht wahrnehmen, um die lange vor ihnen dorthin gekommenen Menschen zu unterdrücken, auszurauben, zu ermorden und als „Wilde“ zu diffamieren. Interessant sind ihre Ausführungen zur ersten Herausbildung des Völkerrechts und eine intensive Auseinandersetzung mit den „modern“ anmutenden Ansichten des Dominikaners Bartolomé de Las Casas, der jahrelang einen mutigen Kampf zum Schutz der „Indios“ gegen die spanische Krone focht.
Auch die zweite große Konfliktlinie stellt die Europäer nicht in ein günstiges Licht. Die Ausdehnung des Osmanischen Reiches nicht nur in Nordafrika und Vorderasien, sondern auch auf dem europäischen
Kontinent, war nur möglich aufgrund der moderneren Ausstattung des zur Großmacht herangewachsenen, muslimisch orientierten Reiches. Münkler beschreibt die politische und administrative Modernität der
Macht, die in Europa bald mit der „Türkengefahr“ verunglimpft wurde. Lange bevor in Europa die feudalen Strukturen die Entwicklung noch behinderten, hatten die Sultane ihren Staatsapparat komplex und
effizient organisiert. An seiner „Spitze stand der Sultan. Er war ein absoluter Herrscher, dessen Machtfülle die der europäischen Könige wie auch des Kaisers bei weitem übertraf.“ Die militärische
Überlegenheit des osmanischen Reiches hatte strategische, taktische und materielle Gründe. Während die europäischen Heere noch von kämpfenden Rittern angeführt wurden, waren die Janitscharen bestens
ausgebildete Fußtruppen, die auch in Unterzahl erfolgreich sein konnten. Die osmanische Überlegenheit war auch technisch begründet: Ihre Artillerie hat manche Schlacht entschieden. Allein auf See
waren die türkischen Streitkräfte den westlichen Seemächten nicht gewachsen. So verloren sie in der Seeschlacht von Lepanto (1571) fast ihre gesamte Flotte. Die Autorin relativiert diesen im Westen
propagandistisch übertreiben ausgeschlachteten Erfolg. Er konnte das westliche Mittelmeer nicht restlos und das östliche überhaupt nicht befrieden.
Das dritte große Thema des Buches ist eng mit dem Namen Martin Luthers verbunden. Münkler behandelt den Missstand der römischen Kirche, der das Fass zum Überlaufen brachte, mit der notwendigen
Deutlichkeit, weil anderenfalls die heftige Reaktion Luthers nicht verständlich wäre. Der Ablasshandel, der darauf hinauslief, dass Gläubige durch eine Geldzahlung von ihren Sünden befreit wurden,
sie später oder auch noch nach ihrem Tode vom Fegefeuer verschont blieben und dass damit nicht nur die christlichen Türkenkriege, sondern auch der überaus üppige Apparat Roms finanziert wurde. Luther
legte in ungewöhnlich polemischer Firm den Finger auf diese Wunde und erreichte mit seinen in der neuen Technik gedruckten Flugschriften in deutscher Sprache ein weites Publikum. Die Autorin
beschränkt sich nicht etwa auf die 95 Thesen von Wittenberg, sondern sie ruft die gesamte Polemik Luthers und seiner Widersacher auf. Dabei kommt auch die Türkengefahr zur Sprache, die zu bannen, ja
ein Teil der Ablasseinnahmen nutzen sollte. War Luther also ein Verräter an dem Widerstand gegen das Osmanische Reich? Schließlich wendeten die Bauern und Teile der städtischen Mittelschichten und
des niederen Adels den reformatorischen Ansatz Luthers zu dessen Missfallen in eine soziale Revolte, die sie gegen die Heere der Landesherren nicht gewinnen konnten: „In den Berichten stehen Tausende
erschlagener Bauern allenfalls ein paar Dutzend Toten auf Seiten des landesherrschaftlichen Militärs gegenüber. Der Bauernkrieg in Deutschland war ein Massakerkrieg, und darin war er der spanischen
Kriegführung bei der Eroberung der Neuen Welt nicht unähnlich.“
Marina Münkler ist Professorin für Mittelalterliche und Frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden. Sie ist Autorin kulturgeschichtlicher und politischer Bücher, darunter «Lexikon der Renaissance» (2000) und «Marco Polo» (2015). Gemeinsam mit Herfried Münkler veröffentlichte sie 2016 «Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft», ein Buch, das zum «Spiegel»-Bestseller wurde und enormes Echo fand.
Harald Loch
Marina Münkler: Anbruch der neuen Zeit Das dramatische 16. Jahrhundert
Rowohlt Berlin, 2024 539 Seiten 34 zeitgenössischen Abb. 2 Karten 34 Euro
Das freie Leben der Bohemiens
Fangen wir mit einer einfachen Begriffsdefinition an, aus dem Lexikon: Boihemum ist der Name für das Land der Boier, früher Böhmen, heute das Land der Tschechen. Als Begriff benennt er aber auch die Bohème, das ungebundene, ungezwungene Künstlerdasein, im weiteren Sinne ein unkonventionelles Künstlermilieu. Schwab begreift die Bohème als antibürgerlich in seinem Buch:
Andreas Schwab Freiheit, Rausch und schwarze Katzen Eine Geschichte der Bohème CH Beck
als zuweilen neoromantische Gegenbewegung zum unerbittlichen Takt der geschäftigen Moderne, wie es in einer Kritik heißt. So ist es eine Art Widerstandsbewegung gegen alles Gleichmacherische und
Vereinheitlichende, wie es in einem Beitrag von SWR Kultur heißt.
Es waren Künstler, Schriftsteller, Maler, Kabarettisten, die die Libertinage und das Lotterleben liebten, ihre eigenen Regeln für das Leben erfunden haben und sich gegen die allgemeine Langeweile der
Normalität wendeten. Egal, ob sich die Bohemiens in der Großstadt, in ihrer Pleitesituation in Mansarden versteckten, oder in Berlin, Paris oder München in den Cafés und Bars herumtrieben, immer ging
es ihnen darum eine Art Gegenwelt zu entwickeln zu dem was der Normalfall war.
Ob der Maler Edward Munch („Der Schrei“) oder die Schriftsteller
Strindberg und Wedekind, ob die Damen Else Lasker-Schüler oder die Münchnerin Franziska zu Reventlow, allen war gleich, dass sie ihre eigene Definition des guten Lebens erfunden haben, allerdings nicht immer im Reichtum, sondern auch in erlittener Armut am Rande der Gesellschaft.
Diese Art der Lebenskunst war eine praktische Art des Bohemiens, sie war zugleich zuweilen auch politisch, denn sie stand im Geist „der Freiheit“ oder wie der Franzose sagt „de la liberté“.
Schwab zeichnet ein impressionistisch detailliertes, fast pointilistisches Bild der Künstlerinnen und Künstler, er erzählt anekdotisch von ihrem Leben, schildert ihren Alltag und ihre Flucht in die Drogen, in den Alkohol oder Absinth, wir sind stets mittendrin in diesen Freundschaftszirkeln, die ihren Lebenssinn auch darin fanden, den ganzen Tag in einem Café zu sitzen und über Freiheit und Zwang zu sinnieren und sich auszutauschen. Ihre Liebes- und sonstigen Sex-Beziehungen waren äußerst vielfältig, ihre Kneipen hatten so lustige Namen wie „Das schwarze Ferkel“ oder „Die schwarze Katze“.
Es war immer eine Art Gegenentwurf zur sich entwickelnden industriellen Gesellschaft, in der die Maschinen den Ratter-Takt vorgaben. Immer wieder tauchen im Text Gedichte oder Zitat-Stellen aus den Werken der Bohemiens auf, die künstlerisch am Rande der Gesellschaft existent waren. Durch die Schwarz-Weiß- Bilder bekommen wir einen ausgezeichneten Eindruck von jener Epoche, die die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht gemacht hat.
Der Erste Weltkrieg beendet diese Lebensmuster abrupt, denn einige der Protagonisten mussten in den Krieg ziehen oder meldeten sich freiwillig und sterben so auch einen frühen Heldentod.
Dieses Buch ist ein Stück Geschichtsdarstellung über alternative Lebensentwürfe, ohne dass jene die Begriff Alternative oder sogar Querdenken im heutigen Sinne gekannt hätten.
Freiheit, Rausch, Selbstbestimmung, Hedonismus bestimmten das Leben der Bohemiens, die eine künstlerische Subkultur entwickelten, wie manche es in der gleichförmigen Gesellschaft heutiger Tage sich
wieder als eine Renaissance wünschen.
PRESSESTIMMEN
„Er leuchtet tief in die oft widersprüchlichen Biografien von Figuren wie Frank Wedekind, Else Lasker-Schüler oder August Strindberg.“
NZZ Geschichte, Daniel Di Falco
„Anschaulich … ein gutes Beispiel für ein erzählendes Sachbuch, unterhaltend und intelligent, ganz in der Tradition der Sachprosa im englischen und skandinavischen Sprachraum.“
Bücher am Sonntag, Martin Widmer
„Erzählt nicht nur von den Trinkgewohnheiten jener Subkultur, die Ende des 19. Jahrhunderts in Europas wachsenden Großstädten entstand und bis heute fasziniert, sondern gibt auch einen tiefen
Einblick in deren Entstehung und Wirkung.“
Die Presse, Erwin Uhrmann
„Plastisches und klischeebefreites Epochenbild . Das Fehlen akademischer Strenge macht auch den Reiz und den Charme von Schwabs sehr erzählerischer und assoziativer Darstellung aus.“
SWR2 Lesenswert Kritik, Roman Kaiser-Mühlecker
„Ein kluges Buch … Schwab ordnet ein und berichtet in anschaulichen Anekdoten aus dem Leben der Künstlerinnen und Künstler in Paris, Berlin, München oder Wien um 1900.“
Stuttgarter Zeitung
„Die Geschichten dieser wunderbar exzentrischen und verrückten Figuren zu genießen, ist ein großer Gewinn.“
Deutschlandfunk, Andrea Gerk
Auf der Flucht vor Adolf Hitler - die Literatur
Während Hitlers deutsche Truppen In Europa wüten und insbesondere in Frankreich überfallen, müssen verfolgte Literaten flüchten: Anna Seghers, Lion Feuchtwanger, Walter Benjamin und
viele andere.
Da gibt es aber in den Vereinigten Staaten ein Varian Fry, der eine Organisation gründet, die den flüchtenden Literaten helfen sollen.
Während die Gestapo nach Heinrich Mann und Franz Werfel fahndet, Hannah Arendt von Paris aus zu flüchten versucht, Lion Feuchtwanger sich bereits im Lager befindet, machen sich Helfer In den
Vereinigten Staaten bereit, um nach Europa zu kommen und als Helfer der Flüchtlinge tätig zu werden.
Uwe Wittstock beschreibt Lion Feuchtwanger feuchtes Leben zwischen verschiedenen Liebesbeziehungen und auch der Prostitution, ist Anna Seghers detailgenau auf der Fluchtspur zu Fuß, beschreibt die
entsetzliche Lage der Verfolgten in den Massenquartieren, und parallel dazu, immer wieder die vorbereitenden Arbeiten in New York, um den Flüchtenden zu Hilfe zu kommen, denn eine ganze Generation
europäischer Kulturgrößen droht innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Wochen ermordet zu werden. Es war gar nicht so einfach in den USA dafür Verständnis und vor allem Geld zu finden.
Wittstock erzählt in „Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur“ die Geschehnisse auf drei Ebenen.
Da werden einerseits die historischen Schritte damals, in jeweils kurzen Kapiteln gezeigt, also die objektiven historischen Umstände, was die Fluchtrouten angeht. Auf einer zweiten Ebene
spielen die jeweils einzelnen Schicksale der Literaten, die für sich mit dem Ort und dem Datum fixiert werden und auf einer dritten Ebene die Unterstützer in den USA, die in Komitees zunächst
arbeiten und dann in subversiven Organisationseinheiten.
Fast drehbuchartig ist die Struktur des Buches aufgebaut, als wolle die ARD von Heinrich Breloer das Buch jetzt schon verfilmen, oder à la „Babylon“ als Serie ausstatten.
Auch die unterschiedliche Geschichte der drei Literaten aus der Familie Mann, Thomas, Heinrich und Golo wird erzählt, mit allen Turbulenzen die sie jeweils hatte.
Die angreifenden Truppen der Nazis treiben immer neue Flüchtlingswellen vor sich her, belgische, holländische französische Zivilisten, die sich aus den Kampfgebieten zu retten versuchen. Anna Seegers
fürchtet, als Jüdin und als Mitglied der Kommunistischen Partei die Rache der Nazis. Wenn man sie erwischen würde, wäre das auch für ihre Kinder ein Todesurteil. Walter Hasenclever, dessen
Bühnenstücke und Komödien auf den Theatern Europas erfolgreich gespielt werden, stirbt in Aix-en-Provence und wird in einem Sammelgrab beigesetzt. „Die Katastrophe rückt näher“, hatte er noch zwei
Tage vor seinem Tod in einem Brief an seine Frau Edith geschrieben. Währenddessen müssen in Washington und New York Spenden gesammelt werden, um das Hilfskomitee auf den Weg zu bringen. Unterdessen
gehen bei dem panischen Versuch, aus Frankreich zu entkommen bei Franz Werfel und Alma Mahler Werfel zwei Originalmanuskript- Partituren von Gustav Mahler und Anton Bruckner verloren.
Der Süden Frankreichs, unter Pétain-Verwaltung wird zum Sammelpunkt für die Literaten, die nur mit ein paar Habseligkeiten und manchmal auch mit ihren Manuskripten unterwegs sind und ums Überleben
kämpfen. Die Partituren werden übrigens später wieder auf wunderbare Weise gefunden.
Marseille wird zum Brückenkopf für den Fluchtweg der Literaten. Die Visabeschaffung ist mühselig. Manchmal führt der Weg zu Fuß in den Bergen über die Grenzen. Die mühseligen Wanderungen gehen an die
letzten menschlichen Kräfte.
Das spannende Buch ist reich bebildert, endet aber nicht mit dem Jahr 1940 denn in einem extra Kapitel beschreibt Wittstock, was aus den einzelnen Personen danach geworden ist. Etwa ging Heinrich
Mann in die USA, der aber als Schriftsteller dort nicht Fuß fassen konnte. Lion Feuchtwanger, der zu den erfolgreichen Exilautoren wird, lebt am Pazifik in einer Villa mit Blick aufs Meer und
setzt so sein Leben als Schriftsteller fort, Anna Seghers, kehrt 1947 nach Deutschland zurück und wird von 1952 an Präsidentin des Schriftstellerverbands der DDR. Wittstock weist in einem Nachwort
darauf hin, dass diese Einzelschicksale der Schriftsteller, an deren Erlebnisse er entlang die Fluchten genauestens beschreibt, nur Stellvertreter-Schicksale sind für die übrigen zehn Millionen
Menschen, die auf der Massenflucht waren.
Interessanterweise gibt es bis heute keine deutschsprachige Biografie über Varian Freys abenteuerlichen Einsatz für die deutsche Exilliteratur.
Uwe Wittstock, selbst Schriftsteller und Journalist, hat mindestens einmal einen überzeugenden Anfang dazu gemacht.
Für Literaturbegeisterte Leser ein Muss, in dieser Geschichte der Literaturgeschichte zu lesen. In ausführlichen Geschichten erzählt, wenngleich das Historische in der parallel berichteten Chronik
der laufenden Ereignisse dabei etwas zu kurz kommt. Wittstock gibt dem Literarischen eben den Vorrang vor der Geschichte des Nazi-Überfalls. Der ist ja auch oft genug erzählt.
Uwe Wittstock ist Schriftsteller und Journalist und war bis 2018 Redakteur des Focus. Zuvor hat er als Literaturredakteur für die FAZ, als Lektor bei S. Fischer und als stellvertretender Feuilletonchef und Kulturkorrespondent für die Welt gearbeitet. Er wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet.
Pressestimmen
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im März 2024
________________________________________
„Anschaulich und atemlos … Im Grunde gibt es kaum ein historisches Thema, das für unsere Gegenwart so relevant sein könnte wie Marseille 1940 ... Hier erfährt man en détail, wie Schweigen,
Opportunismus und falsch verstandene Zurückhaltung eine brachiale Gewalt ermöglichen und wie schwer es ist, die Würde zu behalten, wenn die Willkür regiert."
DIE ZEIT, Florian Illies
________________________________________
"Ein detailreich recherchiertes, komplex gebautes und spannendes Buch ... Ein Lehrstück über die große Kraft der Solidarität zwischen Menschen und Völkern.“
Süddeutsche Zeitung, Hilmar Klute
________________________________________
"Liest sich wie ein historischer Thriller. Was man aus den zahlreich überlieferten literarischen Zeugnissen da und dort aufgeschnappt hat, ist hier zu einem Storyboard gebündelt, das man bis zur
letzten Seite nicht aus der Hand legen mag.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Joseph Hanimann
________________________________________
„Um die zweifache Sicht geschichtsgetreu zu vermitteln, hat der Autor zahllose autobiografische und briefliche Dokumente … mit einer dichterisch-emphatischen Sprachkraft nacherzählt, wie man ihr nur
selten in Sachbüchern begegnet.“
Tagesspiegel, Paul Michael Lützeler
________________________________________
„Es liest sich wie ein spannender Roman, dessen Protagonisten Figuren der Geistesgeschichte sind. Man kann bei der Lektüre nicht umhin, an heutige Gefahren der Demokratie zu denken.“
Der siebte Tag, Nils Minkmar
________________________________________
„Es ist fast makaber, wie spannend es ist und wie gerne man es liest ... Er reiht eine filmreife Szene an die andere.“
Bayern 2 Diwan, Julie Metzdorf
________________________________________
„Extrem spannend und meisterhaft arrangiert ... Ein fesselnder Wettlauf gegen den Zugriff der Nazis, dem man gebannt folgt.“
Abendzeitung, Volker Isfort
________________________________________
„In diesen Tagen zunehmender Abschottung und eines Kriegs mitten in Europa ist dieses Werk ein wichtiges, eindringliches und beeindruckendes Buch."
Buch-Haltung, Marius Müller
________________________________________
„Wittstock hat die Quellen zur Geschichte des ERC in einem spannend erzählten, streng chronologisch geordneten und von Empathie geprägten Buch zusammengeführt.“
Welt am Sonntag, Wolf Lepenies
________________________________________
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im März 2024:
„Ein packendes Buch über Schicksalsdramen und Menschlichkeit.“
________________________________________
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von der literarischen WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im März 2024
________________________________________
„Großartig … Ein sehr wichtiges, ein ganz tolles Buch und ich lege Ihnen das sehr ans Herz.“
SPIEGEL Online, Elke Heidenreich
________________________________________
"Wittstocks sorgfältig recherchiertes, detailreiches Buch liest sich wie ein Krimi."
WDR 5, Peter Meisenberg
________________________________________
„Ein außergewöhnlich spannend erzähltes Lehrstück über Verzweiflung und Mut in finsteren Zeiten.“
mdr Kultur, Stefan Nölke
________________________________________
„Atemlos, man fliegt da durch.“
ZEIT ONLINE-Podcast "Was liest du gerade?", Maja Beckers
________________________________________
„Enorm spannend.“
ZEIT ONLINE-Podcast "Was liest du gerade?", Alexander Cammann
Platon: Apologie des Sokrates
Ähnlich dem „J’accuse“ des Emile Zola gegen das Dreyfus-Urteil im Paris des 19. Jahrhunderts gehört die Verteidigungsrede des Sokrates aus dem Jahre 399 vor unserer Zeitrechnung zu den Schlüsseltexten weniger der Justizgeschichte als der politischen Philosophie. Der Ausgang der Intervention des französischen Intellektuellen ist bekannt: Dreyfus wurde spät, aber endgültig rehabilitiert. Der Ausgang des Prozesses gegen Sokrates, dessen Kernstück seine Verteidigung, die Apologie, von Platon überliefert wurde, ist ebenfalls bekannt: Der Schierlingsbecher, den Sokrates ohne Furcht vor dem gegen ihn verhängten Tod leerte. Seine Rehabilitation fand in der Philosophiegeschichte statt und findet in der aufwendig gestalteten Ausgabe der handlichen Manesse-Bibliothek ihren aktuellen Ausdruck. Sie wurde angereichert durch ein weniger juristisch als philosophisch bewunderndes Nachwort von Otto Schily. Der Schweizer Altphilologe Kurt Steinmann hat das Original übersetzt und an entscheidenden Stellen interessant kommentiert. Über 60 Bewunderer der Apologie kommen mit Pastiche-Zitaten zu Wort – Beweise der über zwei Jahrtausende andauernden Rehabilitation.
Eine kurze Einführung in die Athener Strafprozessordnung: Im Gegensatz zu der hierzulande bekannten Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft („die objektivste Behörde der Welt“, die auch zu Gunsten des Angeklagten ermitteln muss) galt in Athen damals die Popularklage, die jeder Bürger gegen einen anderen erheben konnte. Sie war bei einem Beamten einzureichen, der nur für die Anberaumung und Organisation des Gerichtstermins zuständig war. Das Gericht bestand aus 500 Athener Männern über 30 Jahre, die durch das Los ermittelt wurden. Vor ihnen spielte sich das Verfahren in Anklagerede und Verteidigung ab, die auch die Ankläger befragen durfte.
Ob eine Beweisaufnahme im Verfahren gegen Sokrates stattfand, ist nicht bekannt. Angeklagt war er wegen Missachtung der Götter, an die er angeblich nicht glaubte und wegen Verführung von Jugendlichen zu kritischem Hinterfragen eines Lebenswandels, der nach materiellen Gütern strebte. Sokrates bewies in seiner Verteidigung, dass er sehr wohl an die in Athen verehrten Götter glaubte und bestand darauf, der Jugend zu einem mit Sinn angereicherten Leben verhelfen zu müssen. Seine Methode war, durch Fragen seine Gesprächspartner zu Antworten zu zwingen, die der Wahrheit entsprachen. Diese Methode wandte er auch in seiner Verteidigung an.
In einer populistisch aufgeladenen Atmosphäre entschieden sich 280 für schuldig, 220 für unschuldig. In einer zweiten Stufe des Verfahrens musste das Strafmaß festgelegt werden. Die Anklage verlangte die Todesstrafe und Sokrates beantragte für sich stattdessen eine Belohnung mit einem Festessen, das siegreichen Feldherrn oder Siegern bei den Olympischen Spielen vorbehalten war. Mit diesem Coup, der wie eine „Ungebühr vor Gericht“ erscheinen konnte, aber der eigenen Wertschätzung des Sokrates entsprang, verprellte er einen Teil derjenigen Richter, die zuvor für „unschuldig“ gestimmt hatten, die nun für die Todesstrafe stimmten.
Das alles ist kein juristisches Lehrstück. Wahrscheinlich hatte Montaigne Recht, wenn er „fast zu glauben wagte, dass Sokrates seiner Verurteilung gewissermaßen durch gewollte Fahrlässigkeit Vorschub leistete.“ Trotzdem werden ihm seine Unbeugsamkeit und das Fehlen jeglicher Todesfurcht immer einen philosophischen Heldenstatus sichern. Sicher hat auch Hegel Recht, wenn er schrieb: „Sein Schicksal ist die Tragödie Athens, die Tragödie Griechenlands.“ Und so schön wie Vladimir Nabokov kann man Sokrates auch lesen: „Ironie ist die Methode, deren Sokrates sich bedient. Im weitesten Sinne ist Ironie bitteres Lachen. Ach, nicht doch, mein Lachen ist ein gutmütiges Glucksen, das ebenso aus dem Bauch wie aus dem Kopf kommt.“ Und Walter Benjamin bringt es auf den Punkt: „Sokrates sieht dem Tode ins Auge wie ein Sterblicher – wie der beste, der tugendhafteste der Sterblichen.“
Harald Loch
Platon: Apologie des Sokrates
Aus dem Griechischen übersetzt und kommentiert von Kurt Steinmann
Mit Nachrufen, Reverenzen, Korrespondenzen von Xenophon bis Kundera
Nachwort von Otto Schily
Manesse Verlag, München 2023 182 Seiten 24 Euro
Russland - der Fluch des Imperiums
Sich von Klischees und Stereotypen, von falschen Einschätzungen und Interpretationen zu lösen, fällt den Menschen sehr schwer. Wer gibt schon gerne freiwillig Irrtümer zu? Seit dem Krieg in der Ukraine sind wir gezwungen dazu.
Es sind zwei Begriffe, die der Münchner Historiker als Leitmotive durch seine historische Monographie zieht. "Pfadabhängigkeiten" in der Historie, der eine, die wiederkehrenden Muster, die
eingefahrenen Routen, oder anders gesagt die Routine-Geleise, denen die Geschichtsinterpretation folgt.
Der andere Begriff ist „Empire Fatigue“ „Imperiums-Müdigkeit“, die der Autor dem postsowjetischen Staat Russlands bescheinigt. Diese ideenreiche Interpretationsmuster des Autors selbst sind fundiert
durch eine detailgenaue, präzise formulierte, prägnante, differenzierende, analytisch grundierte Darstellung, die keineswegs historische Langweile vor sich herschiebt.
Nein, auch der normale Leser kann folgen, denn Schulze Wessel transportiert gleichzeitig in seinem Text auch Literatur- und Ideengeschichte Russlands mit, vergleicht die nationalen Selbstbilder
Russlands, Polens und der Ukraine. Dabei wachsen darin die antieuropäischen Ressentiments.
Der Historiker an Ludwig-Maximilians-Universität zeigt die Ukraine als eigenständiges nationales Subjekt, das immer nach seiner Freiheit sucht (Voltaire).
Im Buchmanuskript verwendet der Autor ukrainische Schriftzeichen, das irritiert den Lesefluss nur für einen Moment, dann aber wird schnell klar, warum das so sein muss. Kyiv statt Kiew, Odesa statt
Odessa.
Die politischen Ordnungen Russlands und der Ukraine entwickelten sich entgegengesetzt. Russland fehlt die Fundierung des postsowjetischen neuen Staates durch revolutionären Volkswillen. Während sich in der Ukraine Protestkultur entwickelte, wurde diese in Russland systematisch unterdrückt. „Über die wichtigen Fragen der Politik entschied Putin allein.“ 78 Prozent der russischen Eliten verdankten ihre Karriere dem KGB oder der Armee. Subversion, Destabilisierung und Desinformation wurden zur alltäglichen Ware der russischen Politik.
Das Buch summiert aber auch zeitgeschichtlich, die aktuellen Grundfragen der internationalen Politik, die ins Wanken geratene westliche und östliche Sicherheitsarchitektur, aber auch am Ende die
singulären deutschen Fehleinschätzungen gegenüber Osteuropa.
Der Historiker klärt auch auf über die Erzählweise Putins über das „große Russland“ und den „bösen Westen“ und das herausgehobene Beziehungsgeflecht Deutschlands gegenüber den russischen Eliten und
deren Missinterpretationen.
Das Buch, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“ ist eine "Diplomatie-, Ideen- und Kulturgeschichte".
Sie beginnt mit „Moskaus Weg nach Europa“, zeigt Kriegs- und Revolutionsepochen, die Unterdrückungsmechanismen gegenüber Polen und der Ukraine, Krimkriege, Bürgerkriege und Aufstände, den Holodomor,
die Hitlerzeit, Stalinismus und Poststalinismus bis hin zur neuen Ostpolitik, Sowjetnostalgie und Russlands Weg in die Diktatur, gegründet auf der Zwangsvorstellung von der Einzigartigkeit Russlands,
und dem schwachen Westen, der dem Untergang geweiht ist.
Eine historische Epoche ist an ihr Ende gekommen, es gilt die „gewendete Zeit“ zu beschreiben, endet das Buch. Eine brillante Studie, die zur Analyse der heutigen Situation bestens geeignet
ist.
Martin Schulze Wessel ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Mitglied der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Von 2012 bis 2016 war er Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands.
Martin Schulze Wessel Der Fluch des Imperiums Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte CH Beck
Links
Bayerischer Rundfunk
https://www.br.de/nachrichten/kultur/der-irr
weg-in-der-russischen-geschichte-fluch-des-imperiums,Ta62g1O
Südwestrundfunk
https://www.swr.de/swr2/literatur/martin-schulze-wessel-der-fluch-des-imperiums-die-ukraine-polen-und-der-irrweg-in-der-russischen-geschichte-swr2-lesenswert-kritik-2023-07-24-100.html
Der Nürnberger Prozess und die Reporter/Innen
Es waren Schriftsteller, Journalistinnen, Reporter, die zum Nürnberger Prozess kamen, große Namen wie Erich Kästner, Golo Mann, Willy Brandt, Markus Wolf, Gregor von Rezzori, John Dos Passos, Robert Jungk. Sie sollten über den Kriegsverbrecher-Prozess berichten, weil sich vor dem Tribunal die noch lebenden Nazi-Größen für den Holocaust verantworten mussten.
Das sogenannte „press camp“ war auf dem Nobelschloss Faber-Castell untergebracht. Die Reporter saßen in ihren Zimmern auf Feldbetten oder trafen sich an der Bar, im Salon, im Kino zum Smalltalk oder
zum Verköstigen von reichlich Alkohol.
Das Presselager war also im so genannten „Bleistiftschloss“ der adeligen Familie Faber-Castell untergebracht.
Zur Debatte standen vor Gericht die unvorstellbaren Nazi-Gräuel, die von der NS-Diktatur angeordnet worden waren. Zum ersten Mal sollte im Nürnberger Prozess der NS-Prominenz also nach dem modernen
Völkerstrafrecht in einem Tribunal der Prozess gemacht werden.
Die amerikanische Besatzungsbehörde hatte die Führung im Presselager gesucht. Zugleich spielten die Russen ihre Sonderrolle.
Das Presselager war prominent besetzt. Ob Willy Brandt oder dessen späterer DDR-Kontrahent Markus Wolf, Erika Mann, Wolfgang Hildesheimer, der Pressestab kannte große, auch schon international
bekannte Namen. Mit dieser zwischenkulturellen Besetzung war ein gesellschaftliches Experiment verbunden, eine Art „sozialer Testlauf“, wie der Autor schreibt.
Neumahr, der selbst Romanist und Germanist ist und als freier Autor und Literaturagent arbeitet, interessiert sich in dem hier zu rezensierenden Buch weniger dafür, die Angeklagten zu porträtieren,
sie spielen quasi die Nebenrolle, vielmehr konzentriert sich der Autor auf die Berichterstatter.
Er diagnostiziert im Vorwort, dass die Nürnberger Prozesse denen, die ihnen beiwohnten, menschlich Verletzungen der Seele beigebracht haben, aber auch in ihrem Schreibstil als Berichterstatter
Wirkungen hinterließen.
Manchmal half Sarkasmus über den infernalischen Wahnsinn der Verbrechen hinweg.
Der Autor orientiert sein Buch und die Dramaturgie der Kapitel an der Chronologie des Prozessgeschehens. Doch die einzelnen Abschnitte des Buches sind an den Bericht erstattenden Personen
orientiert.
Nebenbei berichtet Neumahr selbst auch über die deutsche Presse in der Stunde null, über das Faberschloss, er zeigt Bilder, Grafiken, Karikaturen, ordnet den Ost-West-Konflikt ein, nimmt
Alltagsbeobachtungen der prekären Lebensumstände in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit auf, schreibt viel Atmosphärisches und Anekdotisches auf und spart auch nicht an Kritik über den Prozess
selbst.
Auch interessant das Schicksal der weiblichen Kriegsberichterstatter in einer damals stark an Männern orientierten Welt etwa, die Lebenslinien der Martha Gellhorn, die mit Hemingway liiert war.
Am Ende des Buches geht der Autor auch in einer Art Nachwort Golo Manns Einsatz für den zum Tode verurteilten Rudolf Hess ein, der jahrzehntelang hinter Gittern seine Strafe absitzen musste, der
„letzte von Spandau.“
Das Buch endet - und das sei hier kritisch angemerkt, ohne ein richtig resümierendes Schlusskapitel, das noch einmal die einzelnen Thesen des Buches aufführt - mit einem Schlussurteil des Autors
selbst. Es endet also etwas abrupt. Dennoch ist das Buch sehr lesenswert, weil es uns in einen Abschnitt der deutschen Geschichte katapultiert, der durch den großen Zeitabstand zunehmend in
Vergessenheit geraten ist. Uwe Neumahr versucht das erfolgreich zu verhindern.
Uwe Neumahr Das Schloss der Schriftsteller Nürnberg '46. Treffen am Abgrund C.H. Beck Verlag
Uwe Neumahr ist promovierter Romanist und Germanist. Er arbeitet als Literaturagent und freier Autor.
Roter Hunger in der Ukraine
Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama vertrat dereinst die These, dass sich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in der Sowjetunion die Demokratie überall durchsetzen würde. Damit entfalle das Antriebsmoment der Geschichte. Schaut man nach Moskau und Kiew, fängt Geschichte gerade erst an.
Das historische Buch ist den Opfern gewidmet, bis zu 4,5 Millionen sollen es gewesen sein. Manche Schätzungen sprechen gar von bis zu zehn Millionen, die zu Opfern der kommunistischen
Zwangskollektivierung wurden.
Auf 540 Seiten beschäftigt sich die renommierte britische Historikerin mit der ukrainischen Revolution, den zahlreichen Rebellionen, den Hungerperioden der gescheiterten Kollektivierung der
Landwirtschaft, den unzähligen Beschlagnahmungsbeschlüssen von Getreide, die den Hunger dann zur Folge hatten.
Die Hungersnöte - vor allem in der Zeit zwischen 1932 und 1933 - sind ihr Hauptthema, und am Endes des Buches steht die Vertuschungspolitik der Holodomors in Geschichte und Politik sowie in einem
Epilog die Wiederaufnahme der ukrainischen Frage, die aktueller ist denn je.
Die historische Studie ist komplex und umfangreich, und sie zeigt die schweren Folgen einer ausbeuterischen Politik durch die kommunistische Partei, die das Land Ukraine ausbeutete, um die Klasse der
Bauern brutal und menschenverachtend zu unterjochen.
Es ging darum, das Land zu kollektivieren, die Getreidevorräte zu beschlagnahmen und die Lagerung aller Überschüsse an festgelegten Punkten zu erzwingen. Es war ein Massaker schon von Anfang an.
12.000 Menschen wurden nach Verurteilung durch die Revolutionstribunale ermordet. Für die Bolschewiki ging es um die Erledigung des Kulaken-Aufstands. Kulaken waren ursprünglich „wohlhabende Bauern“,
sie wurden zu Feinden des Sowjetsystems erklärt und bekämpft. In der Folge der Revolution wurden in der ganzen Ukraine bei 1.200 Pogromen mindestens auch 50.000 Juden getötet, die am weitesten
gehenden Untersuchungen sprechen sogar von 200.000 Toten.
Lenin schreibt 1922 in einem Brief an Molotov: “Wir müssen alle diesen Leuten unverzüglich eine solche Lektion erteilen, dass sie auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr an irgendwelchen Widerstand denken
werden.“ Solche Sätze klingen erschreckend aktuell in der Diktion des staatlichen Terrors.
Es war früher üblich, dass sowohl die russischen wie die ukrainischen Bauern Schlechtwetterperioden und regelmäßige Dürren überstanden, in dem sie auf eingelagerte Getreideüberschüsse zurückgriffen,
so konnten Beschlagnahmungen überhaupt erst möglich werden. Wer das Getreide nicht herausrückte, wurde einfach liquidiert.
Die Folgen der Hungerkatastrophe waren immens. Menschen aßen aus Not ihre Hunde oder Ratten und Insekten, sie kochten Gras und Blätter, ja es soll sogar Fälle von Kannibalismus gegeben haben. Ein
Augenzeuge schildert: „Die Bolschewiki beraubten die Leute und nahmen die Pferde und Ochsen mit, es gibt kein Brot, die Leute verhungern.“
Der Arbeiterstaat war nicht erfolgreich, den Menschen einen gewissen Wohlstand zu bringen, auch Lenins neue ökonomische Politik scheiterte.
200.000 Kulaken wurden auch nach Sibirien, Nord-Russland, Zentralasien und in andere Gegenden der Sowjetunion verschleppt, wo sie als Spezialsiedler lebten und die ihnen zugewiesenen Dörfer nicht
verlassen durften. Mindestens 100.000 Kulaken wurden direkt in den Gulag geschickt, „weil man nicht wusste, wo man sie sonst unterbringen sollte“. Übrigens wurden auch 10.000 Kirchen in der
ganzen UdSSR geschlossen und zu Lagerhäusern, Kinos, Museen oder einfachen Garagen umgewandelt.
Was die Parteiführung im Zentralkomitee erkannt hatte, „Hätten wir nicht sofort Maßnahmen gegen Verletzungen der Parteilinie ergriffen, dann hätte es eine große Welle von Bauernaufständen gegeben,
viele unserer Funktionäre vor Ort wären von den Bauern umgebracht worden.“
Widerstand gab es immer gegen die Entkulakisierung und Kollektivierung.
Stalin fürchtete1932 in einem Schreiben an Kaganowitsch „… dann könnten wir die Ukraine verlieren“.
Die Lebensmittelknappheit wird zu einem Dauerzustand, und die Menschen leiden fortan an Krankheiten, die auf die bloße Ernährungsmenge zurückzuführen sind. Sie bekommen aufgeschwollene Bäuche, finden
kein Essen, greifen zum Pferdefutter oder Pferdeknochen und erkranken. Überall liegen die Leichen in den Straßen herum, Diebstähle und Plünderungen nehmen zu.
Schnell wird ein Gesetz erlassen, um öffentliches Eigentum als „heilig und unantastbar“ zu schützen. „Vor diesem Hintergrund ist der entschiedene Kampf gegen die Plünderer öffentlichen Eigentums die
wichtigste Aufgabe jedes Organs der Sowjetverwaltung.“ Erschießungen und Beschlagnahmung des gesamten Besitzes werden angedroht oder Freiheitsstrafen von nicht unter 10 Jahren ausgesprochen. Der
Handel mit Saatgut, Getreide, Mehl oder Brot wird verboten. Wer etwas heimlich verkauft, wird festgenommen. Polizisten beschlagnahmen Getreide, Brot auf Märkten und Basaren, die Bauern dürfen weder
Getreide kaufen, eintauschen, noch irgendwie überhaupt besitzen. Es folgen auch finanzielle Sanktionen. Kredite gibt es nicht mehr, das Vieh wird beschlagnahmt, Gartenparzellen konfisziert.
Und dann werden - wie immer - die Schuldigen gesucht, die Sündenböcke, um die Getreidekrise zu erklären. Massen-Säuberungen der ukrainischen KP erfolgen, Attacken auf Professoren, Lehrer, Akademiker
und Intellektuelle, die die ukrainische Nationalidee gefördert hatten. Institutionen werden gesäubert, geschlossen oder umgewandelt, etwa Universitäten, Akademien, Galerien und Künstlerclubs. Opfer
werden die Ukrainische Akademie der Wissenschaften, Film-Studios, das Institut für Sowjetrecht. 200 Theaterstücke werden verboten so wie die Übersetzung von Klassikern der Weltliteratur in die
ukrainische Sprache. Auch Wörterbücher werden „sowjetisiert“.
Die Menschen essen Pferde, Hunde, Katzen, Ratten, Ameisen, Schildkröten, Eichhörnchen, Moos, Eicheln, Blätter, Löwenzahn, Ringelblumen, Krähen, Tauben, Spatzen, Katzen, um zu überleben. 4,5 Millionen
Menschen starben.
Für Stalin waren die Opfer Saboteure. Sie hatten sich gegen die proletarische Revolution verschworen, führten Krieg gegen die Sowjetmacht. Sie waren nicht Opfer, sondern Täter, hatten die Hungersnot
verursacht und es darum verdient, zu sterben. Gegenüber dem Ausland wurde die Hungersnot einfach geleugnet.
Das Buch entlarvt das Vorgehen der Machthaber, entschlüsselt die historischen Hintergründe, lässt Zeugen zu Wort kommen, schildert eindringlich die Folgen der erzwungenen Hungerkatastrophe, ein
Standardwerk, das viele Erklärungsmuster aus der Vergangenheit liefert, die uns heute helfen, den Angriffskrieg auf die Ukraine wenigstens nachzuvollziehen, wenn man ihn schon nicht verstehen kann.
„Anne Applebaums Buch wird gewiss zum Standardwerk über eines der größten Verbrechen der Menschheit“, schreibt Timothy Snyder.
Das schon 2017 erschienene Buch endet nicht ganz so pessimistisch: „Die Geschichte enthält Hoffnung ebenso wie Tragödien. Letztlich wurde die Ukraine nicht vernichtet. Die ukrainische Sprache ist
nicht verschwunden - ebenso wenig wie der Wunsch nach Demokratie, nach einer gerechten Gesellschaft oder nach einem ukrainischen Staat, der wirklich die Ukrainer repräsentiert.“
Die Nation stehe noch auf der Landkarte, das Wissen über die Gräuel im 20. Jahrhundert helfe, die Zukunft zu formen.
Putins Angriffskrieg lässt daran nicht nur leise Zweifel aufkommen. Und, dass Geschichte zu Ende ist, muss wohl auch umformuliert werden: Neuere Geschichte fängt gerade erst an, bei allen Zweifeln
und Unsicherheiten, die wir derzeit hegen, ist eine Gewissheit glasklar: Unsere Gegenwartsversessenheit und Geschichtsvergessenheit können wir ad acta legen.
Anne Applebaum ROTER HUNGER Stalins Krieg gegen die Ukraine SIEDLER
Anne Applebaum, geboren 1964 in Washington, D. C., ist Historikerin und Journalistin. Sie begann ihre Karriere 1988 als Korrespondentin des „Economist“ in Warschau, von wo sie über den Zusammenbruch des Kommunismus berichtete. Seit langem beschäftigt sie sich mit der Geschichte der autoritären Regime in Osteuropa. Für ihr Buch „Der Gulag“ (2003) erhielt sie den Duff-Cooper- und den Pulitzer-Preis. Sie arbeitet als Kolumnistin für die Zeitschrift „The Atlantic“ und als Senior Fellow an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
Olympiade 72 - heitere und traurige Spiele
Es war ein Sommermärchen bevor das Wort Sommermärchen in aller Munde war. Aber es endete nicht wie bei den Märchen im Guten. Terroristen stoppten den warmherzigen deutschen Olympiade-Sommer 1972 mit der brutalen Geiselnahme der israelischen Sportler. Man verzeihe, wenn ich dabei Persönliches erwähne. Als hospitierender junger Redakteur war ich Mitglied der Olympiaredaktion der tz und erlebte auch die Geiselnacht hautnah mit. Eine Nacht zuvor hatte ich Teile der israelischen Olympiamannschaft in einer Disco kennengelernt. Eine Nacht später waren sie tot.
In der Nacht von Fürstenfeldbruck hatte Regierungssprecher Bölling irrtümlich gemeldet, dass die Geiseln befreit sind. Nie werde ich - in die Redaktion zurückgekehrt - vergessen, dass ich eine Stunde
brauchte, um den damaligen Verleger zu überzeugen: Wenn die Schlagzeile heißt, „Alle Geiseln leben“, aber die Wahrheit heißt, „Alle Geiseln sind tot“, dass dies ein nimmer gutzumachender Imageschaden
für die Zeitung und den Journalismus allgemein bedeuten würde. Nach 60 Minuten Debatte war der Verleger überzeugt und gab das Go! Etwa gegen 4 Uhr morgens kamen nach und nach 40 Kollegen ins Blatt,
danach produzierten wir, fast im Stundentakt eine neue tz-Ausgabe nach der anderen.
Übrigens die Boulevardzeitung tz kommt in diesem Buch als Quelle ebenso gut weg wie die Münchner ABENDZEITUNG.
Brauckmann/Schöllgen haben in dem Buch ein vielfarbiges Olympiamosaik zusammengetragen, das an Detailgenauigkeit und Schärfe der Beobachtung nichts zu wünschen übrig lässt. Es ist kein reines
Sportbuch des Medaillenregens, natürlich kommen Gewinner wie Rosendahl, Meyfarth und Co als Hauptpersonen des Olympiadestücks vor. Das Autorengespann leuchtet jedoch das Gesellschaftliche und
Politische mit dem Sportlichen auf gleicher „Treppchenhöhe“ aus, und alles ist trotz Historikerbeteiligung von Gregor Schöllgen ganz und gar nicht trocken geschrieben. Prall, saftig, genau, nah dran,
die Stimmen und Stimmungen jener Zeit einfangend. Das Lokalkolorit ist mit dabei, die Ohren- und Augenzeugen kommen zu Wort, es ist ein Zitatenschatz und
eine lebendige Chronik der laufenden Ereignisse.
The „games must go on“ war das Credo des damaligen IOC-Präsidenten Avery Brundage, und so gingen die Spiele auch weiter. Als ich Hans-Dietrich Genscher später einmal befragte, was sein bedrückendstes Erlebnis in seinem langen politischen Leben war, nannte er die misslungene, völlig fehlgeschlagene, laienhafte Polizeiaktion in Fürstenfeldbruck, und es war zu spüren, wie tief beim damaligen Innenminister diese Wunde auch des eigenen politischen Versagens lebenslang noch in ihm schwelte.
Vielleicht kommen die Kapitel über das terroristische Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in dem Buch in der politischen Bedeutung etwas zu kurz, vielleicht ist manche Einzelheit der
Olympiatage etwas zu detailhaft dargestellt, aber Historiker sind ja gezwungen genauestens zu arbeiten.
Ein gravierendes Detail tritt in dem Buch jedenfalls gerade deswegen klar zutage: Die heiteren Spiele als Konzept haben den Boden bereitet, für den leichten Zugang der Terroristen ins Olympische
Dorf. Die Gitterzäune waren durchlässig und die Sicherheitskontrollen nachlässig. Wäre das Sicherheitskonzept präziser gewesen, hätte man unter anderen Umständen das Attentat verhindern können. So
sieht man, dass Ungenauigkeit eben doch wichtig ist und töten kann. Deutschland sollte keineswegs das Image des kontrollierenden Polizeistaats haben. Doch klar ist, von diesem historischen Zeitpunkt
an beginnt die konzeptionelle internationale Terrorismusbekämpfung. Auch das war damals eine Zeitenwende. Das Erinnerungsbuch über einen deutschen Sommer hält uns den Spiegel vor und erzählt, wie wir
wurden, was wir sind.
Markus Brauckmann, Jahrgang 1968, ist Autor und Regisseur. Nach Studien in Berlin und den USA arbeitete der Politologe für RTL und ProSieben sowie in mehreren
Bundestagswahlkämpfen. Seine TV-Dokumentationen wurden im In- und Ausland mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt gewann er die „Romy“ für einen Film über Niki Lauda. Markus Brauckmann lebt in
Köln.
Gregor Schöllgen, Jahrgang 1952, war von 1985 bis 2017 Professor für Neuere Geschichte an der Universität Erlangen und in dieser Zeit auch für die historische
Ausbildung der Attachés im Auswärtigen Amt verantwortlich. Er lehrte in New York, Oxford und London und war unter anderem Mitherausgeber der Akten des Auswärtigen Amtes sowie des Nachlasses von Willy
Brandt. Gregor Schöllgen konzipiert historische Ausstellungen und Dokumentationen, schreibt für Presse, Hörfunk und Fernsehen und ist Autor zahlreicher populärer Sachbücher und Biographien.
Markus Brauckmann/Gregor Schöllgen München 72 Ein deutscher Sommer DVA
Grenzen - gestern- heute - morgen
656 Seiten sind eine stramme Herausforderung für den geneigten Leser, schon vom Gewicht her, für das Lesen in horizontaler Bettlage eher weniger geeignet. Zudem erfordert es volle Konzentration und die Bereitschaft, sich auf das geschichtliche Detailwissen des Autors im Einzelnen tiefer einzulassen. Also aufrecht lesen und darüber hinwegsehen, dass es schon vor zwei Jahren erschienen, heute aber aktueller denn je geworden ist.
Kritiker haben bemängelt, in dem Buch sei zu wenig Gegenwart und Zukunft vorgesehen, mit Verlaub die Herren vom Feuilleton, ein Historiker neigt dazu, die Vergangenheit ernster zu nehmen als das
Gegenwärtige, und wir neigen inzwischen dazu, geschichtsvergessen zu sein. Siehe Russlandkrieg gegen die Ukraine!
Zuletzt beschäftigten wir uns mit Grenzen, als 2015 die Flüchtlingsströme einsetzten. Jetzt sind sie wieder da, an anderen Grenzen, und da ist zusätzlich jemand, der gerade mit Panzern und
Bombenangriffen, zuletzt mit grünen Männchen Grenzen verschoben hat, wohl zu lange von uns unbehelligt, mit brutaler Härte die Grenz-Friedensordnung niederzureißen. Das konnte Demandt allenfalls
ahnen, aber sein Buch dient grundsätzlich dazu, Grenzverständnis aus der Geschichte heraus zu entwickeln.
Demandt klärt zuerst, ganz Wissenschaftler, die Begriffe und sein historisches Instrumentarium. Fast grenzenlos streift sein analysierendes Auge über alles hinweg, was Grenze ist, wo Grenze liegt,
wie Grenze wirkt. Denn schon Epikur meinte: „Es muss bei jedem Wort das ursprünglich Gemeinte beachtet werden.“
Gehen wir zurück ins Jahr 1174. Da taucht in einer Urkunde des Herzogs Kasimir I von Pommern das Wort Grenze auf, abgeleitet aus dem polnischen granica oder graniza. Das altdeutsche Wort für Grenze
heißt: „Mark“. Aber nicht eingeschränkt auf Territoriales ruft Demandt ins Bewusstsein, dass GRENZE eine Grundkategorie beim Wahrnehmen und Bezeichnen, beim Denken und Handeln darstellt.
So finden wir bei ihm im Buch kapitelweise Raum- und Zeitgrenzen, kosmische Grenzen und sachliche Grenzen. Bis auf Seite 128 finden wir Strecken, Grenzpunkte, Meilensteine, natürliche und künstliche
Grenzen, politische und gesellschaftliche, Flüsse und Gebirge als Grenzen, bei den Tieren sind es Reviere, bei den Staaten sind es Hoheitsgrenzen: “Völker, die ihr abgegrenztes Territorium verloren
haben, verschwinden in der Regel aus der Geschichte“, etwa Karthago, die Etrusker, Kelten, Hunnen, und mit Erschrecken denkt der Leser jetzt aktuell an die Ukrainer.
Chinesische Mauer und Limes sind Militärgrenzen, sie sollen den ungestörten Frieden im Inneren sichern. Im Krieg sind Militärgrenzen die momentan erreichten Linien des militärischen Vordringens.
Demandt behandelt Sprach- und Kulturgrenzen, Konfessionsgrenzen, und Zeitgrenzen. (Salomo sagt: „Alles hat seine Zeit.“) Wir sprechen von Ära und Perioden, setzten Termine und haben selbst auch
eine Grenze, unser Lebensalter. Überall sehen wir uns Grenzen gegenüber. Nicht zu vergessen die kosmischen Grenzen, in denen die Erde eingebettet ist. Der Politik sind sachliche Grenzen gesetzt und
andere auch, und im Sport versuchen Athleten ständig, über ihre Grenzen hinauswachsen.
Im ausführlichen Mittelteil beschäftigt sich der Historiker mit den Juden, den Babyloniern, Syrern, den Persern, Karthagern und Chinesen. Sechs Kapitel sind den Grenzen der Griechen gewidmet. Zwei
umfangreiche Kapitel gelten dem Thema Rom und seinen Grenzen, es folgen die Germanen und das Mittelalter und schließlich die Neuzeit und damit das Thema Europa.
Besonders interessant ist das Kapitel Auflösung der Sowjetunion: „Ein ewiger Unruheherd bleibt die Kaukasusregion, die geographisch schon zu Asien gehört.“ Russland, als atomare Macht in
Hegemonialstellung, sieht mit Misstrauen auf die Entwicklung: „Der Zusammenhalt lockert sich mit der Westorientierung der europäischen Nachfolgestaaten. Die Grenzgeltung schillert.“
Und wenn es je eines Beweises für die wahre Erkenntnis den Schlusskapitelsatzes bedurft hätte: Der Russland-Krieg gegen die Ukraine zeigt uns die Verschiebbarkeit von Grenzen auf, und Demandt fasst
zusammen: „Das Phänomen Grenze kristallisiert im Thema des Todes. Der Tod ist die Grenze, die wir vor uns, nachdem wir die Grenze der Geburt hinter uns haben.“ Und die
Grenzziehungen liefern den Grund für das Sterben.
Grenzen haben ein Janusgesicht, Schutz von innen, Warnung von außen, Orte der Freundschaft und Begegnung, der Feindschaft und der Bekämpfung des Nachbarn. Und sie sind Startlinien des Vordringens,
somit „Orte des Krieges“
.
„Grenzen sind selten Erzeugnisse von Einsicht und Einvernehmen, meistens Ergebnisse von Gewalt, Gewöhnung und Geschäften zwischen Gewaltigen.“ Eine nüchterne Schlusserkenntnis.
Ein Buch über die Grenzen der Welt, Grenzen des Denkens und Grenzen des Wissens. Und, was wir neuerdings wieder erleben, sind es die Grenzen- und Kriegserfahrungen, die uns auch die Grenzen der
internationalen Politik aufweisen.
Alexander Demandt, geboren 1937 in Marburg, von 1974 bis 2005 Althistoriker und Kulturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Zu seinem umfangreichen Werk gehören Bücher über das Römische Reich, über Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Zuletzt erschienen bei Propyläen »Zeit«, »Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte« und »Es hätte auch anders kommen können. Wendepunkte deutscher Geschichte«.
Alexander Demandt GRENZEN Geschichte und Gegenwart Propyläen
Die deutsch-russischen Beziehungen
„It’s the economie, stupid“, dieser Slogan stimmt nur in rational handelnden Gesellschaften. Autokraten, Diktatoren handeln anders, weil sie die Vernunft ausschalten. Ein Blick auf die deutsch-russischen Beziehungen im „langen 20. Jahrhundert“ belegt das. Diesen Blick wirft mit kritischer Urteilskraft der 1961 geborene Rostocker Professor für Zeitgeschichte Stefan Creuzberger in seinem überwältigend faktenreichen und hochaktuellen Buch „Das deutsch-russische Jahrhundert“. Es ist vor dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine abgeschlossen worden, sieht diesen aber schon fast ante portas. Solche grundsätzlichen Geschichtsschreibungen können nur auf der Basis früherer Forschungen und Darstellungen gelingen, die ihrerseits auf Quellenstudien beruhen. Creuzberger schöpft aus der profunden Kenntnis des vorliegenden historiografischen Materials und schreibt fesselnd über die aktuellen Entwicklungen als miterlebender Zeitzeuge.
Das Buch ist nach drei Analysekriterien gegliedert: Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt sowie Abgrenzung und Verständigung. Im Innern folgen diese Hauptteile der Chronologie, die aber nicht
gleitend, sondern an markanten Daten festgemacht wird. Diese unkonventionelle Darstellung vermeidet Wiederholungen und erhellt die in den Mittelpunkt der Kapitel gestellten besonderen Wirklichkeiten.
Das im 19. Jahrhundert gewachsene deutsch-russische Verhältnis, durch dynastische Verwandtschaften gefestigt, hätte eigentlich den Ersten Weltkrieg undenkbar erscheinen lassen. Zumal: „Im Jahr 1913
bezog das Zarenreich aus dem Deutschen Kaiserreich 47,6 % seiner Gesamteinfuhren. Deutschland bezog im Gegenzug 44,3% der gesamten russischen Warenexporte.“ Trotz dieser einmaligen
Wirtschaftsverflechtung beteiligten sich beide Länder am Ersten Weltkrieg. In diesem setzten – das ist kaum bekannt – die deutschen Truppen erstmalig Giftgas in der Schlacht von Bolimów am 31.1.1915
ein. Dabei „handelt es sich um einen eklatanten Tabubruch, der letzte Formen ritterlicher Kriegführung außer Kraft setzte. … Schätzungen zufolge hatten die zaristischen Armeen mit rund einer halben
Million Mann die meisten Gaskriegsopfer des Ersten Weltkriegs zu beklagen.“
Dieser Krieg endete für die beiden Länder mit dem deutschen Diktatfrieden von Brest-Litowsk, den so ungleiche Personen, wie kaiserliche deutsche Diplomaten und Militärs mit Revolutionären der jungen
Sowjetmacht schlossen. Der zwischen dem deutschen Kaiserreich und den westlichen Kriegsgegnern ein Jahr später geschlossene Friedensvertrag von Versailles brachte den Umsturz in Deutschland. Die
Weimarer Republik blieb daraufhin lange Zeit ebenso isoliert wie die junge Sowjetunion. Creuzberger lenkt den Blick auf die widersprüchliche Haltung der beiden „Paria“-Länder zueinander: Einerseits
versuchte die junge Sowjetmacht kommunistische Aufstände in Deutschland zu unterstützen, andererseits umging Deutschland die Versailler Restriktionen der Reichswehr durch streng geheime
Waffenentwicklungen (Panzer und Flugzeuge) im kommunistischen Russland. In Rapallo wurde eine von den Westmächten beargwöhnte „Partnerschaft“ zwischen beiden devisenschwachen Ländern besiegelt, deren
Handel daraufhin florierte. Auch die über 300 000 russischen Revolutionsflüchtlinge in Berlin gehörten zu dieser „besonderen Beziehung“. Der Aufstieg Hitlers wurde in Moskau lange Zeit, auch noch
nach 1933, wenig beachtet. Mehr als eine Randerscheinung war der nahezu gleichzeitige Austritt Hitlerdeutschland aus dem Völkerbund mit dem Eintritt der UdSSR in diesen. Die Sowjetunion verließ damit
ihre Isolation in die sich Deutschland begab.
Ein weiterer Meilenstein dieser besonderen Beziehungen war der Pakt zwischen den beiden ideologisch so gegensätzlichen Diktaturen, den am Vorabend des
deutschen Überfalls auf Polen die Außenminister Ribbentrop und Molotow schlossen. Die erneute Aufteilung Polens, die Eingliederung der Region um Lemberg (Lwiw) und des Baltikums in die Sowjetunion
ordnete die ost-mitteleuropäischen Territorien vorübergehend neu. Der Warenaustausch zwischen der Sowjetunion und Hitlerdeutschland wuchs und strategisch wichtige Rohstoffe wurden noch am Tag vor dem
Überfall auf die Sowjetunion von dieser vertragstreu an den startbereiten Angreifer geliefert. Dieser brutalste Krieg kostete über 26 Millionen Sowjetbürgern, Soldaten wie Zivilisten, das Leben.
Diese Opfer und auch die der Deutschen beherrschten nach dem Sieg über Hitlerdeutschland lange Zeit das Verhältnis zwischen der UdSSR und den entstandenen beiden deutschen Staaten. Die weiteren
Stationen markiert der Autor an der Moskaureise Adenauers und Jahre später Willy Brandts. Der spätere Rüstungswettlauf, der Wechsel zu Gorbatschow und die deutsche Einigung, Kohl und Breschnew und
bilden den zeitgeschichtlichen Teil der Darstellung. Putin schließlich attestiert der Autor Aggressivität nach innen und außen. Dessen Ukrainepolitik beurteilt er so, dass der gegenwärtige Krieg
nicht mehr überraschen kann.
Creuzberger gelingt es, das Besondere des Verhältnisses zwischen Deutschland und Russland zu beschreiben, ohne es auf eine „endgültige“ Formel zu verengen. Die Fakten dieses Jahrhunderts sind zu
komplex, teilweise widersprüchlich und was die Opferzahlen betrifft so ungeheuerlich, die immer wieder erfolgreich unternommenen Schritte zur Verständigung und zum Verstehen so vielfältig, die
handelnden Personen so unterschiedlich, dass ein alles zusammenfassender Begriff dafür falsch wäre. Trotzdem ist das, was gewesen ist und gegenwärtig geschieht Bestandteil einer Wirklichkeit, die
auch in Zukunft weiterwirken wird. Deshalb ist ihre Kenntnis unabdingbar. Immerhin kann man so viel aus dieser besonderen Beziehung entnehmen: Gute Wirtschaftsbeziehungen sind manchmal
Voraussetzungen für gute politische Beziehungen, oft ist es aber umgekehrt, sind es die politischen Verhältnisse, die die Wirtschaftsbeziehungen prägen.
Harald Loch
Stefan Creuzberger: Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung
Rowohlt, Hamburg 2022 670 Seiten zahlr. Abb. 36 Euro
Michael Wildt: Zerborstene Zeit – Deutsche Geschichte 1918 – 1945
Von den „Kommandohöhen der Politik“ betrachtet, ist die Deutsche Zeitgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts allen Interessierten geläufig. Es handelt sich wohl um die am Gründlichsten erforschte Epoche der Geschichtsschreibung über Deutschland. Michael Wildt, Professor für Zeitgeschichte an der Berliner Humboldt Universität, zieht in seine in zwölf Kapitel unterteilte Darstellung der Jahre 1918 – 1945 unter diesen „Kommandohöhen“ einen zweiten Strang durch die Jahre: Seine Protagonisten heißen Luise Solmitz, Joseph Matthias Mehs, Hersch Lauterpacht, oder Raphael Lemkin, der nach seiner Flucht in seinem Buch „The Axis Rule in Occupied Europe“ für den Völkermord das Wort „Genozid“ prägte. Daneben nutzt er bekannte Quellen wie die Aufzeichnungen von Victor Klemperer oder Samuel Beckett um Zeitgeschichte von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen erleben zu lassen. Neben den geradezu „klassischen“ Passagen seiner Darstellung, rücken dadurch persönliche Wahrnehmungen, Irrtümer, Erlebnisse gleichberechtigt in seine Historiographie, die auch für das „Große Ganze“ der Geschichte Erkenntnisse bereithält und auf den Punkt bringt: „Vielleicht ließe sich die soziale und politische Ordnung, die 1933 geschaffen wurde, am treffendsten als rassistische Volksdiktatur bezeichnen.“ Er gelangt zu dieser von ihm geprägten Charakterisierung der Hitlerzeit nicht nur auf Grund der Maßnahmen der Regierung, der Verwaltung, des Gewaltapparats und der NSDAP, sondern und vor allem auch, weil er den von ihm gesammelten und zitierten O-Tönen genau zuhört. Da sprechen Menschen, die keine Entscheidungsträger waren und doch entscheidend für Wildts Fazit.
Er beschreibt zuvor die Gründungsphase der Weimarer Republik, die Konkurrenz der Parteien auf der linken Seite des Spektrums, die Entwicklung von Rassismus und Antisemitismus. Ein ganzes Kapitel
widmet er Josephine Bakers Gastspielen in Berlin oder auch das von Charlie Chaplin. Ein Glanzstück ist seine Darstellung der Konferenz von Locarno im Oktober 1925. Er widmet seine Aufmerksamkeit
nicht nur den „großen“ Ergebnissen, wie der Vereinbarung, dass Deutschland dem Völkerbund beitreten werde, sondern auch den verhandelnden Personen, ihren Zweiergesprächen, ihren Besonderheiten bis
hin zu der Frage, wer die kleine Zeche in dem Café bezahlte, in dem sich der französische und der deutsche Außenminister Briand und Stresemann für eine Stunde zu zweit trafen. Das ist nicht die vom
„Spiegel“, entwickelte Methode, das Dabeisein des Reporters zu suggerieren, sondern Wildt beglaubigt auf diese Weise das zwischen den Kriegsgegnern gewonnene neue Vertrauen, die notwendige
persönliche Vertrautheit. Die beiden Caféhaus-Besucher erhielten im darauffolgenden Jahr den Friedensnobelpreis. Keine zehn Jahre später wird Hitler den Völkerbund bereits wieder verlassen haben. Das
Tempo dieser Entwicklung rechtfertigt den Titel des beeindruckenden Buches „Zerborstene Zeit“.
Nicht weit von Locarno, auf dem französischen Ufer des Genfer Sees, in Evian-les-Bains fand im Juli 1938 eine vom US- Präsidenten Roosevelt initiierte Konferenz mit dem Ziel statt, eine Vereinbarung
über die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus dem inzwischen durch den „Anschluss“ Österreichs erweiterten Deutschen Reich zu treffen. Wir wissen, dass die Konferenz scheiterte. Wildt zitiert aus den
Protokollen die einwanderungsfeindlichen, z.T. sogar antisemitischen Begründungen der Delegierten. Der australische Minister T.W. White sagte z.B.: „Da wir in Australien kein Rassenproblem haben,
wird jedermann Verständnis dafür aufbringen, dass wir uns nicht danach drängen, eins zu importieren, indem wir irgendeinen Plan für eine fremde Einwanderung unterstützen.“ Für hämischen Beifall aus
Berlin war gesorgt.
Michel Wildts „Zerborstene Zeit“ enthält die ganze politische Geschichte Deutschland von 1918 bis 1945 und das Buch enthält mit gleichem Gewicht Längsschnitte über lange Lebensläufe wie den von Luise
Solmitz, einer begeisterten Hamburger Nationalistin, Hitler-Fan und Ehefrau eines nach „Nürnberger“ Definition jüdischen Deutschnationalen. Oder die über Jahrzehnte laufenden Tagebucheintragungen des
gläubigen Katholiken, örtlichen Zentrumspolitikers Joseph Matthias Mehs aus Wittlich, eines unbeirrten Hitlergegners; aber auch er sah eine „bolschewistische Gefahr“. Die von den Nazis beschworene
„Volksgemeinschaft“ war sich einig in Antikommunismus und Antisemitismus, in Nationalismus, Heldenkult und lange Zeit in Verklärung Hitlers. Sie war eine „rassistische Volksdiktatur“. Allein für
diese neue, treffende Bezeichnung der Nazizeit, aber auch für das ganze Werk Zerborstene Zeit verdient der Autor hohe Anerkennung.
Harald Loch
Michael Wildt: Zerborstene Zeit – Deutsche Geschichte 1918 – 1945
C.H.Beck, München 2022 638 Seiten 32 Euro
Thomas Alexander Szlezák: Platon – Meisterdenker der Antike
Besteht die philosophische Tradition Europas nur aus einer „Reihe von Fußnoten zu Platon“? Diese Behauptung stellte der englische Mathematiker und spätere Harvard-Professor für Philosophie Alfred
North Whitehead vor über sechzig Jahren auf. Mehrfach zitiert ihn der Tübinger Altphilologe und Philosophieprofessor Thomas Alexander Szlezák in seinem großartigen und streitbaren Werk „Platon –
Meisterdenker der Antike“. In diesem mustergültig edierten und durch mehrere Register bestens erschlossenen Buch geht es um den „ganzen“ Platon, also sein Leben und seine aristokratische Herkunft. Er
deutet seine homoerotische Neigung an und beschreibt Platons Denken und Schreiben, die Überlieferung seines mündlichen Wirkens in der von ihm gegründeten Akademie.
Szlezák weitet den Blick über die für manche Platon-Interpreten ausschließlich als authentisch gewerteten Dialoge hinaus. Die sind seit 200 Jahren zu „klassischen Bestsellern“ geworden, wohl auch, weil ihr „Gesprächsführer“ kein Geringerer als der von einem Athener Gericht zum Tode verurteilte Sokrates war, Platons wichtigster Lehrer. Das alles bewältigt der Autor mit philologischer Genauigkeit, die nicht nur den Wortlaut, sondern auch den jeweiligen Textzusammenhang würdigt, sowie mit einer an Platon angelehnten „dialektischen“ philosophischen Gedankenfolge. Damit überzeugt er seine Leser und vielleicht auch die Vertreter von Gegenpositionen. Bleibt ein gedanklicher Rest, kann er mit Platon charmant auf die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens verweisen. Das Buch wendet sich nicht nur an Spezialisten und transkribiert die zahlreichen griechischen Zitate in lateinische Schrift. Es fordert mit seiner streng wissenschaftlichen Methode vom Leser – wie Platon von seinen Akademie-Schülern – eine fortwährende gedankliche Mitarbeit. Die wird durch seine literarisch anspruchsvolle Darstellung erleichtert, die vielleicht nicht ganz die von Szlezák bewunderte, glanzvolle und abwechslungsreiche Stilistik Platons erreicht.
Überraschend für die an der „romantischen“ Platon-Rezeption geschulten Leser weist der Autor anhand des in seiner Echtheit umstrittenen „Siebten Briefes“ nach, dass Platon in seinen schriftlichen
Darlegungen nicht seine „letzte Erkenntnis“ publiziert hat, um sie nicht der ungebildeten Diskussion auszusetzen. Die Prinzipien seiner Philosophie hat er nach Ansicht Szlezáks lediglich in
Gesprächen mit philosophisch, vor allem auch mathematisch vorbereiteten Schülern seiner Akademie dargelegt. In den Dialogen habe er vor der Erkenntnisschwelle seinen Gedankengang oft abgebrochen.
Über die „ungeschriebenen“ Gedanken Platons wissen wir von einigen seiner Schüler, deren berühmtester und auch kritischster Aristoteles war. Aus diesen Quellen erschließt der Autor nach der aus den
Dialogen ableitbare Ideenwelt die „Grundzüge der Prinzipientheorie“ Platons und spart auch nicht mit Kritik an Ungereimtheiten darin. In diesem Zusammenhang diskutiert er die Frage, ob sie
dualistisch oder monistisch zu verstehen ist. Zwar überhöhe Platon „das Gute“ als Ursache von allem Richtigen und Schönen der Welt – es stamme von Gott – aber es geben auch „das Schlechte“, für das
man andere Ursachen als Gott suchen müsse. Welche?
Szlezák behandelt systematisch das schriftliche Werk Platons, seine Formenvielfalt, die Chronologie und entwickelt dann das „Denken Platons“: Seinen Begriff der Philosophie, seine Anthropologie und
Ethik, die Philosophie der staatlichen Gemeinschaft und die Kosmologie bis zu den Mythen, die Religion, die Götter und Gott. An verschiedenen Stellen warnt er davor, Platon mit „modernen“ Maßstäben
zu messen, z.B. wenn er von der Ironie Platons spricht. Anderswo verweist er auf heute: „Die Frage nach den letzten Prinzipien aller Dinge mag in post-metaphysischer Zeit als obsolet gelten, doch die
ursprüngliche vorsokratische Frageweise lebt fort in der Suche der theoretischen Physik nach einer vollständigen vereinheitlichenden Theorie, die es ermöglichen würde, die bisher nicht zum Einklang
untereinander gebrachten Theorien der Physik aus einer einheitlichen Konzeption zu denken“. Szlezák verweist hierfür in einer seiner insgesamt 1149 Fußnoten auf Stephen Hawking. So führen
vielgeschmähte Fußnoten einerseits mit Whitehead auf Platon zurück und andererseits bei der Beschäftigung mit ihm in eine noch zu erschließende Zukunft.
Harald Loch
Thomas Alexander Szlezák: Platon – Meisterdenker der Antike
C.H.Beck, München 2021 779 Seiten 38 Euro
Ein Nazi auf der Flucht
70 Jahre nach seinem Tod stellte eine Enkelin auf ihre Social-Media Seite die Worte: „Mein Großvater war ein Massenmörder.“ Von diesem Großvater handelt ein außergewöhnliches Buch des englischen Völkerrechtsjuristen Philippe Sands mit dem Titel „Die Rattenlinie“. Es handelt von Dr. Otto Wächter. Der war hoher SS-Offizier in leitender Position in Krakau und Lemberg (heute Lwiw) und als die Lager im Osten längst befreit waren, von Himmler hochdekoriert und befördert, nach Italien versetzt, um dort die Reste des ehemals verbündeten Landes zu stabilisieren.
Der 1901 geborene Wächter war mit der sieben Jahre jüngeren Charlotte, geb. Bleckmann verheiratet. Sie hatten zusammen sechs Kinder, die ihren Eltern insgesamt 23 Enkelkinder schenkten, von denen eine einzige die Wahrheit nicht leugnete: Magdalena.
Sands hatte bei seinen Recherchen zu seinem preisgekrönten Buch „Rückkehr nach Lemberg“ den Sohn des Generalgouverneurs in Polen Hans Frank, Niklas, kennengelernt. Hans Frank war der direkte Vorgesetzte Wächters. Er wurde in Nürnberg zum Tode verurteilt und 1946 hingerichtet. Niklas stellte die Verbindung für Sands zu dessen Sohn Horst Wächter her, mit dem zusammen sich der Autor auf die Suche nach der Wahrheit machte. Horst ist 1939 geboren. Sein Pate war Arthur Seyß-Inquart, zunächst der Stellvertreter von Hans Frank im „Generalgouvernement“, dann von 1940-1945 Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete. Auch er wurde vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zum Tode verurteilt und 1946 hingerichtet. Hans Frank, Arthur Seyß-Inquart und Dr. Otto Wächter waren Juristen, Hans Frank als „Reichsrechtsführer“ höchster Jurist im „Dritten Reich“.
Das Buch „Die Rattenlinie“ ist geprägt von zahlreichen Gesprächen des Autors mit Horst Wächter, der dabei sehr offen mitarbeitete und die vollständige Korrespondenz seiner Eltern zur Verfügung stellte.
Dass beide glühende Nazis waren, leugnete der Sohn nicht. Aber er bestritt, dass sein Vater Verbrechen in Polen begangen hatte. Er sei der Leiter der SS-Zivilverwaltung in Krakau und Lemberg gewesen. Die Verbrechen hätte der militärische Zweig der SS begangen. Im Buch geht es um markante Stationen im Leben des Otto Wächter, immer anhand von Dokumenten bzw. privaten Aufzeichnungen und Briefen. Die Wächters waren Österreicher, aber schon lange vor dem „Anschluss“ Nationalsozialisten. Zum Ende des Krieges bekam es Otto Wächter mit der Angst vor der Justiz der Siegermächte und auch Polens zu tun, tauchte unter und machte sich auf abenteuerlichen Wegen über die Alpen nach Rom auf, um von dort einen Weg nach Argentinien zu suchen. Das war der Geheimtipp vieler belasteter Nazis. Der als „Rattenlinie“ bekannt gewordene Fluchtweg nach Südamerika wurde von hohen Geistlichen des Vatikans geebnet. Auf ihm gelangten u.a. Erich Priebke (SS-Offizier in Rom) und Franz Stangl (Kommandant von Treblinka), Eichmann und der der KZ-Arzt Mengele nach Südamerika. Otto Wächter hat diesen Weg nicht geschafft – er starb 1949 in einem römischen Krankenhaus. Ob er dort ermordet wurde?
Die bewundernswerten Recherchen von Sands brachten skandalöse Wahrheiten zu Tage. Vor allem: Der US-Geheimdienst wusste vom ersten Tag des Aufenthalts in Rom von Wächters Anwesenheit. Der geistliche Cheforganisator des Rattenlinie war der aus Österreich stammende Bischof Alois Hudal im Vatikan stand auf der Gehaltsliste des CIC. Sein direkter „Vorgesetzter“ war ein von den Amerikanern umgedrehter hoher SS-Offizier. Schließlich ermittelte Sands in einer bewundernswerten internationalen Recherche, dass zwischen dem Leiter des US-Geheimdienstes in Italien und dem dann umgedrehten SS-Offizier verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. Das alles liest sich wie ein Thriller, ist aber ein hochseriöses zeitgeschichtliches Sachbuch, spannend und erschütternd von der ersten bis zur letzten Zeile.
Harald Loch
Philippe Sands: Die Rattenlinie. Ein Nazi auf der Flucht
Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit
Aus dem Englischen von Thomas Bertram
S. Fischer, Frankfurt am Main 2020 544 Seiten 25 Euro
Deutsche Vergangenheit
Die Reaktion der Zuhörer in Glasgow ist nicht bekannt. An der dortigen Universität hielt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert vor einem Jahr einen Vortrag unter dem Titel „Final solution. New answers to old questions“. Dieser bisher unveröffentlichte Vortrag ist jetzt in dem weitere zehn Texte des Autors enthaltenden Sammelband „Wer waren die Nationalsozialisten?“ erstmals zu lesen. Auf gut 20 Seiten zeichnet Herbert den „Weg zur Ermordung der europäischen Juden“ nach – das erschütternde Kernstück der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts. Dieser Vortrag gehört in einem Sonderdruck der Bundeszentrale für politische Bildung auf den Tisch eines jeden Schülers und auch eines jeden Einwanderers.
Er enthält das, was jedem Deutschen bewusst sein muss: Das Leid von Millionen, ihre brutale Ermordung in konsequenter Umsetzung der Rassenideologie der Nationalsozialisten. Wer waren sie, wer waren die Täter? – damit beschäftigen sich, exemplarisch und auch zusammenfassend, andere Artikel des für das Verständnis der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts unentbehrlichen Buches:
„Die NSDAP-Mitglieder waren weit überwiegend männlich und rekrutierten sich in deutlich überrepräsentativem Maße aus der „Kriegsjugendgeneration“ der zwischen 1900 und 1915 Geborenen. … Insgesamt war der Prozentsatz der Arbeiter bei den Parteimitgliedern deutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung. Angestellte und Beamte hingegen stießen in den dreißiger Jahren geradezu in hellen Scharen zur Partei. Die NSDAP-Mitglieder kamen eher aus Kleinstädten als aus den urbanen Zentren, sie waren eher protestantisch als katholisch, und in den Zentren der sozialistischen Arbeiterbewegung war ihre Zahl besonders niedrig.“ Soweit gibt Herbert den in den letzten Jahrzehnten erarbeiteten Forschungsstand wieder. Einzelne biographische Skizzen von Funktionsträgern oder Hochschullehrern führen bis in das – als ob nichts gewesen wäre – bequeme Leben vieler schwer Belasteter in der Bundesrepublik.
Mit den „Nachklängen der Volksgemeinschaft“ in diesem westdeutschen Nachfolgestaat beschäftigt sich ein weiterer Text des Bandes, der hervorragende Beiträge des Autors enthält, die bislang nur an abgelegener Stelle publiziert worden waren. Besonders lesenswert ist der Artikel „Nationalsozialistische und stalinistische Herrschaft“, in dem Herbert zwar auf eine Reihe von parallelen Erscheinungen der beiden Terrorregime hinweist, bei vertiefender Untersuchung aber den Sinn von derartigen „Vergleichen“ bezweifelt. Er arbeitet vor allem die Unterschiede in der administrativen Staatsorganisation in beiden Herrschaftsformen heraus: in Nazideutschland funktionierte der terrorisierende Staat bis in die letzten Tage vor der endgültigen Niederlage, in der Sowjetunion konnte von einer solchen inneren Struktur des Staates nicht die Rede sein. Nicht das systematische Ermorden, sondern Willkür bestimmten dort den Terror.
Vor allem: In Nazideutschland ging der Terror von der Mehrheit gegenüber einer oder mehreren Minderheiten aus, in der UdSSR terrorisierte dagegen eine Minderheit die große Mehrheit der Bevölkerung. Da sollte sich im Stalinismus erst im „Großen Vaterländischen Krieg“ ändern.
In dem detailreichen Text „Barbarossa“ untersucht Herbert die strategischen Planungen und politischen Vorentscheidungen für den Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion. Er klagt die Mordtaten
gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung an. Ein weiterer Text befasst sich mit den Widersprüchen zwischen dem deutschen Nationalismus und den unausgegorenen Ideen von einem
„Deutschen Europa“.
Überall spielen die rassistischen, vor allem die antisemitischen Grundannahmen des Nationalsozialismus die entscheidende Rolle. Für das „demokratische Wunder“ der Bundesrepublik entwickelt Herbert nachdenklich stimmende Gedanken. Das ganze Buch bereichert die unüberschaubar gewordene Literatur über den Nationalsozialismus in klugen Einzelbeiträgen, die das Entsetzen für immer wachrütteln und – unausgesprochen – die Verantwortung der Gegenwart aufrufen.
Harald Loch
Ulrich Herbert: Wer waren die Nationalsozialisten?
C.H.Beck, München 2021 303 Seiten 24 Euro
Die Hohenzollern und das Dritte Reich
Die „Schlafwandler“ sind seit Christopher Clarks umstrittenem Bestseller über die Frage der Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein geflügeltes Wort. Vor allem hat Clark damit dem deutschen
Kaiser Wilhelm II. den Persilschein ausgestellt, der ihm und seinem Deutschen Reich seit Versailles fehlte. Ohne das beabsichtigt zu haben, hat Clark damit auch die Leugnung der Realität der
Nachfahren dieses Kaisers genau beschrieben, die gegenüber der Bundesrepublik und dem Land Brandenburg erhebliche Eigentumsansprüche geltend machen. Diese Ansprüche sind Gegenstand von Verfahren vor
den höchsten deutschen Gerichten. Kern der Auseinandersetzung ist die Vorschrift in dem Entschädigungsgesetz von 1994, in dem es heißt, dass Restitutionsansprüche nicht bestehen, wenn der Erblasser
bzw. seine Rechtsnachfolger dem nationalsozialistischen Regime „erheblichen Vorschub“ geleistet haben.
Zu dieser Frage haben sich jetzt drei niederländische Autoren zu Wort gemeldet. Kaiser Wilhelm II. hatte nach seiner Abdankung und dem Thronverzicht auch seines Sohnes Wilhelm von seinem belgischen
Hauptquartier in Spa aus in den Niederlanden politisches Asyl beantragt und nach Monaten auch gewährt bekommen. Er kaufte aus Mitteln, die ihm der republikanische preußische Teilstaat der Weimarer
Republik zur Verfügung gestellt hatte, ein Schloss in Doorn, wo er 1941 verstarb. Dieses Schloss wurde von den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg als Feindvermögen enteignet und beherbergt heute
das Museum „Huis Doorn“, aus dessen Umfeld und der Universität Utrecht die Autoren stammen. Sie berichten von den frühen Versuchen des Ex-Kronprinzen Wilhelm und seiner Nachkommen, das Schloss
zurückzuerlangen – vergeblich. Alle Versuche der „Entfeindung“ scheiterten an eindeutigen historischen Befunden.
Zu der Frage, die die deutschen Gerichte beschäftigen, ob also die Hohenzollern dem Nationalsozialismus „erheblich Vorschub“ geleistet hätten, zitieren die Autoren zunächst aus vier Gutachten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Am deutlichsten gegen die Behauptung des Vorschubleistens positionierte sich der Schöpfer der „Schlafwandler“-Theorie, Christopher Clark. In einem späteren Zeitungsinterview bezeichnete er Wilhelm II. und wohl auch seinen Sohn als „Flaschen“, die gar nicht in der Lage gewesen seien, dem Nationalsozialismus Vorschub zu leisten. Als ob nicht auch „Flaschen“ Schlafwandler sein könnten und als ob nicht auch Tausende, wenn nicht Millionen anderer „Flaschen“ dem Nationalsozialismus Vorschub hätten leisten können, ja ihn ermöglicht und getragen hätten.
Die Autoren gehen dann die Generationenfolge durch: Ex-Kronprinz Wilhelm (1882 – 1951), dessen Bruder August Wilhelm (2887 – 1949) und dessen zweiter Sohn Prinz Louis-Ferdinand (Vater, 1907-1994)
waren sämtlich nicht nur in allen rechtskonservativen Kreisen aktiv, sondern traten teilweise mit Hakenkreuzbinde und in SA-Uniformen während der Nazizeit auf, hielten Propagandareden, beteiligten
sich an antisemitsciher Hetze. Sie verschafften den Nazis vor deren Machtübernahme den Seriositätsbonus, den sie wegen ihrer Vulgarität in den rechtsbürgerlichen und radikalkonservativen Kreisen
nicht hatten. Am „Tag von Potsdam“, der sichtbaren Vereinigung von „alter“ und „neuer“ Rechten, also zwischen Hindenburg und Hitler, nahm der Ex-Kronprinz eine prominente und für alle augenfällige
Rolle wahr.
Die Geschichte ist insoweit bekannt. Die niederländischen Autoren überlassen dem Leser und wohl auch den Gerichten die Entscheidung, ob die Hohenzollern dem Nationalsozialismus „erheblich Vorschub“
geleistet haben. Viele der entlarvenden Fotos, die dem dünnen Band beigegeben sind, sprechen hierzu eine deutliche Sprache. Der 1976 geborene Ururenkel des von mehr als hundert Jahren abgedankten
Kaisers, Georg Friedrich Prinz von Preußen – so sein bürgerlicher Name – tritt in die Fußtapfen des Ahnherrn in seiner offenbar ererbten Eigenschaft als Schlafwandler, wenn der die
Restitutionsansprüche gerichtlich durchsetzen möchte und die offensichtlichen historischen Tatsachen nicht wahrhaben will.
Harald Loch
Jacco Pekelder, Jeep Schenk und Cornelius van der Bas:
Der Kaiser und das „Dritte Reich“.
Die Hohenzollern zwischen Restauration und Nationalsozialismus
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse
Wallstein Verlag, Göttingen 2021 136 Seiten 61 Abb. 22 Euro
Luxus für alle: Die Pariser Kommune
Sie hätte sich den Namen schützen und ihre Ideen patentieren lassen sollen, die Pariser Kommune. Dann wären uns später die Plagiate von Langhans & Co. erspart geblieben. Mit dem, was sich in
Paris vom 18. März 1871 für gut zwei Monate abspielte, hatte das nichts zu tun. Die Pariser Kommune war das größere Schreckgespenst für die bürgerliche Gesellschaft der gerade auf den Trümmern des
von den „Preußen“ besiegten Kaiserreiches errichteten – nach der französischen Zählung – „Dritten“ Republik. Frankreich war von den deutschen Truppen schon fast besiegt, ein Vorfriede mit dem
zwei Monate zuvor in Versailles gegründeten Deutschen Kaiserreich geschlossen worden.
Arbeiter, Künstler und Teile der Garde républicaine ergriffen die Macht in Paris, besetzten das Rathaus und begannen, sich gegen die Regierungstruppen der Dritten Republik zu verteidigen. Das gelang dieser als Commune de Paris in die Geschichte eingegangenen anarchistischen Revolution auch bis zur „Blutwoche“ im Mai 1871, als die Armee Paris stürmte. Die Kommunarden wurden zu Zehntausenden hingerichtet. Die letzten aktiven 147 Kommunarden wurden am 28. Mai 1871 an der Mur des Fédérés auf dem Friedhof Père Lachaise erschossen.
Die 1953 geborene amerikanische Romanistin Kristin Ross, Professorin für Komparatistik an der New York University, hat in einem glänzenden Großessay die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune
dargestellt. Der Titel "Luxus für alle" erinnert an Henrich Heines Wort "Zuckererbsen für jedermann". Voller Empathie mit dieser damals neuartigen und wie heute utopisch erscheinenden Welt eines
politischen Aufbruchs reißt sie ihr Publikum mit. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit geht sie einzelne Politikfelder durch und vermittelt die Aktualität der damals in Paris diskutierten Fragen und
ihrer gelebten Wirklichkeit: Abschaffung der Nationalstaaten und Leben in einer Weltrepublik, Freiheit von Staat und Bürokratie, Solidarität ohne Zwang, die Gleichberechtigung von körperlicher und
geistiger Arbeit, eine von Galerien unabhängige Freiheit der Kunst, Abschaffung des Kapitalismus, Kindergärten für alle, Gleichberechtigung von Frauen auf allen Gebieten, Schutz der natürlichen
Umwelt, freie Assoziation als Grundbaustein einer Gesellschaft – es muss ein Laboratorium für Ideen gewesen sein, das einen Vorrat für Jahrhunderte entwickelte. Die Autorin nennt etliche der
Kommunarden mit Namen, die, sofern sie sich durch Flucht in die Schweiz oder nach England haben retten können, später ihre Erinnerungen aufschrieben und die Ideen weiterentwickelten. Sie zieht
Gedankenfäden zum Spätwerk von Karl Marx, zu den Anarchisten Kropotkin und Bakunin, zu den ökologischen Geographen William Morris oder Élisée Reclus.
Kristin Ross sieht in der Pariser Kommune so etwas wie eine Parabel für die Welt. Auch ihr Essay entspricht dieser literarischen Figur und der Leser ist aufgefordert, sich aus dem Geschriebenen das von der Autorin Gemeinte selbst zu erschließen.
Das Entscheidende an der gedanklichen Fruchtbarkeit der Pariser Kommune lag – folgt man der Autorin – in der unmittelbaren massenhaften Umsetzung des Gedachten und in der Entwicklung weiterführender
Gedanken aus den Erfahrungen der Handlungen. Eine erste und kennzeichnende Handlung der Kommune war die Zerstörung der in der Französischen Revolution in Hochbetrieb wütenden Guillotine. Damit
wollten die Kommunarden 1871 nichts zu tun haben, sie hielten die Revolution von 1789 für „bürgerlich“ und hatten angesichts des seinerzeit nach Machtteilhabe drängenden „dritten“, also bürgerlichen
Standes auch Recht damit. Die demonstrative Zerstörung der Guillotine durch die Kommune steht in unerträglichem Gegensatz zum Massaker an den Kommunarden durch die Armee der Dritten Republik. Zehn
Jahre später amnestierte sie die Geflüchteten.
Harald Loch
Kristin Ross:
„Luxus für alle. Die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune“
Aus dem Englischen von Felix Kurz
Matthes & Seitz, Berlin 2021 207 Seiten 20 Euro
Wie wir wurden, was wir sind
Heinrich August Winkler, der Geschichtsphilosoph, Politikwissenschaftler und Professor für Neuere Geschichte, kann beides: kurz und lang. Dicke Wälzer sind die Normalmaße für historische Werke, erst recht, wenn sie beim Deutschen Reich und Bismarck beginnen und bei Corona enden.
Man glaubt es erst nicht, dem Historiker Winkler gelingt es jedoch, die gesamte neuere Geschichte auf 250 Seiten derart dicht und kompakt klar und verständlich darzustellen, dass man zu dem Ergebnis kommt, dieses Buch gehört als Lektüre in jede Unterrichtseinheit.
Das Buch hat Tiefenwirkung und zugleich breite Weltenansicht, und doch ist es knapp gefasst, deutlich formuliert und voller einzelner Weisheiten, zum Beispiel der folgenden:
„Herrschen heißt Macht üben, und Macht üben kann nur der, welcher Macht besitzt. Dieser unmittelbare Zusammenhang von Macht und Herrschaft bildet die Grundwahrheit aller Politik und den Schlüssel der ganzen Geschichte.“
Winkler wagt einen Parforceritt durch die deutsche Geschichte in Kapiteln, die sich mit folgenden Themen beschäftigen: Das Reich der Deutschen und der Westen, Einheit vor Freiheit, Eine vorbelastete
Republik, Die deutsche Katastrophe, Freiheit vor Einheit, Ein postnationaler Sonderweg, Von der deutschen zur europäischen Frage, Eine neue deutsche Sendung, Die Gegenwart der deutschen Geschichte,
Im Zeichen von Corona. So lauten die Kapitelüberschriften.
Winkler analysiert den Untergang der Weimarer Republik, und es gelingt ihm, wie so oft, alles in einem Satz zu erfassen: „Wenn es eine Ursache ‚letzter Instanz‘ für den Zusammenbruch der ersten deutschen Republik gibt, war es die historische Verschleppung der Freiheitsfrage im Deutschland des 19. Jahrhunderts und die Geburt der Weimarer Demokratie aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg: Eine Geschichtslast, die sich im Zeichen der Weltwirtschaftskrise nach 1930 als zu schwer für die junge Republik erwies.“
Winkler, Analyst der Westorientierung, blickt auch in den Osten: „Der Antifaschismus wurde zur Gründungslegende der DDR. Er diente der Rechtfertigung der Errichtung einer neuen Diktatur, die sich als
die einzige wahrhaft demokratische Staatsform auf deutschem Boden und als die Garantie gegen einen Rückfall in die Barbarei ausgab.“ Oder: „In gewisser Weise trug die neue Ostpolitik sogar dazu bei,
die Bundesrepublik „westlicher“ zu machen.“
Winkler gelingt es immer wieder, länger wirkende Zusammenhänge, die dem Historischen ja eigen sind, in kurzen klaren Sätzen zu summieren, etwa so der Freiheit wurde der Vorrang vor der Einheit
eingeräumt oder „Die Bundesrepublik hatte ihr politisches Gewicht im Zuge der Ostverträge der sozialliberalen Koalition erheblich vergrößert. Seit dem September 1973 gehörten beide deutschen Staaten
den Vereinten Nationen an.“ Oder: „Die deutsche Schuld war nicht getilgt, wenn die deutsche Teilung überwunden wurde.“
Auch im aktuelleren Teil des Buches versteht es Winkler, Klarheit in die historischen Entwicklungen zu bringen, indem er zum Beispiel erläutert, wie in der Flüchtlingsfrage der deutsche Alleingang
die europäischen Staaten trennt und innenpolitisch die AfD auf den Plan ruft. Winkler kritisch: „Die Gefahr einer Spaltung der Europäischen Union aber wurde in Berlin beharrlich unterschätzt: ein
Sachverhalt, der sich nur aus einem Mangel an strategischem Denken in der Entscheidungszentrale erklären lässt.“
Auch der moralische Ton in der deutschen Politik missfällt dem Historiker: „Die Neigung, das eigene Tun moralisch zu überhöhen, wirkt sich auf das Verhältnis Deutschlands zu seinen europäischen und
atlantischen Partnern aus. Die Bundesrepublik agiert häufig viel nationaler, als es ihrem europäischen Solidaritätspathos und der Beschwörung ihrer Bündnistreue entspricht.“
Winkler stellt in Frage, ob der Westen noch eine Zukunft habe und kommentiert im Schlusskapitel sogar die Folgen der Coronakrise: „Zu einer neuen ‚Stunde Null‘ ist die Coronakrise nicht geworden. Wie
sie sich längerfristig auf das politische Bewusstsein der Deutschen auswirken wird, ist eine offene Frage. Zu hoffen ist, dass die Erschütterungen des Jahres 2020 einer der größten Errungenschaften
des letzten Dreivierteljahrhunderts, der Herausbildung einer selbstkritischen Geschichtskultur, keinen Abbruch tun werden. Sie gilt es weiterzuentwickeln. Denn zum Lernen aus der Geschichte gehört
auch die Bereitschaft, aus den bisherigen Lernprozessen zu lernen. Es ist eine Aufgabe, die sich jeder Generation neu stellt. Abgeschlossen ist sie nie.“
Ein Geschichtsbuch, das den Blick weitet, eine Geschichtslektion für uns alle.
Heinrich August Winkler, geb. 1938 in Königsberg, studierte Geschichte, Philosophie, Politische Wissenschaft und öffentliches Recht in Tübingen, Münster und
Heidelberg. 1968 und 1970/71 war er German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard Universität, Cambridge, MA (USA). Er habilitierte sich 1970 in Berlin an der Freien Universität und war zunächst
dort, danach von 1972 bis 1991 Professor in Freiburg. Seit 1991 war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2014 erhielt er den
Europapreis für politische Kultur der Hans Ringier Stiftung, 2016 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 2018 das Große Bundesverdienstkreuz.
Heinrich August Winkler Wie wir wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte der Deutschen C.H.Beck
Aus der Geschichte lernen?
Clio mahnt mit erhobenem Zeigefinger: Vergesst die Geschichte nicht! Die Muse der Historiographie ist hierzu in die Gestalt des stellvertretenden Direktors des Münchner Instituts für Zeitgeschichte geschlüpft: Magnus Brechtken erteilt in seinem schon jetzt als Pflichtlektüre allen Zweiflern empfohlenen Buch „Der Wert der Geschichte“ zehn Lektionen für die Gegenwart.
Es ist gar nicht einfach, einen Kardinalfehler in der Beachtung der Vergangenheit zu vermeiden. Sie wiederholt sich nämlich nicht. Allenfalls – wie es Karl Marx formulierte – das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal Farce. Brechtken stellt aber den Wert seiner Disziplin nicht unter den Scheffel, wenn er – durchaus auch er mit erhobenem Zeigefinger – mahnt, die Anstrengungen, Opfer und Irrtümer zu erinnern, die zu der heute für uns in der westlichen Welt ganz komfortablen Gegenwart geführt haben. Er stellt nämlich fest, dass viele Errungenschaften weithin nicht als solche wahrgenommen werden. Insofern ruft er mit der für einen deutschen Professor (Uni München) und institutionell verankerten Historiker erstaunlichen Leidenschaft dazu auf, den Wert der Geschichte und der Kämpfe der Vergangenheit zu erkennen.
In sechs Kapiteln rechnet er mit der Vergangenheit ab und zieht für die Gegenwart und auch für die Zukunft entsprechende Konsequenzen. Er beginnt mit „Göttergeschichten“ und führt vor Augen, welch
verheerende Auswirkungen die Verquickung von Religion und Politik, von Gottesglauben und Staat gehabt haben und in vielen Teilen der Welt noch haben. Dabei geht es um die Atmosphäre der Unfreiheit in
Mittelalter und Neuzeit, aber auch um islamische, hinduistische oder auch evangelikale Usurpationen politischer Macht. Die leidvollen und keineswegs beendeten Anstrengungen, die Menschenrechte auch
für Frauen zu erkämpfen und durchzusetzen, geben ein beschämendes Beispiel für die Diskrepanz zwischen den Menschenrechtserklärungen am Ende des 18. Jahrhundert in den USA und in Frankreich und der
fortdauernden Entmündigung der Frau auch in den der Aufklärung verpflichteten westlichen Gesellschaften. Die in kleinen Schritten erfolgte teilweise Verwirklichung der Gleichberechtigungsversprechen
der Weimarer Reichsverfassung und des Grundgesetzes führt Brechtken als Beispiel für die Mühen bei der Durchsetzung des für richtig Erkannten an.
Ähnlich geht es mit der Partizipation aller an den politischen Entscheidungen. Hier setzt sich Brechtken sehr vehement gegen populistische Volksabstimmungen am Beispiel des Brexits oder auch der
Wahlrechts-Ungerechtigkeiten in den USA und für die in der Bundesrepublik entwickelte Form der repräsentativen Demokratie ein. Sie und die Besinnung auf die naturrechtlich begründeten Allgemeinen
Menschenrecht seien eine Garantie gegen das Wiederaufkommen von Nationalismus. Er verkennt dabei nicht die Rückschritte, die inzwischen in Europa drohen und mahnt einen Blick in Geschichte an, in der
abzulesen ist, wohin das führt. Das gilt auch für die Frage nach Krieg und Frieden: Brechtken geht davon aus, dass in Demokratien die Verantwortlichkeiten bei den Repräsentanten des Volkes liegen und
deshalb keine Chance für Abenteurer bestehe. Er hält eine auch militärisch wehrhafte Demokratie angesichts der Geschichte des Kalten Krieges für erwiesenermaßen besser als den Pazifismus der
deutschen Friedensbewegung. Hier wird sich mancher Leser fragen, ob nicht auch die vielen Mitglieder dieser gegen den Rüstungswettlauf in Mitteleuropa angetretenen Friedensbewegung einen Blick in die
jüngere Geschichte mit entsprechenden Konsequenzen geworfen hatten.
Schließlich holt der Autor beim „Ringen um den fairen Markt“ zu einer vergleichenden Systemanalyse zwischen der Marktwirtschaft in demokratischen Staaten und der im kommunistischen China aus. Er
erteilt dem Neoliberalismus am Beispiel des Scheiterns von Margaret Thatcher in Großbritannien eine klare Absage, findet die Einkommens- und Vermögensunterschiede in marktwirtschaftlichen
Gesellschaften obszön. Er hält gleichwohl Marktwirtschaft und Wettbewerb die aus der Geschichte als alternativlos hervorgegangene Wirtschaftsform für unabdingbar. In ihr entwickelt er einen kühnen
Vorschlag für die Partizipation der Bevölkerung am Produktivvermögen, der entfernt an ähnliche Modelle von Piketti erinnert. Alles das kling bei Brechtken plausibel und durchdacht und aus der
Geschichte abgeleitet, damit sie nicht in eine Farce mündet.
Harald Loch
Magnus Brechtken:
Der Wert der Geschichte. Zehn Lektionen für die Gegenwart
Siedler, München 2020 303 Seiten 20 Euro
Magnus Brechtken, geboren 1964, wurde an der Universität Bonn im Fach Geschichte promoviert und lehrte an den Universitäten Bayreuth, München und Nottingham. Seit 2012 ist er stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte und Professor an der Universität München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der Nationalsozialismus, die Geschichte der internationalen Beziehungen und die historische Wirkung politischer Memoiren. 2017 erschien sein Buch »Albert Speer. Eine deutsche Karriere«, das mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis ausgezeichnet und zum Bestseller wurde.
Vertrauen - Wendezeit - Weltordnung
Unsere Zeit steht in den Sternen – Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ihr Ablauf ist gleichmäßig. Vier Jahre sind vier Jahre. Alle Ereignisse unserer Geschichte spielen sich zu einem bestimmbaren Zeitpunkt
oder in einem bestimmbaren Zeitraum ab. Es gibt aber Zeiten, in denen sich viel ereignet, die spannender sind als andere. Die 1973 in Düsseldorf geborene Historikerin Kristina Spohr hat einen dieser
besonders verdichteten Zeiträume für ihr monumentales Vier-Jahre-Buch und hierfür den Titel „Wendezeit“ gewählt. Es geht um die „Neuordnung der Welt“ in den Jahren 1989 – 1992. Der Untertitel weist
auf eine Beschreibung der globalen Ereignisse in dieser kurzen Epoche, nach der nichts mehr so war wie vorher.
Einige der Länder wie die Sowjetunion, Jugoslawien oder die Tschechoslowakei sind in diesem Zeitraum zerfallen, andere – Deutschland - haben sich vereinigt oder haben sich aus den Zerfallsprodukten neu definiert: die baltischen Länder, viele haben sich ihren Blöcken gelöst. Einige der Hauptakteure haben die Bühne verlassen müssen: Gorbatschow wurde nach einem Putsch von seinem Rivalen Jelzin verdrängt, George H.W. Bush wurde von den amerikanischen Wählern, Margaret Thatcher von ihrer eigenen Partei nach Hause geschickt. Am Anfang stand die Verheißung von Frieden und Freiheit. Doch es gab gegen den Irak und beim Zerfall Jugoslawiens blutige Kriege.
Bei der Loslösung von Litauen verriet Gorbatschow, in dem Somalischen Abenteuer verrieten die USA ihre hohen moralischen Ansprüche an die eigene Politik durch militärische Gewalt. In China begannen die vier Jahre mit dem Massaker auf dem Tiananmen und mündeten bei aller Unfreiheit in eine erfolgreiche Fortsetzung des Kapitalismus unter der Herrschaft seiner Kommunistischen Partei.
Wer das alles in den Blick nimmt, diese Zeit nicht nur als Nacherzählung des längst Bekannten rekapituliert und – wie es Kristina Spohr in ihrer Einleitung ankündigt – den Akteuren über die Schulter
blickt, kann sich leicht übernehmen. Die in Cambridge promovierte Autorin hat aber nicht nur über die Schultern von Staatsmännern geblickt, sondern genau in Archiven geforscht und andere Quellen
aufgeschlüsselt. Sie hat das alles zu einer großartigen Erzählung zusammengefügt, die das ganze Ausmaß der „Neuordnung der Welt“ erfasst. Sie beweist mit ihrem längst als Standardwerk anerkannten
Buch, dass Persönlichkeiten, früher sagte man „Männer“ Geschichte machen.
Genauer: Die weitreichende Neuordnung war nur durch die persönliche Beziehung dieser Staatsmänner zueinander möglich. Die Autorin beschreibt das persönliche Vertrauen als die Basis für eine solche turbulente, nur selten chaotische Neuordnung. Immer dort, wo das Vertrauen fehlte oder schwand, ging es nicht weiter. Kristina Spohr ist aber nicht blauäugig. Sie weist auf die „tiefen Taschen“ von Helmut Kohl und sein „Scheckbuch“ als Schmiermittel, sie beziffert die Dollar- oder D-Mark-Wünsche der zerfallenden Sowjetunion, der aus ihrem Imperium neu entstandenen Staaten oder auch der USA zur Verteilung der Kosten des Krieges gegen Saddam Hussein auf die Schultern vieler Freunde. Sie benennt das hohe Haushaltsdefizit der USA und die Rezession als Hauptgrund für die Abwahl Bushs und den Sieg Clintons: „It‘s the economy, stupid!“
Zwei Karten auf dem Vor- bzw. dem Nachsatz des Buches zeigen die Dimension der Neuordnung: Die eine zeigt die „feindlichen Blöcke“ im Kalten Krieg, die andere den „Beginn des Pazifischen
Jahrhunderts“, die Welt im Jahr 2017. Auf ihr sind die Staaten rot markiert, deren größter bzw. zweitgrößter Handelspartner China ist – es sind fast alle auf allen Kontinenten, auch Deutschland.
Natürlich ging die Geschichte nach 1992 weiter. Aber die heutige Welt ist ohne die von der Autorin so meisterhaft beschriebene Neuordnung nicht zu verstehen. Vertrauen und Scheckbuch sind auch heute
vonnöten, wenn Politik gestaltet werden soll. Das Original dieses hervorragenden Buches ist auf Englisch erschienen, es geht die ganze Welt an. Die treffende deutsche Übersetzung von Helmut Dierlamm
und Norbert Juraschitz beschert einen hohen Lesegenuss. Gutgewählte Anekdoten sorgen immer wieder für kurze Entspannung von dem faktengesättigten Stakkato der Ereignisse. Alles ist nach den Quellen
belegt und selbst manche Fußnote enthält interessante Details. Für diejenigen, die diese vier Jahre miterlebt haben, hilft dieses Buch der nachlassenden Erinnerung nach und wartet darüber hinaus mit
seinerzeit nicht wahrgenommenen Einzelheiten auf. Für die Nachgeborenen ist die „Wendezeit“ ein Schlüssel zum Verständnis unserer Zeit.
Harald Loch
Kristina Spohr: Wendezeit. Die Neuordnung der Welt nach 1989
Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm und Norbert Juraschitz
DVA, München 2019 976 Seiten 42 Euro
Matthias Weichelt: Der verschwundene Zeuge. Das kurze Leben des Felix Hartlaub
„Ausgerechnet Felix“, notiert sein Vater im November 1941. „Seine Aufgabe ist objektiv äußerst interessant und aufregend; man muss freilich lachen, wenn man dabei an ihn denkt, seine antimilitaristische, antinationalsozialistische Gesinnung, seine unheroische Haltung...“ Der Sohn ist Felix Hartlaub, promovierter junger Historiker, Gefreiter wie der „Führer“. Er soll einer vorbereitenden Materialsammlung für das Kriegstagebuch eben dieses „Führers“ zuarbeiten. Bald wurde er in die Abteilung Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht im Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ versetzt. Um das kurze Leben dieses Felix Hartlaub geht es in dem vorzüglichen Buch von Matthias Weichelt. Der 1971 geborene Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form und er geht Sinn und Form im Leben und in dem fragmentarischen Werk des in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs in Berlin verschollenen und zehn Jahre später für tot erklärten Felix Hartlaub nach. Der ist 1913 geboren, sein Vater war Direktor der Städtischen Kunsthalle in Mannheim. Felix entwickelt früh eine künstlerische Doppelbegabung als Zeichner und als sprachmächtiger Verfasser von tastenden, vorläufig bleibenden Texten.
Während sein Vater 1933 wegen „Kulturbolschewismus“ entlassen wird, tritt der Sohn im selben Jahr der „studentischen SA“ bei, aus der er später wieder austreten würde. Auf der Odenwaldschule hatte er das Abitur gemacht und Klaus Gysi kennengelernt, den späteren Minister für Kultur der DDR und Verleger des Aufbau Verlages. Dessen Mutter Erna, die als Jüdin 1938 noch nach Frankreich fliehen konnte, wurde in den Berliner Studienzeiten Hartlaubs Geliebte. In der „Villa Lessing“ am Berliner Schlachtensee lebten der Kommunist Klaus Gysi und Gabriele Lessing gleichsam öffentlich untergetaucht. Felix besuchte seine Freunde dort noch im April 1945. Der Biograph beschreibt die kaum überbrückbare Kluft zwischen SA sowie dem späteren Funktionieren im OKW-Kriegstagebuch und der nicht ungefährlichen Verbindung zum kommunistischen Widerstand nicht als mangelnde Entscheidungsfähigkeit, sondern eher als Ausdruck einer Weigerung, sich vereinnahmen zu lassen, unbestechlichen Blicks auf die verwirrende Realität. Weichelt belegt das mit teils wirklich kompromittierenden Stellen aus Hartlaubs Prosafragmenten oder seinen Briefen und andererseits mit hellsichtigen, systemkritischen Passagen. Aus all diesen sorgfältig und treffend ausgewählten Auszügen spricht eine geradezu überwältigende Formulierungskraft Hartlaubs. Matthias Weichelt behandelt Felix Hartlaub als frühverstorbenes literarisches Genie und weniger als politischen Irrläufer zwischen links und rechts.
Hartlaub promoviert in Berlin im Fach Geschichte mit einer Dissertation über die Seeschlacht bei Lepanto von 1571, in der die christlichen Mittelmeermächte die Flotte des Osmanischen Reiches zerstört hatte. Diese Qualifikation verschafft ihm eine Stellung im Auswärtigen Amt, bei der es um die Auswertung der Akten des französischen Außenministeriums geht, die nach der Niederlage Frankreichs von den deutschen Besatzern gleichsam geplündert werden. Auch aus dieser Zeit gibt es O-Töne Hartlaubs, die belegen, wie unwohl er sich bei dieser Tätigkeit fühlt. Später kommen die Versetzung - dann als Soldat – zum OKW, die ihn auf einen Arbeitsplatz im „Sperrkreis II“ der Wolfsschanze führt. Hier hört er am 20. Juli die Detonation von Stauffenbergs Bombe aus nächster Nähe. Weichelt erzählt das, was vom Leben des Felix Hartlaub bekannt und erwähnenswert ist, aber er lässt ihn oft genug selbst zu Worte kommen, um die große literarische Begabung und das Ringen des verhinderten Autors um Sinn und Form, um Ausdruck und Stil zu verdeutlichen. Das Buch hätte das Zeug zu einem dokumentarischen Entwicklungs- oder Künstlerroman, wenn nicht das Ende des „Dritten Reiches“ auch das vorzeitige Ende der vielversprechenden Entwicklung der Künstlers Felix Hartlaub bedeutet hätte.
Harald Loch
Matthias Weichelt:
Der verschwundene Zeuge. Das kurze Leben des Felix Hartlaub
Suhrkamp, Berlin 2020 232 Seiten 20 Euro
Das Geld der Dichter
„Reden wir über Geld“ ist eine beliebte Serie im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung. In Interviewform wird prominenten Zeitgenossen die Antwort abgetrotzt, wie viel sie womit verdienen, was
sie sparen, investieren oder raushauen. Über Geld und Einkommen zu reden, ist in Deutschland verpönt, Geld hat man oder eben nicht. Bei Partys oder am Arbeitsplatz oder sonst wo darüber zu reden ist
verpönt.
Alle amerikanischen Präsidenten legen nach Amtsantritt ihre Steuererklärung und damit die eigenen finanziellen Verhältnisse der Öffentlichkeit vor. Donald Trump tut das nicht. Ob Gerichte ihn nach
seiner Amtszeit dazu zwingen werden, bleibt vorerst offen.
Geheimnisumwittert ist also ebenso die Frage: Was können Schriftsteller mit dem Schreiben verdienen? Bringen Bücher Geld ein? Nagen Autoren am Hungertuch?
Schriftsteller oder Dichter zu sein ist kein Brotberuf. Irgendwie muss man auch noch andere Einnahmen daneben haben, um überleben zu können, heißt es immer schon und immer noch.
Die einen lassen sich als Minister zahlen, die anderen gehen sonstwie in den Staatsdienst, vielleicht als Lehrer, manche schreiben ein Leben lang am Existenzminimum entlang, und die Lebenskünstler
hinterlassen Schulden.
Erst recht im Dunkel der Vergangenheit liegend: DAS GELD DER DICHTER – in Goethezeit und Romantik. 71 biografische Skizzen über Einkommen und Auskommen - als Buch im Verlagshaus Römerweg erschienen -
lüftet jetzt manches Einkommensgeheimnis von Dichtern, Philosophen, Malern, Komponisten. Denn schon Goethe wusste: „Wer sich aufs Geld versteht, versteht sich auf die Zeit.“
Der Frankfurter Historiker Frank Berger hat in jahrelanger akribischer Forschungsarbeit aus Briefen, Tagebüchern und sonstigen Quellen destilliert, was Dichter verdient haben, wofür sie Geld
ausgaben, was sie erbten und vererbten. Eine finanzsoziologisch-literarische Studie, so detailreich unterfüttert, dass wir auch über die soziale Herkunft der Dichter etwas erfahren, wie die Lebens-
und Studienbedingungen waren, welche Berufsperpektiven sich ergaben, was das Leben insgesamt so kostete, wie der Umgang mit Geld war, welche Münzen es gab und welche Einkommensmöglichkeiten, was den
Geldwert ausmachte und die Durchschnittseinkommen, inklusive einem Kapitel über die Bewertungen der Münzen in Euro.
Historiker fremdeln mit der Thematik Numismatik. (Münzwissenschaft) Geldgeschichtliche Zusammenhänge sind im zersplitterten Noch-nicht-Deutschland unübersichtlich.
Es gab ja auch Sachleistungen wie freies Wohnen, Lieferung von Brennmaterialien, Zuteilung von Brotgetreide oder die Nutzung eines eigenen Gartens. Viele lebten am Rande des
Existenzminimums.
Einige Beispiele: Eichendorff, in der Jugendzeit und im Alter entbehrungsreich lebend, erreichte in seinen mittleren Jahren den Staatsdienst und damit bescheidenen Wohlstand.
Die „Wahlverwandtschaften“ Goethes erbrachten zum Beispiel 2500 Taler ein. Ein Sohn Herders hatte 3.000 Taler Spielschulden angehäuft. Herder selbst hinterließ 4.400 Taler Schulden, das entsprach
damals knapp drei Jahresgehältern. Kleist beging Selbstmord und hinterließ Bitt- und Bettelbriefe. Schiller reklamierte beim Verleger Cotta das Regelhonorar von 650 Talern und erhielt erhöhte 900
Taler, für den „Tell“ sogar 975.
Philosoph Hegel leistete sich alle paar Tage für 18 Groschen einige Flaschen Wein, teuren Cahors, Sauterne und Madeira. Trotz Bucherfolgen mit KOSMOS hinterließ Alexander von Humboldt 6.000 Taler
Schulden. Heine hatte 1.000 Franc monatliche Ausgaben. Maler Caspar David Friedrich musste den russischen Zaren um Finanzhilfe bitten. Beethoven war nicht groß vermögend, aber arm war er auch nicht.
Mozarts Spielleidenschaft häufte Verbindlichkeiten von 4050 Gulden an. Schuberts Freunde, die seine Lieder verbreiteten, finanzierten ihm damit Unterkunft, Schuster, Schneider, Besuche im Kaffeehaus
und in der Gaststube, während Paganini, der Zaubergeiger und „Konzertkosar“, 5 Gulden Eintritt für seine Konzerte verlangen durfte.
Am Schluss hier noch der Hinweis, die Nationalhymne, das Lied der Deutschen, brachte dem Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ein Honorar von umgerechnet 5.044 Euro ein.
Wenn Sie jetzt jeweils die Einnahmen und Ausgaben in Euro genannt haben wollen, vielleicht, weil sie auch der Mark nachtrauern. Dazu sind Extrakapitel vorhanden, kaufen Sie also das Buch für 20 Euro
und Sie werden Bescheid wissen.
Frank Berger studierte Geschichte und Germanistik. Er war im Kestner-Museum Hannover tätig und wurde 1992 an der Universität promoviert. Sein Forschungsgebiet umfasst römische, mittelalterliche und neuzeitliche Numismatik. Als Kurator im Historischen Museum Frankfurt ist er zuständig für das Münzkabinett, Waffen, Modelle, Dioramen und Technik.
https://www.mdr.de/video/mdr-videos/d/video-421454.html
Eine verspätete Reise nach Auschwitz
„Als ich 2015 Auschwitz besuchte, habe ich Menschen gesehen, die im Tor zur Hölle Selfies machten. Sie lächelten ungläubig: dass sie dort wirklich standen, unter dem morbiden Schriftzug ‚Arbeit
macht frei’.“ Daan Heerma van Voss’ Reise nach Auschwitz ist eine Ode an seinen Freund und Namenspaten Daan de Jong, dessen Eltern deportiert wurden. Das NRC Handelblad pries die Erzählung als einen
„intelligenten Essay von einem begnadeten jungen Autor, der Worte findet, um seine Gefühle am einsamsten Ort der Welt auszudrücken“. Heerma van Voss hat einen Text voller emotionaler Wucht
geschrieben, mit dem er uns allen die Frage stellt: Was heißt Gedenken heute? (Büchergilde Gutenberg)
mehr
Die doppelte Erinnerung könnte man als Stichwort dieser Rezension voranstellen, um das Buch EINE VERSPÄTETE REISE, erschienen in der Büchergilde Gutenberg, vorab einzuordnen. Der Freund des Autors,
Daan de Jong, ein Holocaustforscher, ist 2014 früh verstorben. Mit ihm gemeinsam wollte er einst Auschwitz besuchen, doch zu der Reise kam es nie. Erst zum 70 Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers macht sich Daan Heerma van Voss auf, die „verspätete Reise“ nachzuholen.
Zum 75. Jahrestag erscheint das Buch für uns als Deutsche als Erinnerungshinweis gegen „das Vergessen“, denn die Zeitzeugen sterben aus und die politische Unkultur der Bewegungen von rechts will
alles vergessen machen. Etwa bei Gauland von der AfD: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte."
In seinem Buch „Eine verspätete Reise“ besucht der niederländische Autor Daan Heerma van Voss das KZ Auschwitz. Es ist eine Reise, die er eigentlich mit dem zu früh verstorbenen Holocaust-Forscher,
seinem Freund Daan de Jong unternehmen wollte. Er ist sein Namenspate. Die Eltern dieses Freundes waren einst Opfer des Naziterrors und der deutschen Vernichtungsmaschine in Auschwitz
geworden.
Frieda Mulisch, die Tochter des renommierten Autors Harry Mulisch (Strafsache 40/61, Reportage über den Eichmann-Prozess), die sich für eine Literaturzeitschrift mit dem Autor van Voss treffen
möchte, spricht eine Interview-Einladung aus. Daan Heerma van Voss nimmt an. Benennt den Interview-Ort Auschwitz, verbunden mit der meteorologischen Erwartung, zu fahren „…nur wenn es
nieselt“.
Wie setzt man sich mit Auschwitz auseinander? Geht gar nicht, meint der slowenische Kulturkritiker Slavoj Zizek, nur in einer Komödie wäre die richtige Form gefunden. De Jong meint „… jedes Genre
wird der Sache nicht gerecht, und jedes aus einem anderen Grund“.
Eine Fernsehkollegin begleitet die beiden. Wegen der Erinnerungsfeierlichkeiten sind Touristik-Touren durch das Konzentrationslager eigentlich abgesagt. Die Besuchergruppe aus Deutschland wagt es
dennoch.
Zum Buch: Der Autor reflektiert über die Unmöglichkeit von Beschreibung und Literatur im Anblick des Lagers. Er genehmigt sich dennoch auch eine gute Portion schwarzen Humors, postet seine Reisepläne
ironisch in Facebook, pinkelt als bewusste Geste gegen den Stacheldrahtzaun, reflektiert Selbsthass, Angst, Tod und Verderben, erwähnt Mulischs Buch über den Eichmann-Prozess, (Auschwitz ist der
„einsamste Ort auf Erden“.) wird sich beim Einwerfen von Paracetamol von BAYER bewusst, dass diese Firma aus der IG Farben hervorging, dem Teil-Patentinhaber von Zyklon B.
Als er ins Mercedes-Taxi steigt, wird ihm bewusst, dass Mercedes die Fahrzeuge und Panzer für das NS-Regime gebaut hat.
Der Autor Daan Heerma van Voss befindet sich also an dem Ort, an dem „…mit dem menschlichen Gewissen abgerechnet werden muss“. (Papst Johannes Paul II.)
Die Baracken, die Wachtürme, die Rampe, der Galgen, der Block 10 und die Todesmauer zum Block 11, wo die Gefangenen erschossen wurden, all das macht Eindruck auf den Autor. „Die Atmosphäre ist intim,
sublim, beklemmend.“ Und zugleich schwingt mit, dass „alles Teil einer Inszenierung erscheint“.
Dennoch empfindet der ungläubige Autor Auschwitz als einen Ort mit theologischer Reichweite, er denkt an Gott, mehr als je zuvor.
Unfassbar für den Leser, dass ein Tourist seine Jacke auszieht und in einen Verbrennungsofen klettert, um ihn von innen zu beäugen. Seine Wanderschuhe ragen aus dem Ofen. Ein Blitz – der Mann hat
einen Schnappschuss gemacht. Er kommt wieder heraus, klopft seine Ärmel ab.
Zwischen dem Lager Auschwitz und dem Außenlager Birkenau (Auschwitz II) kann der Besucher seinen Hunger stillen und wählen zwischen Mc Donald und Kentucky Fried Chicken, und vor dem Tor zur Hölle der
Vernichtung machen Jugendliche Selfies vor dem Schild „Arbeit macht frei“.
Das Buch ist eine dichte, beeindruckende, impressionistische und essayistische Reiseerzählung, eine Momentaufnahme mit Innen- und Außenansichten auf eine unfassbare Tatsache deutscher Geschichte,
verbunden mit Rückerinnerungen an die eigene Familie, an den Freundeskreis, an Bezugspersonen des Autors.
Man könnte es das Ergebnis einer Erinnerungsarbeit nennen, das die Gräuel des Naziregimes in Erinnerung ruft.
In einem Interview für das germanistische Internetportal „kritische-ausgabe“ antwortet der Autor auf die Frage: „Was sollte und muss uns das Erinnern heute bedeuten?“: „Die Gegenwart ist ein
Erzeugnis der Vergangenheit. Man kann das eine ohne das andere nicht verstehen. Zeiten verändern sich immer und keine Situation gleicht der anderen. Aber die Leute bleiben gleich. Ihre Schwächen
bleiben dieselben. Ihre Art auf Gefahren zu antworten, bleibt dieselbe. Seine Geschichte nicht zu kennen, bedeutet gewissermaßen, auf alle Fragen schon Antworten zu haben. Das ist anmaßend.“
Quelle kritische-ausgabe.de
In einem ergänzenden Text ist van Voss‘ Amsterdamer Rede zur Gedenkfeier für die Toten des Zweiten Weltkrieges angefügt. Dort heißt es: „Gedenken ist keine Pflicht. Es ist viel wichtiger als eine
Pflicht. Es ist eine Ehrensache.“ Ein Wort, das ganz und gar aus der Mode gekommen ist.
Daan Heerma van Voss, geboren 1986, ist Buchautor und Journalist. Er verfasst Beiträge für internationale Zeitungen, darunter ›The New York Times‹, die
amerikanische ›Vogue‹ und ›Svenska Dagbladet‹.
Daan Heerma van Voss Eine verspätete Reise Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens und Ulrich Faure (Nachwort), mit einer Rede des Autors und einem Nachwort von Erik Schumacher Büchergilde Gutenberg
Der Trompeter von St. Petersburg
Geschichte kann man über das Erzählen von Geschichten definieren, über die Darstellung von Epochen, von Völkern und deren Wanderungen, über archäologische Grabungen, über Jahreszahlen und Chroniken,
über Kunst, Musik, Literatur, über Städte und Gebäude, Regionen und eben aber auch über Personen.
Diese Methode wählt Christian Neef, langjähriger SPIEGEL-Korrespondent in Moskau und Russlandkenner. Er untersucht in seinem Buch DER TROMPETER VON SANKT PETERSBURG den GLANZ UND UNTERGANG DER
DEUTSCHEN AN DER NEWA, verlegt bei SIEDLER.
Inspirator dafür war Anatolij Jakowlewitsch Rasumow. Er arbeitet in der Russischen Nationalbibliothek und beschäftigt sich als Archivar des Großen Terrors mit der Dokumentation der Schicksale der
deutschen Bevölkerung in der Sowjetunion, die unter den Bolschewiki als Vertreter der Elite ausgelöscht wurde. Der Autor kommt in den einleitenden Bemerkungen zu dem Schluss: „Das einstige Petersburg
war von dieser Tragödie besonders betroffen. Davon hat sich die Stadt bis heute nicht erholt. Petersburg hat nie mehr an seine große Vergangenheit anknüpfen können.“
Dereinst lebten 50.000 Deutsche in der Stadt der „weißen Nächte“ an der Newa, die meisten von ihnen wurden jedoch Opfer des „Großen Terrors“ im Stalinismus, wurden zum Tode verurteilt, ja geradezu
systematisch ausgerottet.
Neef greift sich beispielhaft einzelne Schicksale heraus und macht daraus sein Buch. Hauptfigur ist der Trompeter Oskar Böhme, der bis zur russischen Revolution eine Karriere als Orchestertrompeter
und Komponist macht, die jedoch in der nachrevolutionären Terrorzeit mit seinem Tod ihr jähes Ende findet.
Zurück auf Anfang: „Es ist die Blütezeit der Salonmusik (…) Deutsche Trompeter haben besonders gute Chancen, denn sie gelten als führend in der Welt.“ Deshalb wandert die Hauptperson Böhme aus,
erwirbt die russische Staatsbürgerschaft.
Die zweite Schicksalsebene ist die der Apothekerdynastie Poehl, und die dritte Ebene ist das Leben der Familie des Schauspielers Armin Mueller-Stahl.
Die Deutschen arbeiteten als Politiker, Wissenschaftler, Kaufleute und Handwerker oder wurden auf anderer Hierarchieebene in der Elite Minister, Gouverneure und Diplomaten. „Sie haben Zaren,
Regierungschefs und Minister gestellt, waren Mediziner und Architekten, Klavierbauer und Buchbinder, Brauer oder Bäcker. Vieles von ihrem Glanz verdankte die russische Residenz den Deutschen.“
Zurück zu Böhme. Er versucht in Sankt Petersburg sein Glück. Dort pulsiert die Herzkammer des russischen Reiches. „Die Petersburger Straßen erwecken in mir einen Durst nach großen Schauspielen“,
schreibt der Dichter Ossip Mandelstam.
Auch einige Fabriken sind in deutscher Hand. Böhme steigt auf, übernimmt 1902 eine Stelle als Kornettist im Orchester des weltberühmten Mariinski-Theaters. Er bekommt die russische
Staatsbürgerschaft, wird gar Ehrenbürger von St. Petersburg. Schon 1921 leitet er die Trompetenklasse der Rimski-Korsakow-Musikschule.
Als Kornettist im Orchester, Solist und Komponist wird er also „geadelt“ mit den Rechten eines Künstlers der ersten Klasse.
Böhme erlebt die Kriegswirren, danach die revolutionären Aufstände, und er wird schließlich Opfer des stalinistischen Terrors nach den großen Schauprozessen - in letzter Minute erst, denn die Phase
des Terrors gegen „trotzkistische Spione, Diversanten und Verräter der Heimat“ endet 1938. Die Anklageschrift gegen Böhme war ohne Beweise zusammen geschrieben worden.
Böhme sitzt im Verhörkeller: „Ein NKWD-Mann tritt an ihn heran. Er hält eine Pistole in der rechten Hand, setzt sie blitzschnell im Nacken von Oskar Böhme an und drückt ab. Es reicht dieser eine
Schuss, die NKWD-Leute haben das immer und immer wieder geübt. Böhme bricht zusammen, fällt auf den Kellerboden. Der Trompeter Oskar Wilhelmowitsch Böhme, vor 40 Jahren aus Dresden in dieses Land
gekommen, ist tot.“
Bis in die kleinsten Details lesen wir Verhörprotokolle, Troika-Beschlüsse, Bescheinigungen, Dokumente und das Todesurteil. Von mehr als 1,5 Millionen verhafteter Personen wurden 681 692 erschossen,
also jeder zweite, mehr als 40. 000 davon allein in Leningrad.
Neef zeigt uns auch, was aus den Gebäuden geworden ist, in denen seine Protagonisten lebten oder arbeiteten. Die Geheimdiensträume und Gefängnisse existieren noch heute. Neben dem Kinosaal, in dem
Böhme dirigierte, existiert heute ein Pub mit deutschem Flair und dem Namen „Bierquelle“, in der es Würste aus der bayerischen Oberpfalz gibt.
Auch eine Spur der deutsch-russischen Geschichte.
Ein reich bebildertes, großes, detailreiches, tiefgründiges, beschreibendes und analysierendes Geschichtspanorama.
Christian Neef, geboren 1952, beschäftigt sich als SPIEGEL-Korrespondent seit über drei Jahrzehnten mit der Berichterstattung aus Russland bzw. der Sowjetunion, dem Kaukasus, Zentralasien und Osteuropa. Er arbeitete unter anderem 16 Jahre lang in Moskau, war zehn Jahre stellvertretender Auslandschef des SPIEGEL und gilt als ausgewiesener Experte für den Ukraine-Konflikt. Neef veröffentlichte mehrere Bücher zur russischen Geschichte.
Christian Neef: DER TROMPETER VON SANKT PETERSBURG. GLANZ UND UNTERGANG DER DEUTSCHEN AN DER NEWA Siedler
Jill Lepore: Diese Wahrheiten Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika
Wer große Geschichtserzählungen schreibt, wer wie Livius seine Geschichte Roms ab urbe condita alles von Anfang an erzählen will, braucht Mut. Wer nicht nur erzählen will, wie alles war, wie alles wahr ist, braucht umfassende Kenntnis und Urteilskraft. Wer sein Urteil historisch begründen will, braucht Quellen.
Solche großen Erzählungen wie die mehrbändige „Römische Geschichte“ Theodor Mommsens sind auch schon mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Klio, die erste der neun Musen, der Schutzgöttinnen der Künste, ist die Patronin der Historiker. Dies vorausgeschickt, gilt es einen wunderbaren Musenkuss anzuzeigen. Die 1966 geborene Harvard-Historikerin Jill Lepore hat im vergangenen Jahr unter dem Titel „These Truths. A History oft the United States“ ein Buch vorgelegt, das alle Voraussetzungen erfüllt, das Unerklärlich-Widersprüchliche der USA aufzuklären. Jetzt ist es in der glücklichen Übersetzung von Werner Roller auf Deutsch erschienen. Der Gerda Henkel Stiftung gebührt das Verdienst, das ermöglicht zu haben.
Ein Schlüssel für das überzeugende Gelingen dieses Buches ist die Methode. Jill Lepore schreibt keine aufzählende Chronologie, kein „historisches Tagebuch“, sondern sie folgt der Geschichte ihres Landes anhand der Großen Themen, der großen Debatten. Diese aber spiegelt sie an Fakten, die sie aus Quellen entnimmt. Hierbei entsteht ein feines Geflecht aus Makro- und Mikrogeschichte, aus den großen Linien und den kleinen und großen Rissen.
Das fängt schon mit einer verstörenden Demontage des verklärten Gründungsmythos der Vereinigten Staaten an. Die britischen Siedler wollten sich – unter Berufung der Magna Charta Libertatum, des großen englischen Freiheitsbriefs von 1215 – nicht einer Steuergesetzgebung der britischen Kolonialmacht unterwerfen, an der sie selbst nicht beteiligt waren. Aber sie selber wollten, nachdem sie ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten, nicht alle Menschen an den Freiheitsrechten der Magna Charta beteiligen - weder die schon stark dezimierten Indianer, noch die zu Millionen importierten afrikanischen Sklaven, noch auch die Frauen oder die Männer ohne „ausreichendes“ Vermögen oder Einkommen. Jill Lepore erzählt diesen Widerspruch anhand der scharfen Debatten über diese Fragen, aber eben auch anhand von Details, die bis in den Mund von George Washington führen, aus dem so kluge Reden erklungen waren. Er hatte verfaulte Zähne und ließ sie nicht nur aus Elfenbein ersetzen, sondern auch von Zähnen, die seinen Sklaven gezogen worden waren, um sie ihm einzusetzen. Zahnärzte in aller Welt wissen, dass sie durch Goldfäden miteinander verbunden waren. Washington ließ – obwohl er eigentlich dafür war – seine 123 Sklaven auf seinen Gütern in Virginia (seiner Frau gehörten weitere etwa 170) nicht frei, weil das ein Präzedenzfall gewesen wäre, den er als erster Präsident der Vereinigten Staaten, als der er sich nicht ein drittes Mal wieder zu Wahl gestellt hatte, nicht schaffen wollte.
Oder, noch so ein bezeichnendes Detail: Bei der Frage, wie viele Abgeordnete die einzelnen der Gründungsstaaten in das Repräsentantenhaus entsenden sollten, sollte deren Einwohnerzahl entscheiden. Hier bestimmten die Gründungsväter die Regel, dass jeder Weiße als ein Einwohner, jeder Schwarze als drei Fünftel Einwohner gewertet wurde. Das galt natürlich nicht für das Stimmrecht, das die Schwarzen erst sehr viel später erringen sollten, sondern nur für die Zahl der zu wählenden Repräsentanten. Das führte dazu, dass in 32 der ersten 36 Jahre die Präsidenten der USA aus den sklavenreichen Südstatten kamen.
In der Unabhängigkeitserklärung hieß es – eigentlich unmissverständlich – „dass alle Menschen gleich & unabhängig geschaffen sind, dass sie weil sie gleich geschaffen sind, natürliche & unveräußerliche Rechte besitzen…“. Aus der gleichen Zeitung, in der diese Verfassungssätze veröffentlicht wurden, zitiert Lepore eine Anzeige: „ZU Verkaufen. EIN ANSEHNLICHES junges NEGERMÄDCHEN, 20 Jahre alt, sie ist gesund und hatte die Pocken, sie hat ein kleines männliche Kind.“ Die Autorin ermittelt weiter: „Von der Mutter hieß es, sie sei ‚bei der Hausarbeit bemerkenswert geschickt‘, ihr Baby war ‚etwa sechs Monate alt‘ und wurde noch gestillt. Beider Namen wurden nicht genannt.“ Es folgt in einer Fußnote die Quellenangabe. Lepore urteilt: „Sie unterstanden nicht ihrer eigenen Vernunft und freien Entscheidung. Sie wurden durch Gewalt und Zwang beherrscht.“
Mit dieser Methode der Beurteilung der Makrogeschichte anhand der Mikrogeschichte geht die Autorin in beeindruckender Souveränität durch die Jahrhunderte: Die Monroedoktrin, der Sezessionskrieg, die Industrialisierung und die Weltkriege mit den Schlusspunkten in Hiroshima und Nagasaki. Der Vietnamkrieg, Watergate, und der Kalte Krieg werden auf diese überzeugende Weise erzählt: Nixon trifft in Moskau Chrustschow: Er eröffnet eine amerikanische Ausstellung in Moskau, auf der – zum Zeichen der Überlegenheit des Kapitalismus – alle modernen elektrischen Haus- und Küchengeräte ausgestellt waren. Lepore zitiert einen amerikanischen Politiker, der die tatsächliche Wahrheit über das Familienleben von Amerikanern gern ausgestellt gesehen hätte. Da hätten die Sowjetrussen sich in ihrer Ablehnung des Kapitalismus eher bestärkt gesehen. Als ob zum Muster eines vorzeigbaren sowjetischen Haushalts außer einem Samowar nicht auch Puschkin oder vielleicht ein Klavier gehört hätten.
Die Widersprüche der US-amerikanischen Politik legt die Autorin bis in die Trump-Zeit weiter offen: „Die jährliche Durchschnittstemperatur in Philadelphia lag zur Zeit des Verfassungskonvents bei knapp über 11 Grad Celsius. Bis zum Ende von Barack Obamas Präsidentschaft war sie auf 15 Grad gestiegen. Nur kurze Zeit, nachdem Donald Trump den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem von allen 196 Vertragspartnern der UN-Klimarahmenkonferenz unterschriebenen Pariser Klimaabkommen verkündet hatte – eine Erklärung, die er als ‚Stärkung der Souveränität Amerikas‘ bezeichnete – löste sich ein Eisberg mit einem Gewicht von einer Billion Tonnen, so groß wie der Bundesstaat Delaware, von der Antarktis.“ Die Methode, Ideen, Sprüche, politische Manifeste mit den Fakten abzugleichen, und seien sie noch so winzig wie die Zähne von George Washington, diese Methode überzeugt und bringt dem Leser die widersprüchliche historische Wahrheit auf glänzend geschrieben Weise nahe.
Harald Loch
Jill Lepore:
Diese Wahrheiten. Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika
Aus dem Englischen übersetzt von Werner Roller
C.H.Beck, München 2019 1120 Seiten 39.95 Euro
In der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung
Marian Füssel: Der Preis des Ruhms
Was für eine Herausforderung: Die Mikrogeschichte eines globalen Konflikts kann der Königsweg zu einer „authentischen“ und lebendigen Historiographie sein. Marian Füssel, Professor für Frühe Neuzeit an der Georg-August-Universität Göttingen, hat diese Herausforderung angenommen und mit Bravour bewältigt. Seine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges (so der Untertitel seines soeben erschienenen Buches „Der Preis des Ruhms“) hat es mit einem Geschehen zu tun, das hierzulande meist als der Dritte Schlesische Krieg mit prominenter europäischer Beteiligung wahrgenommen wird. In Wirklichkeit haben zeitgleich - eng mit dem Krieg in Mitteleuropa verknüpft - Großbritannien und Frankreich ihren Kampf um Nordamerika, um die Beherrschung Indiens und der Karibik ausgetragen, dessen Ausgang die Weltgeschichte nachhaltiger geprägt hat als die Rivalität zwischen Friedrich II., den manche „Den Großen“ nennen, und Maria Theresia. Es war eine Zeit der Bündnisse. Preußen hatte einen mächtigen und zahlenden Verbündeten: Großbritannien, das über die Personalunion mit Hannover auch eine kontinentale Macht war. Die Gegner waren übermächtig: Österreich, Frankreich mit dem ihm dynastisch verbundenen Spanien, Russland (bis kurz vor dem Schluss) und Schweden. Dazu kommt noch das Alte Reich, also das Dach über dem vielteiligen Deutschland, das Preußen wegen seines völkerrechtswidrigen Angriffs auf Sachsen im Jahre im August 1756 verurteilt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren Frankreich und Großbritannien in Nordamerika und in Indien Frankreich und Großbritannien bereits aneinandergeraten.
Bis zu den Friedensschlüssen von Paris (1762) und in Jahr später in Hubertusburg vergingen die dem Kriege den Namen gebenden Sieben Jahre. Hunderte von Schlachten und kleineren Gefechten forderten Millionen Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung. Die am Krieg beteiligten Länder verschuldeten sich auf lange Zeit. Die Ergebnisse schufen den Boden, auf dem die Revolutionen in Amerika und in Frankreich gegen Ende des Jahrhunderts wachsen würden. Das in allen seinen politischen, militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Facetten darzustellen, würde den Rahmen eines lesbaren Buches sprengen und die Menschen, die das alles miterlebten, nicht berücksichtigen. Deshalb hat Füssel eine kluge Auswahl von Schlachten und Ereignissen getroffen, um Raum für Originaltöne von Zeitgenossen zu schaffen. Er lässt einfache Soldaten und Offiziere, Indianer, Priester, Seeleute, Bäckermeister, Männer und Frauen aus allen Schichten der Völker zu Wort kommen. Sie haben Briefe und Tagebücher geschrieben, Zeitungen gelesen, Berichte und Chroniken verfasst. Sie haben ihre Beobachtungen notiert und ihre Gefühle beschrieben, ihren jeweiligen Gott angerufen oder auch verdammt. Der Chor dieser Chronisten singt kein einheitliches Lied, aber die Vielfalt der mit Bedacht ausgewählten Stimmen aller Höhenlagen vermittelt mit der sie verbindenden „klassischen“ Geschichtsschreibung ein genaueres Bild dieser Sieben Jahre. Auch damals waren Menschen beteiligt, beurteilten das Geschehen, litten unter der Rücksichtslosigkeit der Herrschenden, der Befehlenden und der Gehorchenden. Vieles erscheint in neuem Licht. Die wachsende Bedeutung der – damals ausschließlich gedruckten – Medien wird z.B. durch Zitate aus Zeitungen und die Reaktion der Zeitzeugen auf die Meldungen in den „Gazetten“ verdeutlicht.
Als Beispiel für die durch die O-Töne gewonnene Lebendigkeit sei der Brief des in preußischen Diensten an der Schlacht von Leuthen beteiligten Schweizers Johann Georg Sulzer zitiert, den er wenig später aus Berlin an einen Schweizer Freund richtete: „Nachdem die letzten Linien der Feinde geflohen, fing der König (Friedrich II. – H.L.) mit lauter Stimme zuerst an zu rufen: ‚Viktoria!‘, und das siegreiche Heer rief ihm nach. Und als Halte gemacht war, stimmten die Soldaten aus eigenem Triebe das Lied an: ‚Nun danket alle Gott‘.“ Füssel resümiert in seiner Darstellung: „Das alte Kirchenlied ging damit als Choral von Leuthen in die Geschichte ein“. Der Dank galt dem Sieg, der mit einem hohen Blutzoll errungen war: 6000 Mann auf Seiten Preußen, 20000 Mann auf Seiten der Österreicher und der Reichsarmee. „Besonders Verbände aus Bayern und Württemberg hatten in der Schlacht gelitten“. Diesen „Zynismus über die religiöse Sinngebung“ des Kriegs geißelte als einer der Wenigen damals Voltaire: „Das Erstaunliche an diesem Unternehmen ist, daß jeder einzelne Führer der Mörder seine Fahnen segnen lässt und sich feierlich auf Gott beruft, bevor er auszieht, um seine Menschen umzubringen. … Wenn zehntausend Menschen mit Feuer und Schwert umgebracht worden sind und obendrein noch irgendeine Stadt völlig zerstört worden ist, dann singt man vielstimmig ein recht langes Lied (Te deum – H.L.). Das gleiche Lied wird bei Hochzeiten und Geburten wie beim Morden gesungen…“
Solche Stimmen der Zeit ergänzen in diesem Neuland beschreitenden historiografischen Meisterwerk die quellengestützte Geschichtsschreibung und machen das durch zahlreiche Abbildungen und Karten ergänzte Werk zu einem Beispiel, wie man künftig Geschichte erzählen sollte.
Harald Loch
Marian Füssel:
Der Preis des Ruhms. Eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges
C.H.Beck, München 2019 636 Seiten zahlr. Karten und Abb. 32 Euro
Brian A. Catlos: „al-Andalus” Geschichte des islamischen Spanien
Die Geschichte Andalusiens wird üblicherweise teils verklärend, teils verfälschend als eine Zeit der „conviviencia“, des friedlichen Austauschs zwischen Christen, Juden und Muslimen auf der iberischen Halbinsel erzählt. Eine die neuere Forschung berücksichtigende, zusammenfassende Darstellung dieser Schlüsselepoche des europäischen und mediterranen Mittelalters gibt es für deutschsprachige Leser bisher nicht. Jetzt hat das faktenreiche Buch des an der University of Colorado, Boulder, als Professor für Religionswissenschaften lehrenden Brian A. Catlos diese schmerzliche Lücke geschlossen. Er räumt mit dem Narrativ von mittelalterlicher Toleranz auf und beschreibt die Zeit vom ersten arabisch-islamischen Eindringen im 7. Jahrhundert bis zum Fall Granadas 1492 eher als politische Geschichte mit wechselnden Akteuren, die sich im Wesentlichen nicht an den Grenzen der Religionen und Konfessionen orientierten: „Es wurde viel darüber geschrieben, ob al-Andalus eine Idylle aufgeklärter Toleranz und conviviencia oder Schauplatz eines brutalen Kampfes der Kulturen war. Es war weder das Eine noch das Andere. Toleranz gilt heute oft nicht mehr als eine Tugend, und im Mittelalter war sie das noch viel weniger. Aber der Kampf fand zumeist innerhalb, nicht zwischen den „Kulturen“ statt.“
Der 1966 in Montreal geborene Catlos folgt in seiner Darstellung dem Lauf der Geschichte, unterteilt sie nach Dynastien und wechselnden Dominanzen. Er erzählt in 30 Kapiteln von den Kämpfen innerhalb des islamischen Teils der Gesellschaft, zwischen Arabern und Berbern, zwischen den sich abwechselnden Clans. Genauso verhielt es sich auf der christlichen Seite. Die konkurrierenden kleineren Königreiche bekämpften sich ebenfalls kriegerisch. Immer wieder kam es zu Koalitionen über die Religionsgrenzen hinweg zwischen muslimisch bzw. christlich orientierten regionalen Herrschern. Vor allem kam es zu einem kulturellen Transfer von der hochentwickelten arabisch-muslimischen Seite hin zu den damals unterentwickelten Gesellschaften christlicher Prägung. Dazu kam, wie ein intellektuelles Ferment, das jüdische Element, das sowohl in den wirtschaftlichen Austauschbeziehungen als auch als Vermittler von Wissen und Literatur unübersehbar in Erscheinung trat. Das Arabische, das Lateinische und das Hebräische waren Sprachen, die als Verkehrssprachen wie als Literatur- und Wissenschaftssprachen allgemein benutzt, übersetzt und gepflegt wurden. Die religiösen Unterschiede spielten in der ganzen Epoche eine wichtige, Orientierung und Rechtsregime bietende, jedoch keine entscheidende Rolle: „Die Christen, Muslime und Juden des Mittelmeerraums teilten eine im abrahamitischen Monotheismus wurzelnde Kultur, sie teilten die persische und griechische Gelehrsamkeit, römische Institutionen, die ägyptische Esoterik, ein bestimmtes Geschichtsbewusstsein sowie volkstümliche Sitten und Gebräuche und kulturelle Traditionen, die sich im Zuge von jahrtausendelangen Handelsbeziehungen, von Migration, Eroberung und Besiedlung entwickelt hatten.“
Der Autor verändert unsere Sicht auf al-Andalus, wenn er das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte dort nicht aus „Toleranz, sondern aus Zweckmäßigkeit und praktischem Nutzten“ ableitet, also aus primär politischen Gründen. In vielen Details weist er nach, dass sich die Akteure und die einfachen Menschen „einander verstehen und sich miteinander verständigen und auf diese Weise trotz aller Differenzen einen gemeinsamen Boden finden, sich einander anpassen und sich die jeweils andere Kultur zu eigen machen“ konnten. Wenn in al-Andalus so etwas wie Toleranz herrschte, dann beruhte sie nicht auf moralischen Erwägungen oder einer aufgeklärten Ideologie. Sie entwickelte sich vielmehr entgegen dem religiösen Eifer auf allen Seiten aus einem pragmatischen, oft auch machtpolitischen Bedürfnis - keine geringe Leistung!
Dem Leser dieses wichtigen Buches wird die Lektüre durch ein hilfreiches Glossar und durch eine chronologische Übersicht über die einzelnen Dynastien erleichtert. Eine vor allem die spanisch- und die englischsprachige Literatur berücksichtigende Bibliografie lädt zu weiterführenden Studien ein. Die mustergültige Übersetzung von Rita Seuß macht dieses historische Meisterwerk zu einem Lesegenuss. Insgesamt wird jede künftige Andalusien-Forschung auf diesem Standardwerk aufbauen und sich an der in ihm manifestierten Urteilskraft messen lassen müssen.
Harald Loch
Brian A. Catlos: „al-Andalus” Geschichte des islamischen Spanien
Aus dem Englischen von Rita Seuß
C.H.Beck, München 2019 491 Seiten 29,95 Euro
Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Übernahme
Als vor 30 Jahren die Mauer fiel, wusste niemand, wie es weiter gehen würde. Knapp ein später war die hoffnungsvolle Verheißung der damals geltenden Präambel des Grundgesetzes durch Beitritt der damit untergehenden DDR erfüllt. Ilko-Sascha Kowalczuk – ein bekennender Nicht-Teilnehmer an der „friedlichen Revolution“ in der DDR – hat sich in der Beurteilung der Durchführung der deutschen Einheit zu einem der vehementesten Kritiker dieses Prozesses und des gegenwärtigen Ergebnisses entwickelt. In seinem Buch „Die Übernahme“ legt er den Finger auf die wunden Punkte: Es wurde keine neue, gesamtdeutsche Verfassung ausgearbeitet, in die auch Elemente des in der DDR entstandenen Bewusstseins einzuarbeiten gewesen wären. Die DDR sein eine Gesellschaft gewesen, in der Arbeit ein entscheidendes Element gewesen sei und Leben wie Bewusstsein der Menschen tief beeinflusst hätte.
Die „Übernahme“ der DDR-Wirtschaft und -Betriebe im einseitigen Profitinteresse westdeutscher Unternehmen habe diese Arbeitsgesellschaft nachhaltig zerstört und bis heute erschüttert.
Entscheidend für die geschwundene Akzeptanz der Vereinigung in Ostdeutschland aber sei die bis heute ausgebliebene Anerkennung für diese auf Arbeit gegründete Gesellschaft jenseits aller real-sozialistischen Ideologie gewesen. Bis heute seien Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen bei wenigen Ausnahmen von Westdeutschen besetzt. Von den insgesamt vererbten Vermögen stamme und fließe nur ein weit unter dem Bevölkerungsanteil liegender Prozentsatz aus und nach Ostdeutschland. Die kulturelle Hegemonie des Westens habe wie die Skandalisierung der SED-Diktatur als Stasi-Staat zu viel Frust in den ostdeutschen Ländern und zu Hochmut in Westdeutschland geführt. Die Kampagne z.B. gegen Christa Wolf sei bezeichnend für die Überbewertung marginaler Stasi-Verstrickung in die Gesamtbewertung einer bedeutenden Schriftstellerin und Regime-Kritikerin gewesen. Der promovierte Historiker ist seit 18 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter in der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in der ehemaligen DDR („Gauck-Behörde“) und schreibt z. Zt. an einer Biografie über Walter Ulbricht.
Kowalczuk macht zwei Faktoren für das überproportionale Erstarken rechtsextremer und -radikaler Haltungen in Ostdeutschland verantwortlich: Erstens wird oft übersehen, dass die ostdeutsche Bevölkerung seit 1933 ununterbrochen von Diktaturen beherrscht wurde. Dabei seien der verordnete Antifaschismus der DDR und die ebenso verordnete Internationale Solidarität zwar von vielen geteilt, von anderen aber zusammen mit der Kritik an der DDR auch abgelehnt worden. Ein latenter Rassismus sei in der DDR vorhanden gewesen und nach der Vereinigung z.B. durch die erniedrigende Behandlung der vietnamesischen Kontraktarbeiter fortgesetzt worden.
Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Demokratie-Skepsis hätten in Ostdeutschland längere historische Wurzeln als im Westen. Dazu käme als zweites, eine im Osten allgemein empfundene Nichtanerkennung der Lebensleistung, der ja doch individuell zu bewertenden Biografien, des gesellschaftlichen Selbstverständnisses auch in der Abwehrhaltung gegenüber dem SED-Regime. Anerkennung als Staat hatte auch die DDR immer gefordert und von einer wachsenden Zahl von Ländern auch erhalten – nie expressis verbis von der Bundesrepublik. Diese Anerkennung, in den frühen Jahren der Bundesrepublik gegen über dem Staat DDR durch die Hallstein-Doktrin stigmatisiert, fordert Kowalczuk jetzt für die Menschen und ihre in der DDR ganz vielfältig entwickelte Gesellschaft und Kultur. Vielleicht sollte – meint Kowalczuk - auch der Westen endlich in der Vereinigung ankommen und nicht nur über die enormen Transferleistungen stöhnen. Es scheint so, als ob die Hallstein-Doktrin noch in vielen Köpfen im Westen Deutschlands nachwirkte!
Harald Loch
Ilko-Sascha Kowalczuk:
Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde
C.H.Beck, München 2019 319 Seiten 16,95 Euro