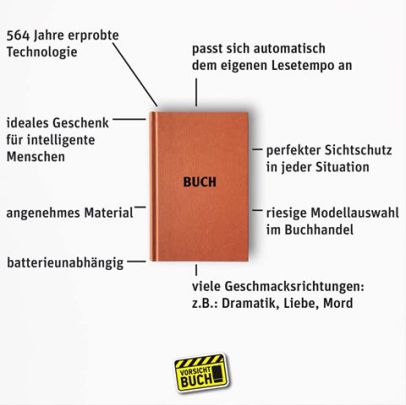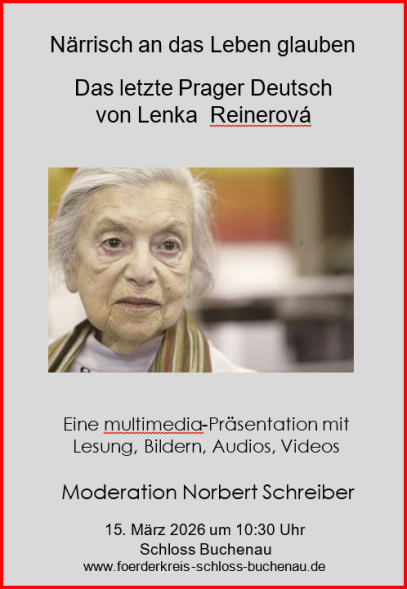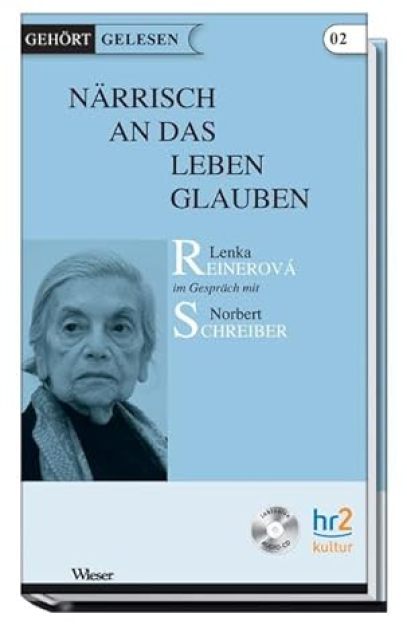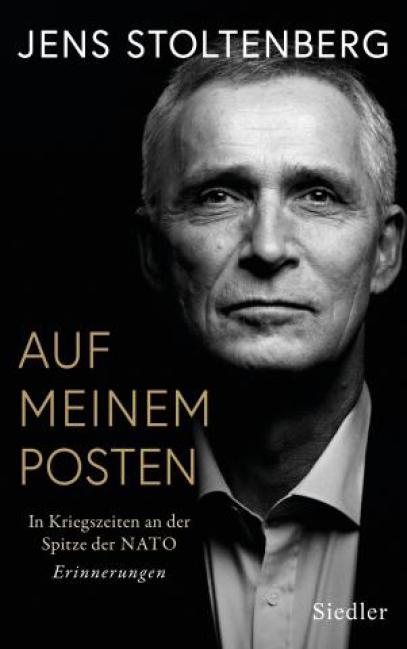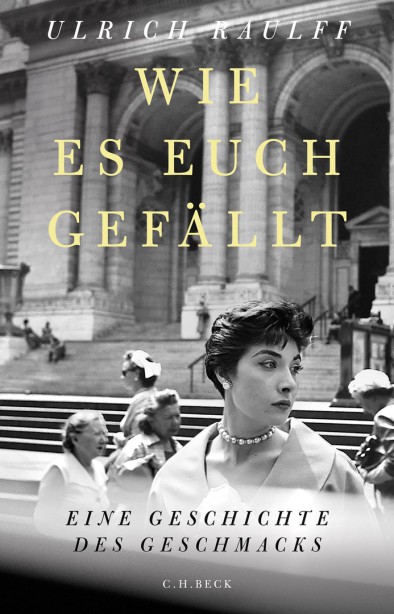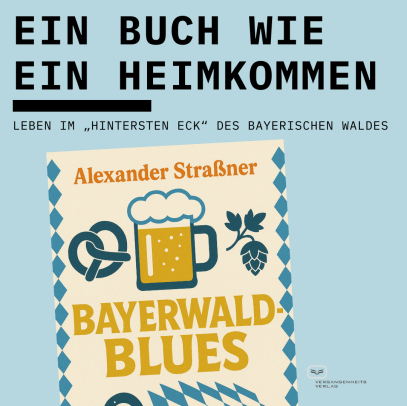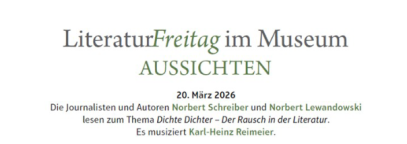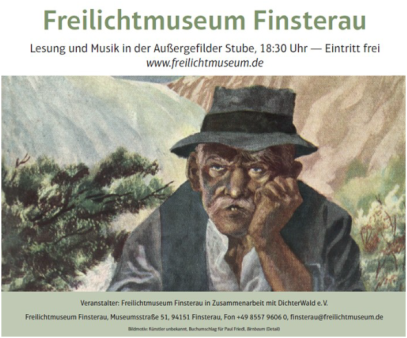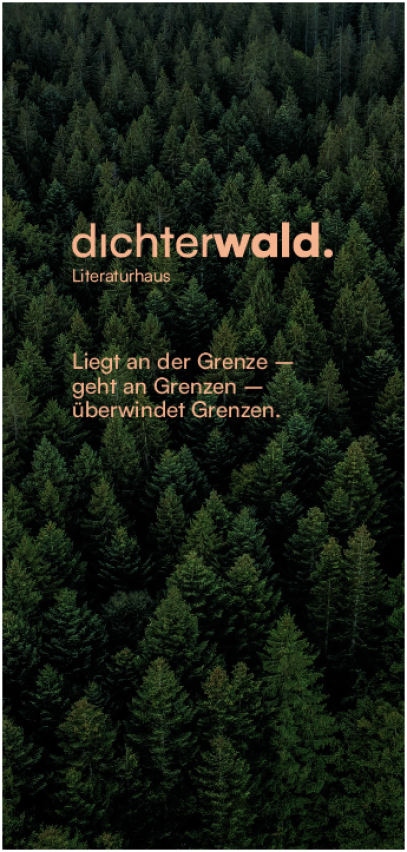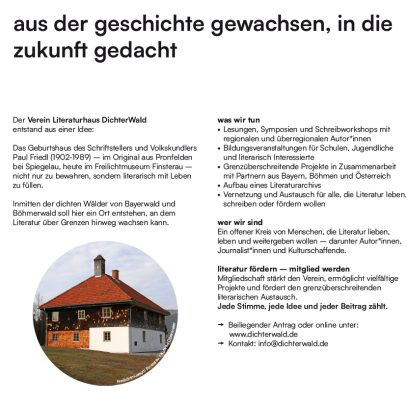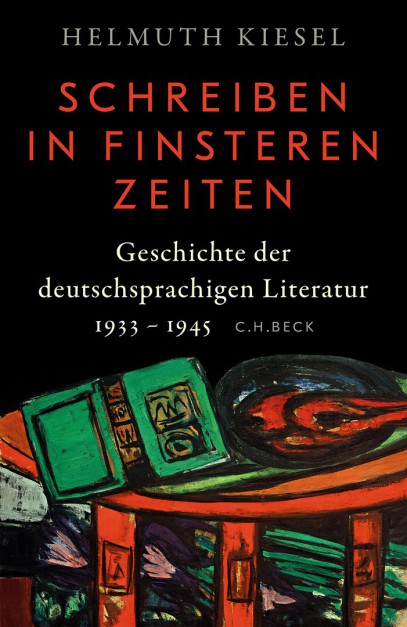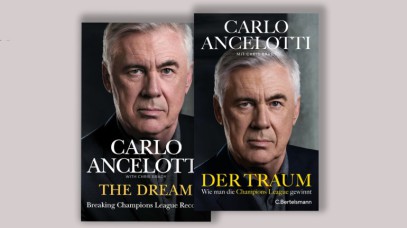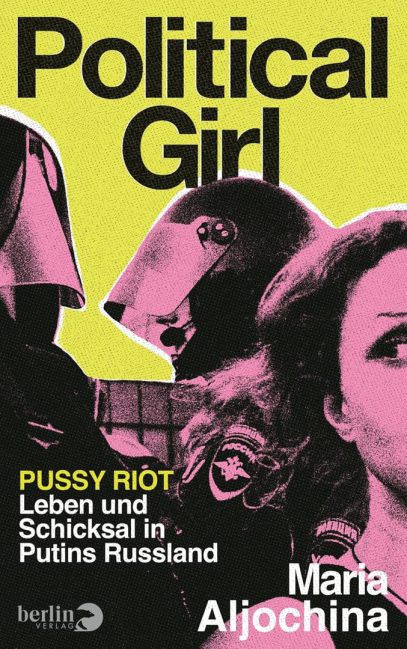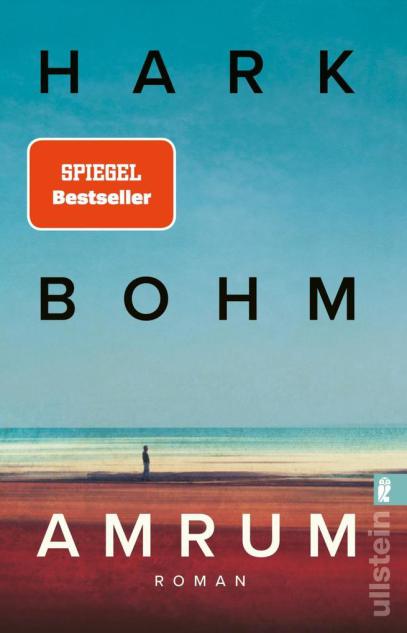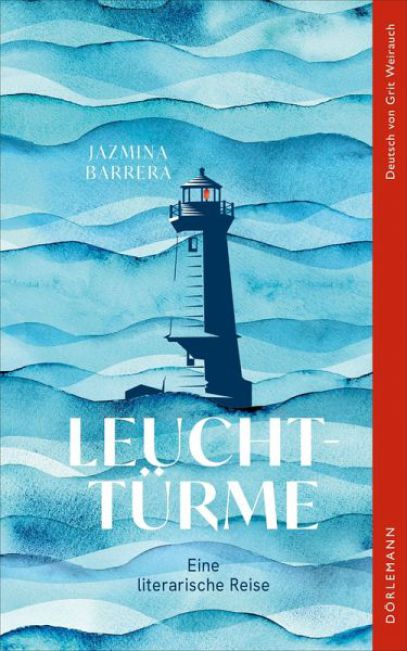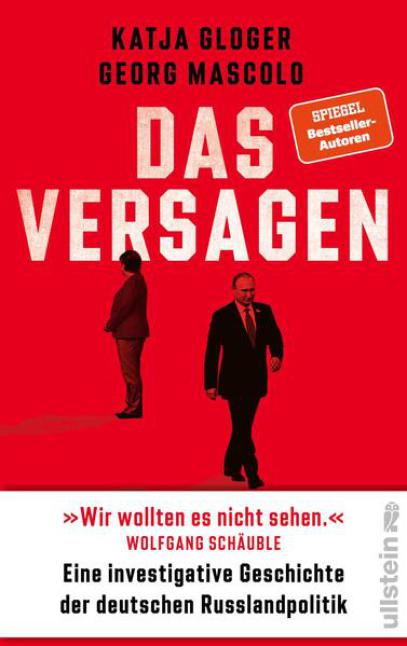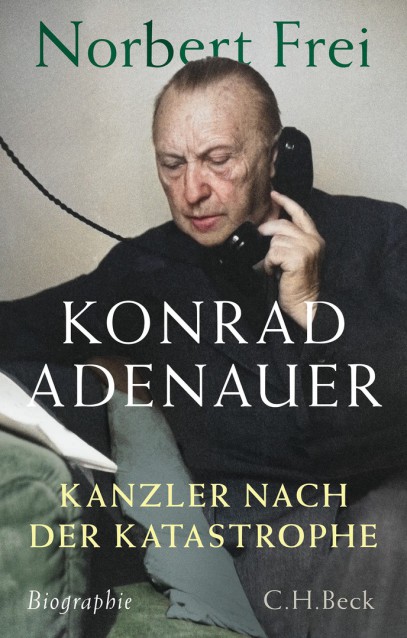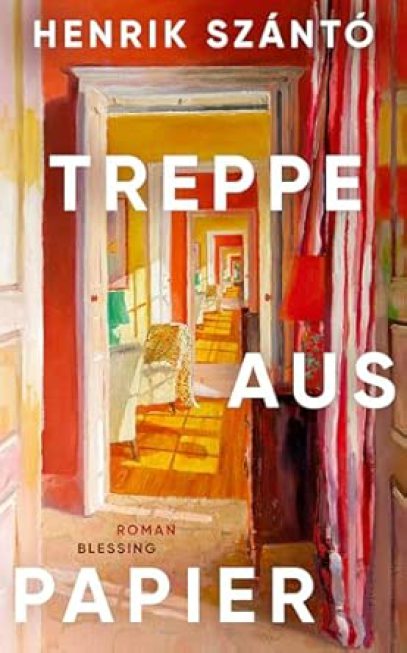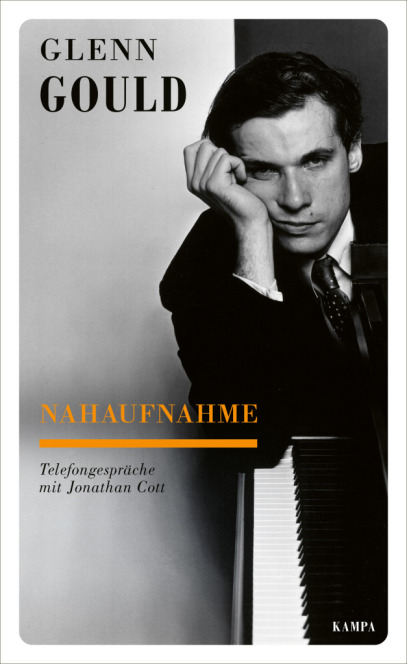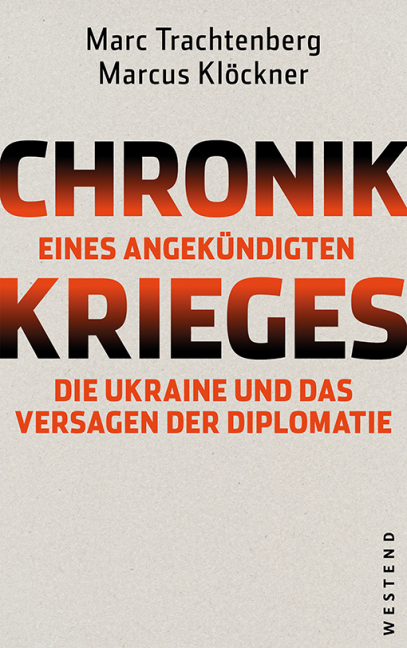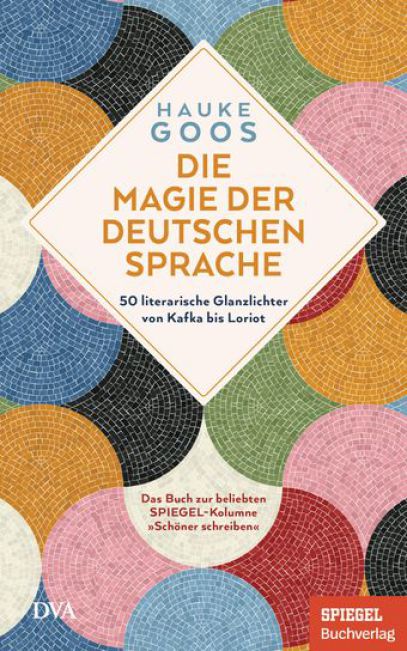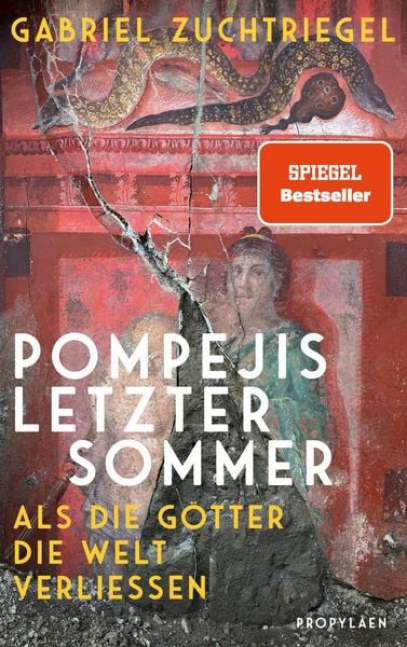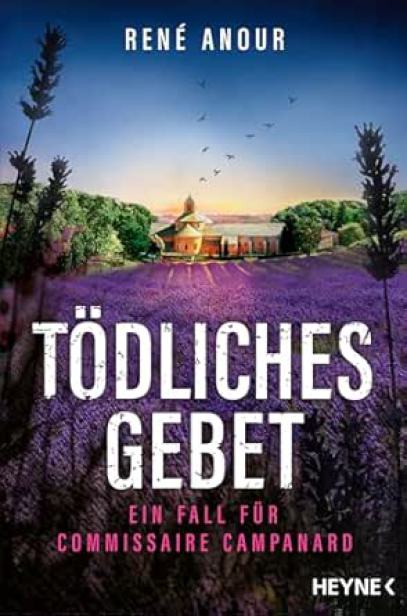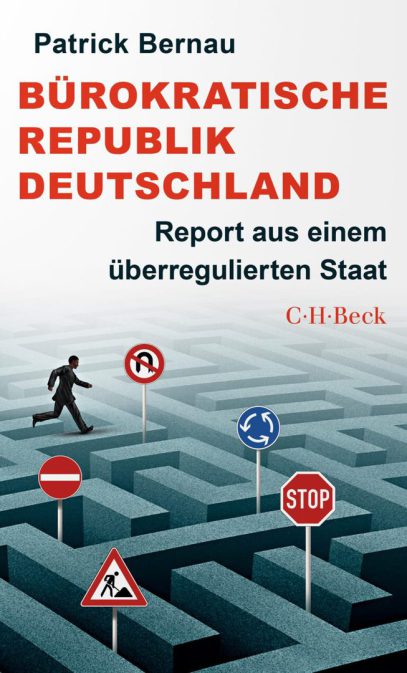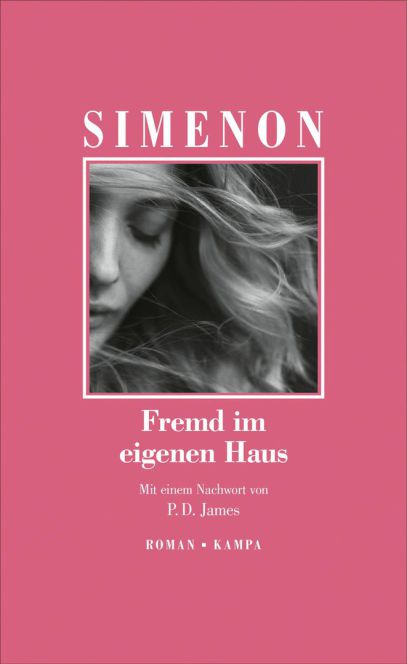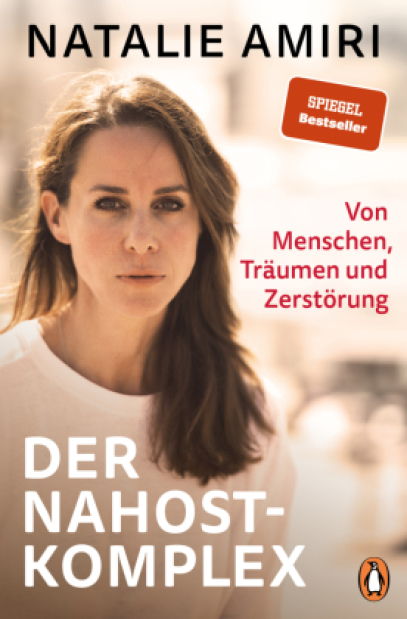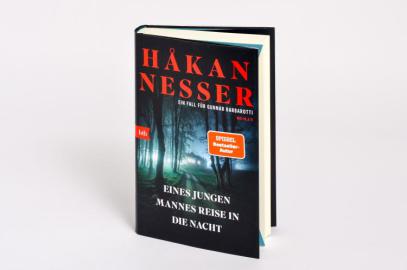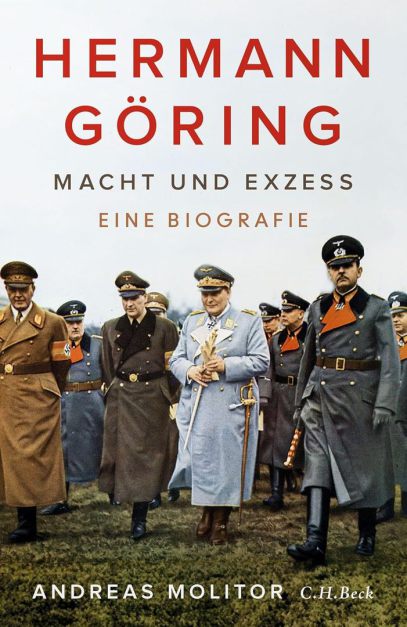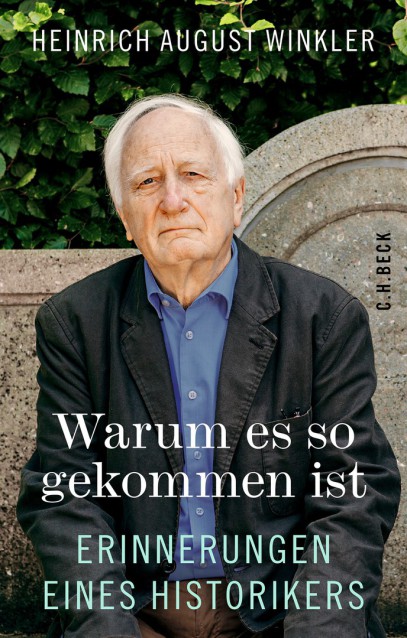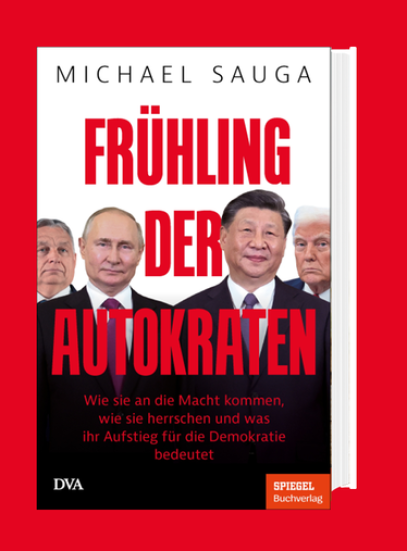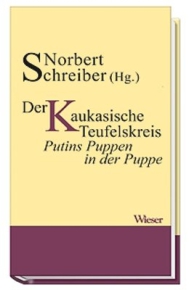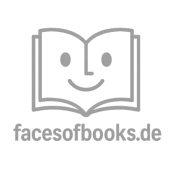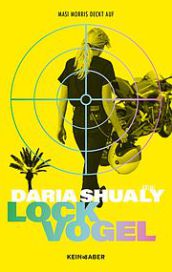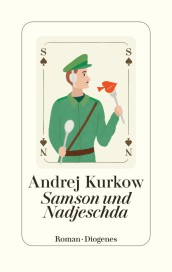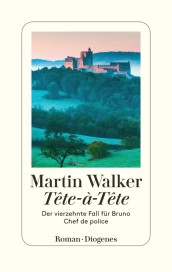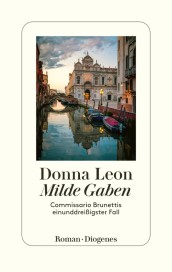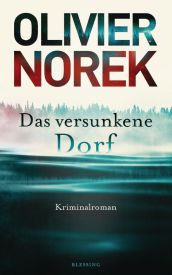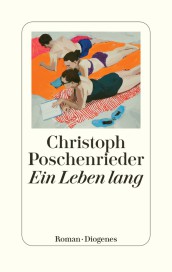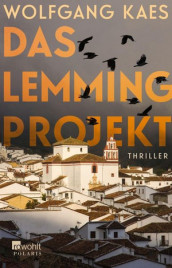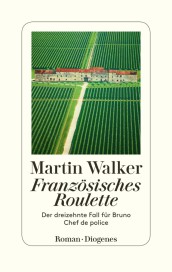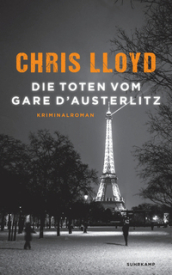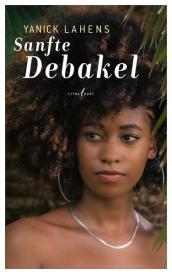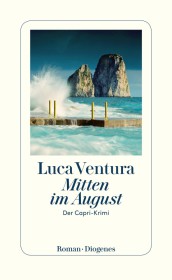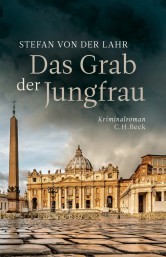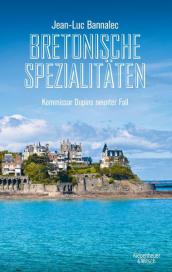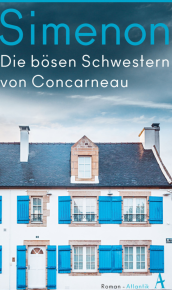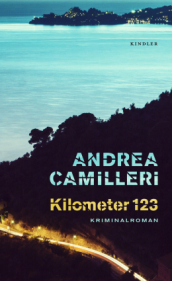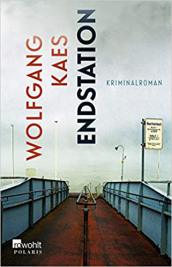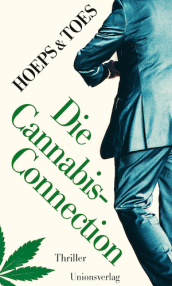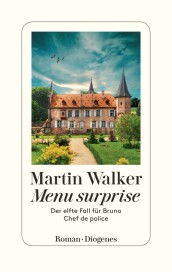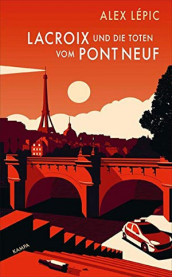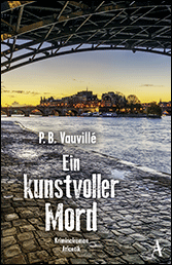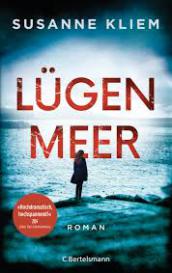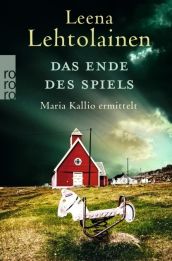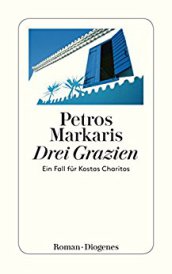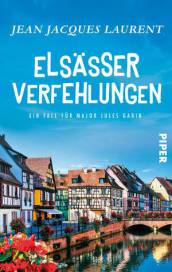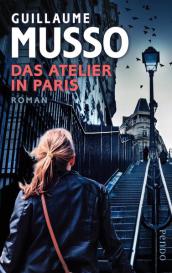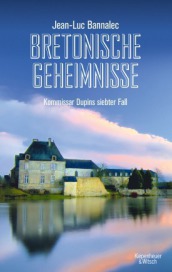Faces of Books - Ansichten
...über Bücher und Autoren
facesofbooks.de - das nachhaltige Buchportal
We love slow-writing and slow-reading
Herzlich willkommen auf meiner Website, die sich mit Büchern beschäftigt. Facesofbooks zeigt das Gesicht der Bücher und Autoren. Beachtet Titel und Covergestaltung, Aufmachung des Buches, berichtet über den Inhalt, stellt den Autor in kurzer prägnanter Form vor. Wir veröffentlichen Autoreninterviews, bieten Informationen über Bücher von heute und Bücher von gestern, die wichtig sind, aber nicht vergessen werden sollen. Sie finden Tipps, Rezensionen, Kurz-Kritiken, Neuigkeiten über Verlage und Autoren. Geben Sie uns auch Hinweise, was Ihnen gefällt oder mißfällt. Eine Website für Lesefans auch aus der digitalen Bücherwelt. www.facesofbooks.de
Herzliche Grüße,
Norbert Schreiber
Sonntagsmatinee - Literatur aus Tschechien
Multimdia-Präsentation im Schloß Buchenau
Neues aus Ost und West - eine Reportage
35 Jahre nach der Wiedervereinigung reist August Modersohn quer durch Deutschland: von Duisburg bis Görlitz, von Rügen bis Freiburg. Er begegnet glücklichen Menschen, deren Zuhause für die Braunkohle weggebaggert wurde, und trifft Leute, die sich wie Cowboys anziehen, aber nichts mit den USA anfangen können. Was hat sich getan seit 1990, als Deutschland im Zentrum eines globalen Epochenbruchs stand? Und was bedeutet das für die Gegenwart, in der sich wieder vieles verschiebt?
Von "hirntod" bis aufgewacht: die NATO
Über zehn Jahre lang hat Jens Stoltenberg die Nato als Generalsekretär durch eine hochdramatische Zeit geführt. Die russische Invasion der Krim, der Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan, der Krieg in der Ukraine oder das zunehmend angespannte Verhältnis zu Russland und China – bei all diesen Entwicklungen hat Stoltenberg die Sicherheitspolitik des Westens seit 2014 maßgeblich mitgeprägt.
(PENGUIN)
Ulrich Raulff Wie es euch gefällt Eine Geschichte des Geschmacks
Jeder weiß, dass es ihn gibt. Jeder meint, ihn zu besitzen. Dabei hat ihn nie jemand gesehen: den Geschmack, unseren Sinn für das Schöne, Glücksantenne und Tastsinn unserer Sehnsucht. Ulrich Raulff erkundet diese Kompetenz für das Schöne und entführt uns in seinem furiosen neuen Buch auf einen materialistischen Jahrmarkt der Eitelkeiten, einen Parcours der Likes von Meissen bis Mac und von Diderots Hausrock bis Victoria’s Secret. (C.H.Beck)
Waldverdruss oder Woidlerliebe
Spiegelhütte
Wenn der Woidler den Bayerwaldblues hat, tief drinnen in seiner Seele, herrscht da dann ein etwas seltsames Gefühl zwischen sich elend fühlen und himmelhoch jauchzend vergnügt.
Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Bayerwoidler singt das Lied vom “Weltverdruss” und versinkt damit noch tiefer ins Elend der Welt oder, damit die Stimmung wieder besser wird, ertönt die
Bayerwaldhymne “Der Woid is schee.”
Variante 1 Elend
I hab koan Muater mehr,
und a koa Vater mehr,
koa Schwester, Bruader
und koan Freund.
Bin ein verlassnes Kind
so wi da AlmaWind,
i bin der Weltverdruss,
so hams mi gnennt.”
Variante 2 Lebensfreude
Mir san vom Woid dahoam
Mia san vom Woid dahoam, des kennt a jeder glei,
wann 's von den Bergen hallt, do san ja mia dabei
und wo des Stutzerl knallt, do san ja mia um d' Weg,
mia san vom Woid dahoam, da Woid is schee.
Es ist immer ein Schwanken zwischen tief empfundener Melancholie, rasender Traurigkeit und lähmender Niedergeschlagenheit, wenn es um die ausgeprägteste Form geht. Dann klingt es so traurig wie wenn
Amerikaner singen “I feel blue, oder besser I feel BLUES.
In der Veriante “...is schee…” gehts dann “scherzend, lustig bewegt” “scherzando” oder stürmisch “forte” oder eben nur heiter “sereno” zu, wie es in der Musiksprache heißt. Diese Auf- und ab-der-Gefühlswelten, am ehemaligen Grenzzaun zwischen Ost und West gelebt, hat der Autor und Politikwissenschaftler Alexander Straßner lebensnah, auffallend ehrlich und offen, mit viel Humor auch melancholisch als eine einzige Liebeserklärung formuliert, die auf fast 300 Seiten nicht nur der Geschichte eines Gefühls und einer Kindheit nachspürt, sondern auch einen gesamten Landstrich im hintersten Winkel des Bayerischen Waldes, abgeschieden liegend aber paradiesisch porträtiert; von Feriengästen heimgesucht, die auf die Waldler treffen, die ihre “unverhandelbare Originalität”, also ihre spezielle Eigenart behalten haben.
Wenn sie diese Rezension lesen, lassen sie Vorsicht walten, denn ich bin der Nachbar von diesem Wirtshaus, von dieser Familie, und so könnte es durchaus sein, dass mein Blick von meinem Fenster aus
auf das turbulente Leben dieser Kindheit von Alexander Straßner etwas subjektiv gefärbt ist. Ich bemühe mich aber auch um Ehrlichkeit, wie der Autor selbst.
Der Menschenschlag in dieser Landschaft, zwischen grün bewaldeten Bergen, harten Wintern in eisiger Abgeschiedenheit lässt in sich ein Lebensgefühl von Grant und Wurschtigkeit entstehen, die Menschen
sind maulfaul, lassen auch das Boshafte raus, nennen ihre Gäste Fremde, leben innig verbunden mit der zuweilen brutalen Natur, die Gewitter erzeugen kann, dass einem wirklich angst und bange
wird.
Die Waldler gehen gerne in die Pilze, sammeln stundenlang Waldfrüchte, verarbeiten sie zu Marmeladen und hegen ansonsten, trotz intensiver Naturverbundenheit, einen gewissen bayerischen Urgrant gegen
alles ökologisch grün Gefärbte oder politisch von außen Aufgedrückte. Etwa Nationalparke! Der Woidler ist Freigeist.
Im einst verschlafenen Walddorf Spiegelhütte ist der Autor aufgewachsen, im direkten Schatten der zweithöchsten Erhebung des Bayerischen Waldes, des Großen Falkensteins.
Nicht weit weg von der ehemaligen tschechischen Grenze erlebte Straßner eine Kindheit in einer turbulenten Touristenpension, die später zu einem allseits beliebten Wirtshaus wurde, in dem es
legendäre bayerische Speisen gab, so zubereitet von der Mutter Anneliese Straßner, dass alle beim Zahlen sagten: “Mei woar des guat!”
Das sollte als äußerster Ausdruck eines wohlgemeinten Kompliments heißen, dass da so gekonnt gekocht wurde, wie zu Uromas Zeiten.
Die Kehrseite der Medaille war, dass es einem Kind zwischen diesem Touristengschwerl, wie der Autor schreibt, oftmals befremdlich wurde, komisch vorkam oder auch absolut schockierte. Zum Beispiel,
wenn der Alkohol in Strömen fließt. Und geschnapselt wurde.
Dabei entsteht in der Erinnerung ein seltsames Paradoxon, was der Autor früher lustig fand oder großartig, befremdet ihn heute, was abstoßend war, interessiert ihn nun.
So schreibt Straßner intensiv, klar, wortgewandt eine kleine Milieugeschichte der Woidler, die im Zwieseler Winkel in einem Waldmeer leben, in einem ehemaligen Glasmacherdorf, in der Nähe der
„Jungmaierhütte“ und dem Hirschgehege “Scheuereck”. Dieses Buch gehört zur Memoir-Literatur: es sind schriftliche Lebenserinnerungen, in denen eine Person ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus der
Vergangenheit festhält für die Nachwelt.
Das alles ist eine eigene Realität, ein ureigener Kosmos, ja sogar mit eigener Wetterlage, speziell nur über dem Himmel des Dorfes. Mal Sonnenschein über den Häusern und rundherum dunkle
Gewitterwolken, oder umgekehrt.
Mal schlägt der Blitz ein, Vater Mutter und Kind liegen am Boden, wundern sich über die Allmacht der Elektrizität, stehen wieder auf und mit einem Stamperl “Bärwurz” werden die strapazierten Nerven
wieder zurechtgerückt.
Die Einheimischen wehren sich gegen die Einordnung, sie seien schlimmste Provinzlinge, und machen dem Touristen oft genug klar, dass er sich nach seinem Aufenthalt im Wald auch bald wieder schleichen
soll, denn “Mir san mir” und “mir bleiben aa soo, so wie mir san.” Man könnte es als „konservativ” bezeichnen, andere nennen es “die fortschrittlichste Lebensart, die möglich ist…
“Man bekommt den Woidler zwar aus dem Wald, aber den Woid niemals aus dem Waldler.”
Straßner beschreibt diesen Menschentypus als einerseits geistreich, andererseits aber auch derb im Humor, von einer seltenen Hinterfotzigkeit, die Urgestalten sprechen eine bildreiche Sprache, die
oft genug der Fremde nicht versteht, weil er eben der Fremde ist und bleibt, mit einem bunten Sammelsurium verbaler und meist lautetmalerischer Gemeinheiten konfrontiert, die das Gegenüber, der
“Preiß” oftmals eher als Liebeserklärung missversteht, denn als handfeste Beleidigung.
Der Woidler ist nicht redselig, sondern eher maulfaul. Aber wenn nicht, dann immer direkt raus!
Wir schauen mit dem Autor gemeinsam in die heimische Küche, dort wo sich auch die bayerischen Fernsehköche sicher wohl gefühlt hätten, denn da gab es original einheimische Speisen nicht nach
betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen gekocht. Die Straßnerin kochte “pi mal Daumen”, also alles frei Schnauze, aber stets erfolgreich, aber immer mit böhmischen Knödeln. Auch die Zwetschgen-
oder Marillenknödel und die berühmten Buchteln mit Vanillisoße machten den durch Wanderungen oder Skifahrten abtrainierten Speck wieder zu einem Feedback Phänomen. Dann brachte es einen „Werner“, den
Forsthaus-Stüberl-Geist.
Wenn ich irgendwem erklären musste, wo ich wohne, musste ich nur sagen, gegenüber der Straßnerin, woaßt schoo, die Schweinsbraten-Straßnerin. Das reichte.
Der Straßner war das Gegenteil von Gleichmut, der etwas leicht reizbar war, politisch gerne zum Streit aufrief, sensibel wie ein Erdbeben- Seismograph, von überschäumender Sentimentalität geprägt,
geistreich argumentierend, aber zuweilen auch cholerisch oder mürrisch missgelaunt.
Das alles erzählt Sohn Straßner sehr, sehr offen und liebevoll. Der Autor macht das heimische Brauchtum fleißig mit: das “Wolfsauslassen”, das “Ratschen” und das “Christkind Einsingen”, und so wird
nach und nach der Bayerische Wald ihm wirklich zum zu Hause, was der Autor aber erst in der Fremde für sich endgültig entdeckt.
Als Politikwissenschaftler geht er an die Unis nach Passau, Regensburg, Wien und Zürich und spürt dort, dass das Dorf Spiegelhütte mit dem einfachen Leben und der Herzenswärme der Menschen dann doch
seine wirkliche und endgültige Heimat ist.
So ganz nebenbei erzählt der Politikwissenschaftler, der mit dem Fan-Schal des VfB Stuttgart auch seine Fußballfreude zeigen kann, den inneren Betrieb der Verwaltungsakte in den Hochschulen, denn da
geht es nicht nur um Forschung und Vorlesung, sondern vor allem um verschultes Lernen.
Zwar empfindet der Autor die freie Einteilung der Arbeitszeit eines Professors, mit exzessiven Freiräumen und gutem Gehalt als etwas Schönes, aber er erzählt auch humorvoll, dass ihm die
Gremiensitzungen eine Qual sind, dass die akademische Lehre manchmal keine Qualität mehr produzieren kann und die Studenten gerne Ihre Kreativität in die Erfindung von Ausreden investieren, wenn sie
zu Vorlesungen nicht kommen oder ihre Hausarbeiten nicht rechtzeitig abgeben können oder wollen.
Man hört diesen Bayerwald Blues buchstäblich, wenn man Zeile um Zeile liest, und so kann ich dem Autor und allen Lesern nur bescheinigen, dass mit der Schließung dieses wunderbaren Wirtshauses, mit
seinen Stammtischen, musikalischen Treffen, Erzählungen von Bayerwaldgeschichten, Witze-palaver-runden, ein wirklicher, echter, wahrhafter Kulturverlust einhergeht, eben seit die Wirtshaustüren
aus Altersgründen endgültig geschlossen wurden und auch, weil der Autor mit Familie und Kindern inzwischen eine neue größere Heimstatt brauchte.
So empfinde auch ich als pfälzischer Preuße, Nachbar und Freund der Familie den “Bayerwaldblues” genauso wie der Autor selbst, der nicht besser zusammengefasst werden kann als in zwei bayerischen
Sprüchen, natürlich in Mundart: „Aus is und gor is, und schod iis, dass wohr iis“. Und „Des iis a bissl wia Sterbn!“ Da haben wir ihn wieder den “Waldverdruss”. Wird Zeit, dass wir anfangen zu
singen: “Der Woid iss schee.”
Alexander Straßner
Das Wirtshaus im Woid
Buchpräsentation: Der Termin für die Buchvorstellung ist am 28. März um 18:00 Uhr. Schloß Buchenau Norbert Schreiber im Gespräch mit dem Autor
Dichte Dichter - der Rausch in der Literatur
dichterwald - das neue Literaturhaus im Freiluft-Museum Finsterau
Die Literaturgeschichte aus "finsteren Zeiten"
Die Herrschaft der Nationalsozialisten bedeutete für die deutschsprachige Literatur eine beispiellose Herausforderung. Zweieinhalbtausend Autoren, darunter die besten, mussten Deutschland verlassen.
Wer blieb und sich nicht auf die Seite des NS-Regimes stellte, war von Verfolgung bedroht. Trotzdem entstanden Werke von großer zeitgeschichtlicher Repräsentanz und hohem literarischen Rang. Helmuth
Kiesel hat die erste Gesamtdarstellung der Epoche aus einer Hand geschrieben. Sie erschließt ein riesiges literarisches Feld zwischen Regimetreue und Exil und vermittelt ein bewegendes, oft
erschütterndes Bild jener Zeit. (C.H.Beck)
Das Buch für Fussbalfans
Carlo Ancelotti Mit Chris Brady
DER TRAUM
Wie man die Champions League gewinnt C. Bertelsmann
Der italienische Fußballtrainer Carlo Ancelotti ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. Nach seinem Bestsellererfolg „Quiet Leadership“ (2016), in dem er seine Führungsphilosophie als
Fußballmanager anekdotenreich schilderte, erzählt der Star-Coach in seinem aktuellen Buch „Der Traum. Wie man die Champions League gewinnt“, wie es zu diesen Erfolgen kam – und warum sich der Fußball
seiner Ansicht nach gar nicht so sehr vom Rest des Lebens unterscheidet. C.Bertelsmann
REZENSION
Er schaut auf dem Coverbild so energisch drein, als wolle er noch einmal die Champions League gewinnen. Zum dann achten Mal. Carlo Ancelotti, selbst einst Mittelfeldspieler beim AS Rom und beim AC Mailand, legt sein gesammeltes Bekenntnis vor, wie er in fünf verschiedenen Landesligen Meister wurde und sieben Mal Erfolg im Champions League-Wettbewerb hatte, also in den wichtigsten Wettbewerben des europäischen Fußballs.
Inzwischen trainiert Ancelotti die Nationalmannschaft Brasiliens. Erfolgreicher kann ein Fußballtrainer nicht sein, auch wenn er beim FC Bayern nicht glücklich wurde. Das liegt vielleicht auch am
Verein und weniger an ihm.
Ancelotti erzählt seinen Traum, weist aber auch bescheiden daraufhin, dass man in der Regel die Champions League meistens nicht gewinnen kann. Auch aus Niederlagen zieht er gute
Lehren. Carlo hat die ganz Großen des Fußballs trainiert: Beckham, Lewandowski, Ronaldo, Zinedine Zidane und viele andere. Dabei stand er meist mit verschränkten Armen sehr, sehr ruhig am
Fußballfeld, ohne eine Miene zu verziehen.
Das Buch ist eine Beschreibung seiner vielen Fußballspiele, die er als Trainer bestritten hat. Man muss sich also als Leser an einen Ergebnisdienst und Spielverlauf im Buch gewöhnen.
Dass er ein großer Verehrer der Viererkette ist, also der Formation 4 4 2, verrät er ebenso als offenes Geheimnis, wie, dass er in seinem Wesen einerseits Geschäftsinteressen in sich hat und
andererseits sein Herz sich eben auch für Fußball erwärmt. Er warnt aber allerdings auch davor, dass man es mit der Loyalität übertreiben könne. Mitunter setzt er seine Präsidenten unter Druck, dass
sie genügend Geld ausgeben, um an die Größen im Fußball zu kommen. Eine seiner Lehren ist, unterschätze in Ko-Spiel niemals den Gegner. Manchmal müsse man auch die Spielerberater links liegen lassen
und zuweilen ist er auch nicht glücklich, wenn sich die Präsidenten der Clubs auch in der Kabine herumtreiben. Eigentlich Tabuzone, manchmal verirren sich auch Kanzlerinnen dorthin.
Es kommen in dem Buch auch Spieler-Genossen zu Wort. Eines ist jedoch für ihn klar, er ist sich nie sicher, wie lange er als Trainer bei einem Verein bleiben soll. Und: Kommunikation ist für ihn
alles. Wenn er mal zornig wird, benutzt er seine Muttersprache Ob Messi oder Modric, Manuel Neuer oder Ronaldo, alle tanzten sie nach seiner Pfeife. Dabei ist er in dem Buch auch selbstkritisch und
folgt dem Satz: Hüte dich vor Selbstgefälligkeit, glaube niemals die Sache wäre entschieden, lasse nicht zu, dass der Gegner Morgenluft wittert.
Sein Abschied vom FC Bayern empfand er als die rücksichtsloseste Entlassung seiner gesamten Karriere. Da wähnt er sich dann im „Club der entlassenen Trainer“. Hat er eine, seine Philosophie: Er
glaubt nicht an Philosophien, er glaubt an die Identität der Mannschaft, deshalb hört er auch auf seine Spieler, was sie ihm sagen, und es ist immer hilfreich, wenn man die Spielweise des Gegners
kennt.
Ein farbiges Fußballbuch, im spielerischen Vorwärtsmodus mit dem Ball geschrieben, das auch dem modernen Trainer was mit auf den Weg gibt: Sie bombardierten ihre Spieler mit so vielen Anweisungen,
lässt er Jude Bellingham zu Wort kommen, sie benähmen sich fast wie Puppenspieler.
Sieben Mal gelang es ihm, die Champions League zu gewinnen. Jetzt empfindet er es als eine wunderbare Herausforderung, mit Brasilien wieder Weltmeister zu werden. Wie sagte dereinst
Beckenbauer: Schau-mer-mal. Wer sich kein Eigentor leisten will, sollte dem Fußballfan dieses Buch unter den Christbaum legen. Als Fan-Vorbereitung für die WM.
Carlo Ancelotti, 1959 in Reggiolo in der Region Emilia-Romagna geboren, begann seine Karriere als Mittelfeldspieler beim AS Rom und beim AC Mailand. Seit Juni 2025 ist Carlo Ancelotti Nationalcoach Brasiliens.
TIPP 2 »Jungfrau Maria, verjage Putin!«
Die Lebensgeschichte einer der wichtigsten russischen Dissidentinnen 2012: Mit ihrem Punk-Gebet »Jungfrau Maria, verjage Putin« in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale schreien Maria Aljochina und
ihre Mitstreiterinnen von Pussy Riot eine Warnung vor den Gefahren des russischen Autoritarismus in die Welt hinaus. Für ihren Mut zahlen sie mit Gefängnis. Nachdem Maria zwei Jahre später im Rahmen
einer Amnestie vorzeitig aus der Haft entlassen wird, ist das Land noch repressiver geworden. - Innenansichten aus dem heutigen Russland von einer mutigen jungen Frau - Als der Krieg gegen die
Ukraine beginnt und die russische Opposition zum Schweigen gebracht wird, protestieren sie und ihre Freunde weiter. Vor einer erneuten Gefängnisstrafe flieht Maria 2022 aus Russland – verkleidet als
Essenslieferantin.
Ein ergreifendes Dokument von ungeheurem Mut, Kreativität und Menschlichkeit. -
Ein leidenschaftlicher Aufruf zu gewaltfreiem Protest gegen autoritäre Herrscher -
Was kann man tun, wenn das Heimatland von allmächtigen Männern beherrscht wird, die Krieg gegen ein anderes Land und die eigene Bevölkerung führen?
»Ich schreibe dies, um nicht zu schweigen, nicht darüber zu schweigen, was ich in meiner Heimat gesehen habe, in dem Land, das ich liebe – brutal, herzlich und abstoßend zugleich. Mit endlosen
Diktaturen, mit Priestern, die Blut an den Händen haben, mit mutigen Frauen, die sich gegen das Regime auflehnen. Ich möchte uns retten – damit wir neue Abenteuer erleben können. Damit eure und
unsere Freiheit endlich zum Leben erwacht.« (Berlin Verlag)
REZENSION
Es gibt nicht mehr viele Organisationen, Initiativen oder auch Personen, die in Opposition zu Wladimir Putin stehen. Verbote, Gefängnisstrafen, Auflösung von Organisationen und Vereinen,
elektronische Fußfesseln, Gulagaufenthalte bis hin zu Morden, haben der politischen Opposition in Russland den Atem genommen.
Schon 2012 machte die künstlerische Aktionstruppe „Pussy Riot“ auf sich aufmerksam, in dem sie in der Moskauer „Christ Erlöser Kathedrale“ ein Punkgebet aufführen. Motto „Jungfrau Maria verjage
Putin!“
Es sollte eine Warnung vor den Gefahren des russischen Autoritarismus sein.
In diesem Buch „Political Girl“ beschreibt Maria Aljochina das Leben und Schicksal in Putins Russland als Aktionskünstlerin. Diktatur von unten betrachtet.
Man könnte das Buch als Tagebuch bezeichnen, denn in einzelnen, kurzen Kapiteln lesen wir eben, was jeweils geschieht und in kurzen Sätzen wird dies politisch sprachlich prägnant eingeordnet.
Schon im ersten Kapitel mit der Überschrift „Putin wird dich lehren das Vaterland zu lieben“ heißt es, „Putin: ein russischer Diktator“. Wegen ihrer Schreie nach Freiheit wird die Aktionistin
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Immer wieder geht es der Autorin um den Freiheitsbegriff.
Sie schildert den alltäglichen Wahnsinn der Unterdrückung, die Verfolgung durch die Geheimdienste, die polizeilichen Operationen, die Überwachungskontrolle, die missbrauchten Rechte von Gefangenen,
die angewandte Folter.
Es fallen klassische Sätze wie, „Es gibt immer eine Wahl, eingreifen oder vorbeilaufen“.
Es sind aufeinanderfolgend ganz kurze Szenen, die in fünf, sechs Sätzen beschrieben werden und immer sich zu einer knappen politischen Aussage zuspitzen.
Dazwischen eingestreut auch Zitate von handelnden Personen. So ist etwa interessant, dass Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees über Russland sagt: „Jeder Mensch mit
unvoreingenommenem Blick konnte das Gesicht eines neuen Russlands sehen, effizient und freundlich, patriotisch und weltoffen.“ Medaillenverdächtig, aber in Blech! Putin-reinwashing zu den
Winterspielen.
Da läuft es einem wie im Eiskanal eiskalt den Rücken runter. Zur Ukraine heißt es: „Die Ukraine entscheidet sich ihr sowjetisches Erbe zugunsten eines europäischen Weges aufzugeben, die Ukraine
weigert sich, Russland in die Vergangenheit zu folgen.“
Und genau das ist für Putin unverzeihlich.
Entführen, foltern, töten ist in Russland an der Tagesordnung.
In diesem Buch geht es zu wie in einem schrecklichen Film. Kamera startet, Aufblende, die Szene wird geschildert, harter schneller Schnitt, keine Abblenden, nächste Sequenz, direkt
hintereinander folgt die nächste Szene. Gleiches Muster.
Das gibt dem Buch eine dramatisch Dynamik. Die Wortwahl, auch in den Überschriften ist oft sehr einfallsreich. So heißt es z. B „Stacheldraht, Religion oder Referendum mit vorgehaltener Waffe“ oder
„Schuss ins Herz“ - klare Sätze!
Putin braucht den Krieg als Idee, weil Menschen im Krieg nicht wirklich leben, sondern nur noch überleben.
Zu den Russen heißt es: Das Sofa, auf dem die Russen sitzen, ist zu bequem geworden.“
Und deshalb steht keiner mehr auf. Ein beeindruckendes Buch, eine Chronologie des Terrors, ein Kaleidoskop der Unfreiheit, ein glaubhaftes Dokument über den Einsatz von Künstlern, die mit Fußfesseln
in ihrem demokratischen Engagement ausgebremst werden sollen oder im schlimmsten Fall mit Knast oder gar Gulag bestraft werden. Auch, was dort passiert wird beschrieben. Auch Alexander
Solschenizyn könnte erneut zur Feder greifen. Am Ende blieb Maria Aljochina nur die Flucht in den Westen übrig.
Ein Buch, das man den Putinverstehern, den Unterhändlern in Genf, Donald Trump, Marco Antonio Rubio, besonders aber Steve Witkoff unter den Christbaum legen sollte.
Maria Aljochina Political Girl PUSSY RIOT Leben und Schicksal in Putins Russland Berlin Verlag
Maria (Mascha) Aljochina ist eine russische Konzeptkünstlerin und politische Aktivistin. Sie ist Mitglied des Kunstkollektivs Pussy Riot. Im August 2012 wurde sie
nach einer Anti-Putin-Performance in der Moskauer Erlöser-Kathedrale zu zwei Jahren Haft verurteilt und im Dezember 2013 nach einem Amnestiegesetz von Amnesty International freigelassen. Im März 2014
gründeten Maria Aljochina und Nadja Tolokonnikowa Sona Prava, ihre NGO für Gefangenenrechte. Aljochina ist Trägerin des Lennon Ono Grant for Peace und wurde mit dem Hannah-Arendt-Preis
Das Buch zum Film: Hark Bohm AMRUM
Romanverfilmungen sind immer so eine Sache: Kennt man das Buch bereits, ist man vom Film oft enttäuscht, denn er kann zwar die Bilder liefern, die man als Leser im Kopf hat (und die oft ganz anders
aussehen als später im Film!), aber die ganze Tiefe, Ausführlichkeit und die Details des literarischen Textes gehen meist unter. So stellt man sich die Frage: Lohnt sich nach der Lektüre noch der
Kinobesuch - oder nach dem Film noch die Lektüre?
Aktuell ist dieses Thema jetzt gerade wieder bei “Amrum”, dem autobiographischen Roman des Filmemachers Hark Bohm, der als Film von Regisseur Fatih Akin gerade in die Kinos kam, ein Jahr nach
Erscheinen des Buches. Das Buch lag, bis dahin ungelesen, bei mir, und ich nahm mir vor, es noch vor dem Kinobesuch zu lesen. Fazit vorneweg: Beide Werke sind lesens- und sehenswert, wenngleich etwas
unterschiedlich in verschiedenen Punkten.
Hark Bohm, der vor wenigen Tagen mit 86 Jahren verstarb, hat in “Amrum” eine ganz kurze, aber für ihn entscheidende Phase seiner Kindheit geschildert: das Erlebnis des Kriegsendes im Frühjahr 1945
auf der Nordseeinsel. Er lebt mit Mutter und jüngeren Geschwistern bei seiner Tante. Die Mutter ist überzeugte Nationalsozialistin, die Tante das Gegenteil.
Nanning Hagener, Bohms Alter Ego, ist verwirrt, liebt aber seine Mutter und will alles für sie tun, damit es ihr gut geht, denn sie erwartet ein weiteres Kind. Am Tag des Selbstmordes Adolf Hitlers
bricht ihre Welt zusammen, gleichzeitig setzen die Wehen ein. Kurz darauf rücken auf Amrum britische Truppen ein und alles verändert sich. Wie kommt ein 12jähriger Junge damit klar?
Im Buch wird detailliert das Überleben mit den kriegsbedingten Mängeln und der primitive Tauschhandel geschildert, Fische sind mangels Dollars “Amrum-Währung”, für Reichsmark gibt es schon nichts
mehr. Beziehungen und Freundschaften sind viel wert.
Man liest sehr schnell und die Bilder entstehen im Kopf: das Meer mit Ebbe und Flut, der Weg durchs Watt rüber nach Föhr. Und der Blick weitet sich bis nach Amerika, denn viele Amrumer haben
Verbindungen nach New York, wohin einst viele Inselbewohner ausgewandert sind. Amrum ist also überall und “amerikanische Amrumer” haben im Krieg auch gegen einheimische Amrumer gekämpft. Und erneut
träumen jetzt manche, so auch Nanning, von einer Zukunft ganz woanders.
Hans Erwin Riemann
Hark Bohm, Philipp Winkler
Amrum Ullstein
Blinkende Türme - Zeugen der Vergangenheit
Wäre es nicht schön, wenn man Leuchttürme sammeln könnte? Die Schriftstellerin Jazmina Barrera erinnert sich in ihrer engen New Yorker Wohnung sehnsüchtig an all die Küsten, die sie besucht hat. Leuchttürme haben sie schon immer fasziniert, stehen sie doch für das Abenteuer und die Sicherheit, das Reisen und das Ankommen zugleich. Und das tun sie schon beinahe, seit es Menschen gibt – der Leuchtturm von Pharos zählte zu den Sieben Weltwundern der Antike. In ihren Gedanken nimmt uns die Autorin mit zu all den Leuchttürmen, die sie besucht hat oder die ihr in der Weltliteratur begegnet sind, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Oder hätten Sie gewusst, dass der Großvater von Robert Louis Stevenson maßgeblich daran beteiligt war, die schottische Küste mit Leuchttürmen auszustatten? Und wie kam es, dass Virginia Woolf dem Leuchtturm in ihrem Werk einen so prominenten Platz gab? Ein literarischer Essay in hochwertiger Gestaltung für alle, die das weite Meer ebenso lieben wie das Nachhausekommen. (Dörlemann)
REZENSION
Die Autorin Jazmina Barrera teilt zwei Leidenschaften: die eine ist, sie sammelt Bücher, die zweite, sie besucht gerne Leuchttürme, in die sie sich verliebt hat, und so spürt sie denn auch in den
Werken, die sie liest, den Standorten der Leuchttürme nach. Navigationsbegeistert. Und so beginnt jedes Kapitel mit den genauen geografischen Koordinaten-Angaben. Die Detailinformationen, wie die
Leuchtphasen gestaltet sind, wie oft der Leuchtturm an und ausgeschaltet wird, und welche Art von Leuchtintensität er hat, das alles wird uns mitgeteilt.
Der Mensch hat halt seine verrückten Sammel-Leidenschaften.
Schon als junges Mädchen träumte sie von Leuchttürmen, sie entdeckt in Hermann Melvilles „Moby Dick“ eine natürliche Anziehung des Menschen zum Wasser, und so ist es nicht verwunderlich,dass man an den Stränden die dazu passenden Leuchttürme findet.
Die Menschen haben die Weltmeere erkundet, aber sie brauchten an den Küsten Orientierung, um Schiffbrüche zu vermeiden. Ob in Ostia bei Rom für das Römische Reich oder der Leuchtturm von Alexandria oder auch der Herkules Turm im galizischen La Coruna, die Türme gaben immer schon den Schiffen Navigationsinformationen.
In früheren Jahrhunderten wurden sie mit Brennholz oder Kohle betrieben, später auch mit Teer, noch später waren es Petroleum- oder Gaslampen, und als dann der Strom erzeugt wurde, konnte das Licht
meilenweit ins Meer hinausgetragen werden. Bei Virginia Wolf kommt ein Leuchtturm vor, Robert Louis Stevenson beschreibt, dass die Besichtigungen von Leuchttürmen wie „Besuche in vergangenen
Jahrhunderten“ sind. Ich selbst bin fasziniert von diesen Bauwerken an den Ost- bzw. nordfriesischen Inseln. Ich habe auch die alten Leuchttürme der irischen Insel aufgesucht.
„Das Meer ist permanente Bewegung, der Leuchtturm ist ein eingefrorener Wächter“, heißt es in dem Buch.
Als die Autorin dereinst im Zimmer von Edgar Allan Poe nächtigt, weiß sie noch nicht, dass dieser Autor von Gespenstergeschichten eine Story über einen Leuchtturmwärter geschrieben hat, sie jedoch
nie vollendete.
In den Leuchttürmen wechselten sich dereinst die Wärter in Schichten ab. Wir erfahren in dem kleinen Büchlein, dass einige auch an Flüssen stehen können, zum Beispiel am Rhein, an der Seine oder am
St. Lorenz Strom und auch am Hudson River.
Aus manchen Leuchttürmen, die nicht mehr betrieben werden, wurden Vogel-Beobachtungsstationen.
Jules Verne beschreibt in seinem Roman einen Leuchtturm am Ende der Welt, der hat nämlich seinen Schauplatz am entlegensten Punkt des Kontinents in Argentinien. Es ist die Geschichte eines
Leuchtturmwärters, der seinen Arbeitsplatz verlassen muss, weil Piraten den Leuchtturm eingenommen haben.
Die Autorin hat Romane, Kinderbücher und Essays auf Spanisch veröffentlicht, mit diesem Werk hat sie den Leuchttürmen, die Denkmäler der Vergangenheit sind, als gps-analoge Zeugen von gestern, selbst
ein leuchtendes, lebendiges Denkmal gesetzt.
Es darf als Präsent unter die Tanne gelegt werden an Weihnachten, denn an den Feiertagen soll es ja helle leuchten, für alle diejenigen, die das Meer lieben, die Gewalt der Wellen, das
Wilde von Küsten, verlassene Denkmäler der Vergangenheit und Freunde der Navigation, also auch für Segelenthusiasten und Freizeitkapitäne durchaus geeignet.
Jazmina Barrera wurde 1988 in Mexiko-Stadt geboren, wo sie auch heute lebt. Sie ist Mitgründerin der Ediciones Antilope. Nach ihrem Studium an der New York University widmete sie sich dem Schreiben. Sie hat bereits mehrere Romane, Kinderbücher und Essays auf Spanisch veröffentlicht, die zum Teil in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Ihr Buch Leuchttürme, das auch auf Englisch erschienen ist, wurde u.a. für den von Rezzori-Award nominiert.
Als Putin im Februar 2022 die Ukraine angreift, steht die Welt unter Schock. Dabei ist dieser Krieg von Geheimdiensten präzise vorausgesagt worden. In einer aufsehenerregenden Recherche enthüllen Katja Gloger und Georg Mascolo, wie die Verantwortlichen über Jahrzehnte Warnungen ignorierten und kritische Stimmen in der deutschen Russlandpolitik ausblendeten.
Anhand von zahlreichen Geheimdokumenten und Gesprächen mit Dutzenden Zeitzeugen erzählen sie eine atemberaubende Geschichte: über die wahren Hintergründe der umjubelten Putin-Rede im Bundestag und
einen Back Channel in den Kreml, der im früheren Leben Stasi-Spion war. Über ein Geheimdossier des Auswärtigen Amts, das schon 2007 einen bewaffneten Konflikt um die Krim und den Osten der Ukraine
beschreibt – und im Archiv landet. Sie offenbaren die Details einer unerklärlich engen militärischen Zusammenarbeit – und warum Putins nukleare Drohungen einen Bundeskanzler um die halbe Welt reisen
lassen. ULLSTEIN
Man hätte das Buch auch gut und gerne anders nennen können, statt DAS VERSAGEN, genauer: DIE VERSAGER! Das Autoren-Paar, im Privatleben miteinander verheiratet, listet in seinem Buch eine hoch
spannende, gut recherchierte, ausgezeichnet geschriebene Geschichte des Versagens und der Versager auf. Warum wollte niemand sehen, wer Genosse Putin wirklich war und wie er wirkte? Erstens
vernebelte uns das russische Billiggas die Hirne, zweitens umgarnte Putin mit seinem KGB-Charme die westlichen Eliten mit List und Geld, drittens hatte die Russlandpolitik grundsätzlich ein
Wahrnehmungsproblem, viertens wollte niemand die Krim-Invasion härter beantworten, fünftes tat Angela Merkel, was sie gerne tat, eben nichts, fünftens wollte die SPD immer noch die
„Friedens-Dividende“ einheimsen, obwohl längst konkrete Putin’sche Kriegstreibereien im Gang waren.
Aber der Reihe nach:
Das Buch ist da besonders spannend, wo aus Geheimpapieren zitiert wird, die immer noch unter Verschluss sind, da wo Augen- und Ohrenzeugen den Mund aufmachen, den sie vielleicht andernorts gehalten
haben, da wo das Buch geradezu kleinteilig präzise in die Details geht, ohne im Text die Spannungsbögen zu verlieren.
Ausgehend von Putins Satz im Reichstag „Russland ist ein freundlich gesinntes europäisches Land“ entzaubert das Autorenpaar von Seite zu Seite (es sind 496 Seiten) die GORBI-Euphorie bis zum
Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Träume und Traumata der unrealistischen deutschen Russland Politik. Wir blicken mit dem beiden Journalisten hinter die Kulissen und erfahren, dass die
Reichstagsrede von Putin ausreichend gefüttert und angereichert wurde von westlicher Seite. Teltschik und Co gaben dem Präsidenten der Russischen Föderation zahlreiche Hinweise, was man im Bundestag
von dem Redner erwarten würde, da reichte der direkte Draht in den Kreml nicht aus, persönliche Gespräche von Gesicht zu Gesicht wurden bevorzugt. Ergebnis: An den Problemen selbst
mitgestrickt.
Übrigens, wenn Putin ungeduldig wird, sehr oft passiert das, wechselt er von der russischen Sprache ins Deutsche, dann doziert er gerne, Putin hört nicht gerne zu, heißt es. Dialogunfähig?
Spannend auch, dass die Autoren den Dialog zwischen Scholz und Putin vor Kriegsbeginn genauestens nachzeichnen. Schulz fragt nach militärischen Maßnahmen, Putin bleibt vage: „Das hängt von der Lage
ab“. Scholz zeigt seine Besorgnis und fragt: „Wie soll es weitergehen?“ Putin lügt mal wieder und sagt: „Dialog ist aber möglich, wir wollen keine Kampfhandlungen.“ Scholz zeigt
sich enttäuscht und sagt: „Kampfhandlungen gilt es zu verhindern“, das sei ein brenzliger Moment. Putin retourniert: „Ich teile Ihre Besorgnis, wir bleiben in Kontakt“. Da haben wir ihn wieder
den „Täuscher“.
Dass in Russland der Geheimdienst die Macht übernommen hatte, wurde geflissentlich übersehen, die NGO s wurden nach und nach als Agenten diffamiert und verbotenen - auch Memorial. Die Repressionen
nahmen von Jahr zu Jahr zu.
Während in Deutschland sich noch niemand traute, Putin einen Autokraten, geschweige denn einen Diktator zu nennen, notierten Verfassungsschützer schon 1999, Putin bediene Vorurteile und
Argumentationslinien aus den schlimmsten Zeiten. Putins Haltungen und Einstellungen seien gekennzeichnet durch: Großrussentum, Nationalismus, Zynismus. Ein Berufsdiplomat notiert zu Putin
“hochintelligent, hart, skrupellos, kalter, entschlossener Operateur.“
Ein Botschaftsmitarbeiter diagnostiziert: alle Indizien sprechen dafür, dass uns Putin sehr früh getäuscht hat und sich viele von ihm täuschen ließen. Besser kann man es nicht
zusammenfassen.
Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter in Moskau, sagt Putin fixiere seine Gegenüber, seine Ausführungen würden schneidend, anklagend, scharf bis hin zu groben Äußerungen.
Verfassungsschutz und BND wissen schon früh von Beeinflussungsaktivitäten, die darauf abzielen, Uneinigkeit innerhalb der EU und Deutschland zu schüren, damit die Machtpositionen zu schwächen und zugleich die Bindung zwischen der EU und den USA im Hinblick auf die NATO zu schwächen. Schon im KGB gab es die Bezeichnung für die westlichen Beeinflussten, sie seien „nützliche Idioten“.
Die falsche Einschätzung war, dass sich Russland eben seine geopolitischen Machtansprüche nicht durch die Gasgeschäfte würde abkaufen lassen. Der Grundgedanke, politischer Wandel sei konstruierbar
durch ökonomische Integration, gilt inzwischen als das größte außenpolitische Versagen der Bundesrepublik Deutschland.
Während Frau Merkel Irrtümer nicht eingestehen will, sagte Wolfgang Schäuble: „Ich lag falsch, wir alle lagen falsch, wir wollten es nicht sehen“, auch Sigmar Gabriel tritt mit „mea
culpa“-Attitüde auf, Steinmeier auch etwas selbstkritisch, von Frau Schwesig hört man wenig, und auch die Wirtschaftsmagnaten der Bundesrepublik hüllen sich in Schweigen - gasbetäubt.
Dass das Thema Nord Stream 2 die westliche Allianz, aber auch die osteuropäischen Partner total irritiert hat, wird minutiös aufgelistet.
In Moskau hatte Putin mit dem Ehepaar Schröder eine historische Schlittenfahrt unternommen, so fährt man später mit der ganzen deutschen Politik sinnbildlich „wieder Schlitten“.
In den Schlusspassagen des Buches wird diskutiert, ob eine frühere, bessere, fundiertere militärische Ausstattung der Ukraine den Krieg vielleicht von Anfang an hätte verhindern oder verkürzen
können, da werden die Positionen dazu zwar aufgeschrieben, aber die Autoren trauen sich dazu ein eigenes Urteil nicht zu.
Im Buch kommt der Bürgermeister Werner Schulz zu Wort: Der frühere DDR - Bürgerrechtler Werner Schulz, der in einem offenen Brief gesagt hatte, deutsche Politiker hätten Putin wie einen „Enkel
Gorbatschows“ gefeiert, ihn aber nicht als „Ziehsohn des KGB“ erkannt.
Werner Schulz war schon anlässlich von Putins Rede im Deutschen Bundestag aufgefallen, weil er harte Kritik übte, indem er eine Verleihung eines Ordens an Putin kritisierte: „Da wird in purem Gold
der Diamantschliff für den von Gerhard Schröder so gelobten lupenreinen Demokraten überreicht“
Ich beschließe hier meine Rezension mit dem Schlusssatz: Ein großartiges Buch, eine fundierte Recherche, ein exemplarisches Beispiel für investigativen Journalismus!
Katja Gloger/Georg Mascolo DAS VERSAGEN Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik
--------------------------------------------------------------------------------
Doch um der historischen Genauigkeit Willen, möchte ich an dieser Stelle einige persönliche Bemerkungen hinzufügen, die ich sonst immer versuche, zu vermeiden.
Ich zitiere hier eine ganze Reihe von Autoren aus meinem 2008 erschienen Buch „Norbert Schreiber RUSSLAND Der Kaukasische Teufelskreis oder die lupenreine Demokratie WIESER Verlag Klagenfurt“ und
„Anna Politkowskaja Chronik eines angekündigten Todes“, 2007 erschienen. Warum tue ich das, weil es mehr Warner gab als Werner Schulz! Und das schon 2007!
Im Zuge des Vorschlags, die in Russland ermordete Journalistin mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels posthum auszuzeichnen, unterlag mein Vorschlag bei der Abstimmung mit 49 zu
51. Sie bekam jedoch danach auf unseren Antrag hin den Geschwister-Scholl-Preis in München verliehen.
Im Zuge dieser öffentlichen Debatte, wurden die Bedingungen in Russland in der Presse auch ausführlich debattiert.
Allerdings warte ich heute noch auf die Reaktion von „Reporter ohne Grenzen“, bei denen ich angefragt habe, ob sie einen Beitrag zu dieser öffentlichen Debatte leisten könnten.
Die Journalisten-Kollegen der „alten Schule“ Ruge, Pleitgen, Neudeck, Sager unterstützten den Vorschlag übrigens. Auch öffentlich! Inzwischen ist Katja Gloger, Vorsitzende dieses Vereins. Da wäre
vielleicht auch etwas aufzuarbeiten.
In dem Buch „Putins lupenreine Demokratie“ schreibt die Historikerin Margareta Mommsen, schon früh erkennend, von den 70 Prozent Geheimdienstlern in den Institutionen der russischen Politik.
Ja es stimmt: wir haben alle weggesehen, aber nicht wirklich alle, das sei um der historischen Wahrheit willen und nicht wegen irgendwelcher Eitelkeiten gesagt. Leider steht in dem Buch von Mascolo und Gloger davon nichts. Die Investigation hätte noch weiter genauer zurückgehen müssen, lange vor die Kriminvasion. Anfangs der 2000er Jahre!
Als der Krieg im Gang war, habe ich das pdf-Manuskript beider Bücher an 60 Redaktionen von Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, Talkshows und Korrespondenten verschickt, um dem Eindruck
entgegenzutreten, es habe keine Warner gegeben. Nicht eine einzige Reaktion. Auch die Presse wird einiges aufzuarbeiten haben.
VITA
Katja Gloger, geboren 1960 in Koblenz, beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Russland. Sie studierte Russische Geschichte, Politik und Slawistik in Hamburg und
Moskau und war Korrespondentin des "Stern" in Moskau und den USA. Heute arbeitet sie als Autorin des "Stern" in Hamburg.
Georg Mascolo, geboren 1964 in Stadthagen, ist ein deutsch-italienischer Journalist und Publizist. Er war von 2008 bis 2013 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Von 2014 bis 2022 leitete er den neu geschaffenen Rechercheverbund des NDR, des WDR und der Süddeutschen Zeitung. Außerdem war er für die ARD als Terrorismusexperte tätig.
Stimmen zum Buch
»Eine umfassende kritische Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte war überfällig. Das Versagen füllt die Lücke in brillanter Weise. Das Buch von Russlandexpertin Katja Gloger und ihrem Ehemann, Ex Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo, ist die absolute Muss-Lektüre für jeden, der sich für die hoffnungsvollen Zielsetzungen, Illusionen und idealistischen Irrwege unserer Außenpolitik interessiert.«
Wolfgang Ischinger, Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington und London
»Brillant recherchiert. Spannend erzählt. Dokument einer kollektiven Verdrängung.«
Thomas Roth, Journalist, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau und New York, Moderator der Tagesthemen
»Ein fantastisches Buch.«
Carlo Masala
»Ein Buch, das überfällig war – und soviel Neues enthüllt, wie kolossal das Versagen deutscher Russlandpolitik wirklich war. Katja Gloger und Georg Mascolo haben jahrelang recherchiert und offenbaren in allen Details, was seit Gerhard Schröder bis zur russischen Vollinvasion der Ukraine nicht gesehen werden wollte, obwohl es soviele Warnungen gab. Ein fesselndes Werk von Autoren, die sich auskennen, exklusive Zugänge haben und es großartig aufgeschrieben haben.« Paul Ronzheimer
Selten war ein Buchtitel treffender – und mit „Das Versagen“ sind Pleiten, Pech und Pannen der deutschen Russlandpolitik der vergangenen, man muss schon sagen Jahrzehnte, fast noch milde umschrieben. Speziell, wenn man an die Konsequenzen denkt. Das, was Katja Gloger und Georg Mascolo hier zusammengetragen, kenntnisreich analysiert und aus vielen, teils bisher nicht oder wenig bekannten Quellen recherchiert haben, ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie vorausschauende Politik nicht aussehen darf. THE EURPEAN
DOKUMENTATION:
Aus einem Gespräch von Norbert Schreiber mit Anna Politkowskaja 2005 geführt
„Was erwarten Sie in Bezug auf Ihre eigene Person, auch Sie sind ja gefährdet, auch Sie haben Morddrohungen, auch Sie müssen ständig mit einer Gegenwehr des russischen Staates rechnen?
Na ja, ich versuche nicht daran zu denken, weil ich ansonsten nicht arbeiten könnte, es wäre unmöglich. Also blende ich diese Gedanken aus und sage, dass ich einfach das Schicksal derjenigen teile, die dafür kämpfen, dass demokratische Prinzipien in Russland endlich installiert werden und das Leben ein demokratisches wird, wobei es möglich ist, dass dieser Kampf nicht gut ausgeht. Aber das ist dann einfach so.“
Anna Politkowskaja wurde am Samstag, dem 7. Oktober 2006 gegen 16:03 Uhr im Aufzug ihres Wohnhauses in der Moskauer Lesnaja-Straße durch mehrere Schüsse getötet. Vier Kugeln trafen sie in die Brust, eine in den Kopf, dokumentiert WIKIPEDIA.
Inhaltsverzeichnis aus dem Buch über Anna Politkowskaja
Einleitung Norbert Schreiber
Leben - Tod – Erinnerung - Chronik eines angekündigten Mordes
Anna Politkowskaja Tschetschenien -
Der Hass wird über die Ufer treten
Harald Loch
Der Tschetschenien-Krieg
Natalia Liublina David gegen Goliath -
Anna Stepanowa Politkowskaja - ein Porträt
„Also blende ich diese Gedanken einfach aus …“
Interview mit Anna Politkowskaja auf der Leipziger Buchmesse 2005
Irina Scherbakowa Russlands Gedächtnis
Vergangenheitsbewältigung als Beitrag zur Zivilgesellschaft
Anna Politkowskaja „Ungenehmigte Trauer“ -
Die Macht und die Menschenrechte
Fritz Pleitgen Mordversuch an Menschenrechten -
Bürgergesellschaft in Russland
Margareta Mommsen
Gorbatschow - Jelzin - Putin -
Von Gorbatschows Perestroika zu Putins gelenkter Demokratie
Harald Loch
Russland im Herbst -
Politkowskaja und ihre politische Literatur
„Die Personen aus meinem ersten Tschetschenien-Buch sind inzwischen alle tot“ Interview mit Anna Politkowskaja
Rupert Neudeck
Von Wladimir Putin und anderen „lupenreinen Demokraten“ -
Pressefreiheit in Staaten der Dritten Welt
Andrei Nekrasov
Das „coole“ Gespenst des Nationalismus geht um -
Ein Brief aus Russland
Anna Politkowskaja
In Kiew kann man Triebe sprießen lassen
Fritz Pleitgen, ARD
„Anna Politkowskaja sollte eine internationale Ehrung von hohem Rang posthum erhalten. Das wäre weltweit für Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, eine große Ermutigung und darüber
hinaus eine dauerhafte Erinnerung an das Lebenswerk von Anna Politkowskaja.“
--------------------------------------------------------------------------------
Nach der Vorstellung meines Buches „Anna Politkowskaja – Chronik eines angekündigten Mordes“ erschienen im Wieser Verlag im Kreisky-Forum in Wien mit den beiden Mitautoren Irina Scherbakowa (Memorial) und Susanne Scholl (ORF) führte ich am darauffolgenden Tag in Ö1 in der Sendung „Von Tag zu Tag“ am 27.3.2007 eine Diskussion über den Tschetschenienkrieg, die bedrohten Menschenrechte, den Mord an Anna Politkowskaja, Putins Energiekrieg, die europäische Nicht-Strategie gegenüber Russland und die Bedrohung durch Terrorismus. Mitdiskutant war der Wiener Politikwissenschaftler Prof. Hans-Georg Heinrich
Warner gab es auch in dem Buch. Schon 2008!
Norbert Schreiber RUSSLAND Der Kaukasische Teufelskreis oder die lupenreine Demokratie WIESER Verlag Klagenfurt 2008
Russland hat viele Gesichter. Manche sind versteckt wie die Puppe in der Puppe, in der auch die offenen Fragen verborgen sind. Wohin treibt Russland? Wer wird dieses Land künftig regieren? Entsteht eine neue Diktatur vor der europäischen Tür? Geht das Morden in Tschetschenien weiter? Was ist das politische Erbe der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja? Geht das Auftragsmorden weiter? Wie erfolgreich ist der Kampf um die Menschenrechte? Was denkt die junge Generation Russlands? Wie verhalten sich die neuen Machthaber auf internationaler Bühne? Muss Deutschland um seine Energieversorgung fürchten? Stirbt die Pressefreiheit in Osteuropa einen langsamen Tod? Journalisten, Politiker und Russlandexperten aus Ost und West antworten. Russland — die „lupenreine Demokratie“. Dieses Buch kann als Lupe benutzt werden.
Mit Beiträgen von
Margaretha Mommsen, Joschka Fischer, Eduard Schewardnadse, Irina Scherbakowa, Lutz Güllner, Gerd Koenen, Hans Georg Heinrich, Sergei Kowaljow, Volker Beck, Thomas Roth, Dirk Sager, Susanne Scholl,
Boris Reitschuster, Mainat Abdullajewa, Freimut Duve, Igor Safronov, Andreij Nekrasov, Jens Siegert, Erich Follath, Wolfgang Petritsch, Lojze Wieser, Kerstin Holm, Michael Ryklin, Predrag Matvejevic
,Anne Sylvie König, Petra Luisa Meyer, Kreisky-Forum, Ilja Politkowsky, Anna Politkowskaja
Aus dem Inhalt:
„Heute sollte der Westen also angesichts der Wachablöse im Kreml genauer nachfragen und hinschauen, ob in Russland eine lupenreine Demokratie besteht und Putin wirklich als „echter Demokrat“ in
welcher Rolle auch immer handelt. Dieses Buch kann demnach als Lupe benutzt werden. Ich empfehle es allen an Russland Interessierten als optisches Hilfsmittel für eine genauere Sicht. Norbert
Schreiber, Literaturredaktion Hessischer Rundfunk Frankfurt am Main
„Bei den deutschen Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik herrscht ein Russlandbild vor, das wie durch einen Weichzeichner verschwommen ist. Allzu sehr prägen wirtschaftspolitische,
ressourcenbezogene und sicherheitspolitische Interessen die Wahrnehmung der innenpolitischen Verhältnisse in der Russischen Föderation“ Volker Beck, Bündnis 90/Die Grünen, Berlin
„Ohne jeden Zweifel ist Russland, dank der hohen Öl- und Gaspreise, wieder erstarkt und meldet sich als eigenständiger globaler Akteur zurück. Putins Politik ist in Russland populär, was sie deswegen
keineswegs richtiger macht.“ Joschka Fischer, Bundesaußenminister 1998 – 2005, Berlin
„In dem während der Präsidentschaft Putins entstandenen politischen System koexistieren autokratische und oligarchische Strukturen. Das autokratische Element kommt in der strikten „Vertikale der Macht“, die als Kommandokette vom Präsidenten bis zu den lokalen Behörden und von der Präsidialadministration bis in die Legislative und Judikative reicht, zum Ausdruck. Außerdem sorgen umfassende Kontrollen über politische Parteien, Wahlen, Medien und Nichtregierungsorganisationen dafür, dass die Gesellschaft ebenfalls zur staatlichen Veranstaltung degeneriert.“ Margareta Mommsen, Politikwissenschaftlerin, München
„Ein „neues“ Russland und eine „neue“ EU müssen lernen, sich von der Vergangenheit zu verabschieden und ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen.“ Lutz Güllner, EU-Kommission, Brüssel
„Die rasche und in den Augen Moskaus rücksichtslose Erweiterung der EU und insbesondere der NATO bis vor die Tore Russlands, die offene Unterstützung der Farbrevolutionen in der Ukraine und Georgien durch den Westen oder die Pläne Washingtons zur Errichtung von Raketenabwehrstützpunkten in Polen und der Tschechischen Republik tragen allesamt zur idée fixe des Kreml bei, Russland würde – sollte es nicht hier und jetzt reagieren – für alle Zeiten auf den Status einer drittrangigen Macht zurückfallen.“ Wolfgang Petritsch, Wien
„Und während die Devisenkasse des Kreml auf sagenhafte 272 Milliarden Dollar angeschwollen ist, verfallen elementare Infrastrukturen, soziale Einrichtungen und Bildungsinstitutionen. Russland hat noch immer die mit Abstand niedrigste Lebenserwartung aller entwickelten Länder, und die Bevölkerung schrumpft weiter in dramatischem Tempo.“ Gerd Koenen, Historiker, Frankfurt am Main
„Alle Konflikte im Kaukasus - die Brandherde im Nordkaukasus, der Südossetien- und der Abchasien-Konflikt in Georgien, der Konflikt um Berg-Karabach - sind über die darin eingebundenen Großmächte (Russland, die EU und die USA) miteinander verknüpft. Die dadurch ausgelösten Flüchtlings- und Migrationswellen trugen zur Verschärfung der Spannung in der Region bei und machten das Problem auch zu einem direkt europäischen. Die Lösung des „kaukasischen Teufelskreises“ liegt in vielen Händen. Verteufelungen mögen zwar hie und da politisch vorteilhaft erscheinen, helfen aber mit, Konflikte zu verewigen.“ Georg Heinrich, Politikwissenschaftler Wien
„Eine Art antiwestlicher Grundton hat sich eingeschlichen. Mal offener, mal versteckter. Mal ernster, mal weniger ernst. Aber er ist auf eine Weise da, wie ich ihn früher nicht kannte. Dass er vom Kreml so befeuert wird, ist jeden Tag in allen Fernsehsendern zu sehen, und von Putin, nun ja auch im Ausland, zu vernehmen.“ Thomas Roth, ARD Moskau
„Die Natur der Geheimdienste besteht darin, zu bewahren, was ist, und alles zu kontrollieren. Konkret: Geheimdienstleute sind nicht diejenigen, die Visionen haben, um etwas zu entwickeln oder Reformen durchsetzen zu können.“ Susanne Scholl, ORF Wien/Moskau
„Es gibt Punks (die etwas out sind und Skinheads (die leider nicht so out sind), Goths und Rockfans, Rapper und Graffitisprayer, Gläubige und Ungläubige, Rechte, Linke und Liberale, Kiffer und Abstinenzler, Skateboarder, Fußballfans und Computernerds und viele andere mehr.“ Jens Siegert, Heinrich Böll Stiftung Moskau
„Auch die Obrigkeit, die sich nach und nach vom westlichen Demokratiemodell entfernte auf der Suche nach einem ‚eigenen’ Weg und vor allem einer nationalen Idee, wandte sich Mitte der 1990er Jahre immer mehr alten sowjetischen Mythen und alten Propagandaidealen zu.“ Irina Scherbakowa, MEMORIAL Moskau
„Die Gasprom-Story hat Helden und Halunken; sie spielt in den überheizten Politiker-Hinterzimmern von Moskau wie in der Eiseskälte von Sibirien, in den von Erpressung bedrohten Pipeline-Transitländern Ukraine, Weißrussland und Armenien, „auf Schalke“ im Ruhrgebiet der Malocher, wie auch im Schweizer Millionärssteuerparadies Zug und in Sotschi am Schwarzen Meer, Putins zweiter Sehnsuchtsstadt, wo er mit den ebenfalls von Gasprom finanzierten Olympischen Spielen sein Lebenswerk krönen will.“ Erich Follath/Matthias Schepp DER SPIEGEL
„Ich werde nie glauben, dass die Herren Schröder und Chirac, die die besten Freunde von Putin sind, nicht wissen, was Putin in Tschetschenien gemacht hat. Ich werde das nie glauben. Für mich persönlich sind sie viel schlimmer als Putin, weil Putin aus Rachegefühlen oder aus bestimmten Interessen heraus handelt. Er trägt nicht diese Maske von Demokratie oder von Menschenrechten vor sich her. Die, die sich hier in Europa als Demokraten und Führer von demokratischen Ländern positionieren, küssen ihn, geben ihm die Hand, helfen oder halfen ihm, Tschetschenien zu vernichten. Die halfen ihm auch, mich zu verfolgen. Dass ich nicht getötet wurde, ist eine Frage des Zufalls.“ Maynat Abdullajewa, sie lebt in einer deutschen Stadt inkognito im Exil
„Es gibt keine Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen könnte, wenn die Machtgruppen einmal beschlossen haben, jemanden zu töten. Da kann man auch 100 Bodyguards beschäftigen, es würde nicht helfen.“ Yuri Safronov, „Nowaja Gaseta“ Moskau
„Ich glaube, dass die Beteiligten an dem Mord sitzen werden - ich bin mir sicher. Ich glaube auch daran, dass der Auftraggeber sitzen wird, aber sicher bin ich mir darüber nicht. Ich möchte daran
glauben, dass er ermittelt wird und ins Gefängnis kommt.“
Ilja Politkowski Sohn der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja, Moskau
"Der Alte" aus Röhndorf
Unter den Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland ragt Konrad Adenauer heraus. Er ist es, der nach NS-Diktatur, Zweitem Weltkrieg und Holocaust 1949 die erste Bundesregierung bilden kann und die von außen gestiftete Demokratie im Westen verankert. Damit legt er die Fundamente einer Erfolgsgeschichte, die den Westdeutschen auf Jahrzehnte hinaus Wohlstand und Frieden beschert. C.H.Beck
Er ist der Kanzler, der seine Rosen pflegt, in der Freizeit einen Strohhut trägt, die Bocciakugel schiebt, in Cadenabbia Italienurlaub genießt, von den „Soofffjetz“ kölnert, wenn er die Kommunisten meint.
Seine Leistungsbilanz, im Positiven wie Negativen: die geförderte Rückkehr der Deutschen in die Weltgemeinschaft, Variante WEST, Teilnahme an der europäischen Zukunftsperspektive, Heimholung der
Kriegsgefangenen aus Russland, Stabilisierung der Wirtschaft, innenpolitische Schärfe und bösartige Töne und Skrupellosigkeiten gegenüber den politischen Konkurrenten, auch deren Ausspähung,
Beschäftigung von Ehedem-Nazis in Regierungsämtern.
Frei zeigt den schnellen Weg Adenauers vom Oberbürgermeister Kölns über die Präsidentschaft im Parlamentarischen Rat bis zum ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Frei hat einen frischen Blick auf die politische Figur, schreibt pointiert und journalistisch fein über seinen wissenschaftlichen Gegenstand. Es macht eine Freude dieses Buch zu verschlingen, denn
Frei kann etwas, was Historikern oft fremd ist: die Kürze und damit die Würze zu finden.
Der Bundeskanzler galt nicht gerade als ein Mann mit überragendem ökonomischem Sachverstand. Dafür hatte er später einen gewissen Ludwig Erhard. Er hatte auch weniger bekannte physische Schwächen.
Etwa die Nachwirkungen einer schweren Kopfverletzung, die er bei einem Unfall, verursacht durch seinen Fahrer, erlitten hatte. Wenig bekannt. Es sind solche Details, die Freis Biografie zusätzlich
würzen. Zugleich kämpfte Adenauer in all den Jahren energisch für seine Versorgungsbezüge?
Frei zeigt uns vor allem den Neuanfang der Bundesrepublik nach 1945.
Einem Gestapo- Beamten nimmt Adenauer einen bronzenen Leuchter weg, den er auf seinem Schreibtisch postiert. Er soll ihn an das Leid, an das Unrecht erinnern. Adenauer: „Er mahnt mich.“
Seine Frau litt an einer sehr seltenen Knochenmarkserkrankung.
Das sind alles Bemerkungen des Autors, die neben den historischen Tatsachen, Fakten und Zusammenhängen stehen und wie beiläufig erwähnt werden, aber dem ganzen wissenschaftlichen Werk die Farbe
geben.
Übrigens sprach Adenauer nicht einmal gut Englisch.
Spiegel Herausgeber Rudolf Augstein erkennt schon früh, dass dieser Mann die beste Aussicht hat, Staatspräsident des neuen, amerikanisch inspirierten westdeutschen Staates zu werden. Als Präsident
des Parlamentarischen Rates war er sozusagen privilegiert, der Sprecher der werdenden Bundesrepublik zu sein.
Über das Provisorium Bonn, die Koalitionsbildungen nach mehreren Wahlen und einer temporeichen Darstellung der Leistungen des Kanzlers und sein Verhältnis zu anderen Personen und politischen
Institutionen, lesen wir über Sicherheit und Souveränität, die Personalpolitik von Adenauer, die Anzeichen einer Kanzlerdemokratie, denn die Politik bedeutete für Adenauer Führung.
In einem schwarz-weißen Bilderteil illustriert der Autor seine Ausführungen. Dabei ist interessant, dass der Kanzler sich als „zurück auf der Weltbühne“ empfinden durfte, weil er schon 1954 auf das
Cover der Wochenzeitschrift Time durfte.
Ausführlich beschreibt Frei, wie es dem Kanzler gelang mit einem abhörsicheren Spezialwaggon nach Moskau zu fahren und dort die Kriegsgefangenen heimzuholen. Trotz Westverankerung.
Spannend zu lesen auch die medienpolitischen Machenschaften des Kanzlers, der schlicht davon ausgeht, dass an der Spitze einer Nachrichtenagentur des Landes ein Mann stehen müsse. (!!!) Ein Mann
also, keine Frau, ein Mann, der das Vertrauen des Kanzlers habe. Presse als kritisches Organ bleibt ihm fremd. Sein Verständnis von Medien ist eher von propagandistischen Gedankengängen geprägt.
Dass die West Orientierung nur um den Preis der Nicht-Lösung der deutschen Frage zu haben war, wird ausführlich behandelt. Frei schließt ab mit der „Kanzlerdämmerung“ beschließt sein Portrait mit dem
Satz Augsteins, dass „Adenauer“ ein ganz großer Häuptling war. Nicht nur wegen seines Indianer-Gesichtes. Führungsstärke gehört eben auch dazu. Und ich füge hinzu, die Fähigkeit gegen den Gegner
Pfeile abzuschießen. Der Autor Frei ergänzt, wichtig sei eben auch dessen Engagement für Europa gewesen. Beides, europapolitisches Engagement, aber auch Führungsstärke, seien heute so
nötig wie zu Adenauers Zeiten.
Norbert Frei ist Professor em. für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Autor der Standardwerke «Vergangenheitspolitik. Die
Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit» (2012) und «Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945» (2013).
Norbert Frei KONRAD ADENAUER Der Kanzler nach der Katastrophe Biographie C.H. Beck
Pressestimmen
„Eine neue, profunde Darstellung“
Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im November 2025
„eleganter Essay ... erhellende Einsichten aus der Zeit des Nationalsozialismus.“
Süddeutsche Zeitung, Florian Keisinger
„Schildert Leben und Leistung Adenauers aus der Perspektive der Gegenwart“
Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Christoph Arens
„Ein exzellentes politisches Porträt über Konrad Adenauer ... Wer verstehen will, wie wir wurden, was wir sind, sollte dieses Buch lesen.“
Frankfurter Rundschau, Michael Hesse
„Norbert Frei ist nicht nur ein sehr erfahrener Forscher, sondern er ist auch sehr erfahren darin, Forschen und Erzählen zu verbinden.“
Deutschlandfunk Studio 9, Hans von Trotha
„Rückt ... den Mythen um die Moskaureise Adenauers zu Leibe, versagt ‚dem Alten‘ aber keineswegs die Anerkennung.“
Süddeutsche Zeitung, Joachim Käppner
Ein indoor- Buch die Hauptperson ein Haus
Das alte Haus erzählt. Denn seine Mauern, Dielen und Ritzen bewahren die Erinnerungen an alle Menschen, die es jemals bewohnt haben. Schon als Kind hat Irma Thon mit ihren nazitreuen Eltern im ersten Stock gelebt. Während die 90-Jährige zurückblickt und immer wieder an die kleine Ruth Sternheim von damals denken muss, erfreuen sie die Gespräche mit Nele Bittner aus dem Vierten. Die Schülerin lernt für eine Geschichtsklausur und beginnt zu verstehen, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern nur wenige Stufen entfernt. (BLESSING)
In der Regel sind in Romanen Menschen die Hauptfiguren. Der Autor Henrik Szántó wählt dagegen dafür ein Haus aus. Natürlich bestehend aus Steinmauern, Treppen, Räumen, Briefkästen und Menschen auf verschiedenen Etagen wohnend. In dieser Erzählung mischen sich die Geschichten der Bewohner aus mehreren Jahrhunderten, und Geschichte wird so gegenwärtig. Die Oberstufenschülerin Nele begegnet einer 90-Jährigen. Da bleibt es nicht aus, dass verschiedene Erfahrungshorizonte aufeinandertreffen. Der Autor, der auch als Moderator und Rapper arbeitet und sich für Mehrsprachigkeit interessiert, ist nämlich von Geburt an halb Ungar und halb Finne.
Wenn wir den ersten Satz in seinem Roman anschauen, beginnt dieser auf Seite 7 und endet auf Seite 10, die Worte rappermäßig, stakkatohaft, nur von Kommata getrennt. Darin kommt dann das pralle Leben
vor, aufgereiht, Vergangenes und Gegenwärtiges, Atemzüge, Mondlandung, Mauerfall, Sportpalastrede, deutscher Herbst, Blockwarte, Reklame, vakuumverpackte Matratzen, Partys, Einweihungsfeiern,
Geburtstage, von mir hier jetzt nur willkürlich ausgewählt. Das alles mischt der Autor mit Weltwirtschaftskrise, Versailler Vertrag und Staubsaugerbeuteln in eine Lebensbeschreibung auch des Alltags.
Nach und nach entwickelt sich in diesem Roman eine Art gegenwärtige Geschichtsschreibung. So hat etwa das junge Mädchen Nele große Mühe sich vorzustellen, wie früher das Übermitteln von Nachrichten
gedauert haben muss.
Zeitungsjungen hetzen in den Städten herum und verbreiteten stapelweise schwarz-weiß gedruckte Zeitungen. Es ist eine Art Geschichtsklausur dieses Buch und eine Chronologie des Alltagswahnsinns. Textprobe: „… jeder Ausruf, jede Verwünschung, jeder Streit, nach einem Umzug heult die Bohrmaschine, es wird gestöhnt und gezischt, ein Klagelied der Rauchmelder, Rennen und Stampfen, Waschmaschinen im Schleudergang, Pürierstäbe, Wasserkocher, und dann der Techno, gute Güte, der Techno, Heilhitlerhowmuchisthefish, man verliert den Verstand, bitte verzeih, wir brauchen kurz einen Moment.“
Manchmal wird aber auch an einem ganz gewöhnlichen Tag einfach nur über das Wetter gesprochen.
So bewegen wir uns eben Treppe für Treppe durchs Leben. Manchmal aufwärts, manchmal abwärts. Ein Buch für Omas, Opas und deren Enkel aus den ECHO-Kammern der Geschichte. »Szántós Sprache fließt durch
dieses Haus und durch die Zeiten, klug und voller Details. Unbedingt lesen!« Markus Thielemann (NDR)
Henrik Szántó Treppe aus Papier BLESSING
Henrik Szántó, geboren 1988, ist halb Ungar, halb Finne und lebt als Autor und Moderator in Hannover. Als Spoken Word-Künstler bespielt Szántó Bühnen im gesamten
deutschsprachigen Raum. Seine bisherige Arbeit wurde mit Stipendien gewürdigt. Als Referent hält Szántó Seminare zu poetischem und kreativem Schreiben, Auftritt- und Vortragssicherheit und bereitet
Bühnen für neue und arrivierte Stimmen. Die Kernthemen seiner Arbeit sind Mehrsprachigkeit, Erinnerungsarbeit und kulturelle Vielfalt.
NAHAUFNAHME GOULD
»Dieser Spinner ist ein Genie«, sagte der Dirigent George Szell nach einem Konzert von Glenn Gould. Seit der kanadische Pianist im Alter von vierzehn Jahren zum ersten Mal öffentlich Beethovens 4. Klavierkonzert spielte, versetzte er sein Publikum in Erstaunen. Aber er wurde auch scharf angegriffen: wegen seiner Manieriertheit – ungebügelter Frack und ein kurzbeiniger Hocker, auf dem er, fast auf dem Boden sitzend, spielte –, wegen seines kompromisslosen Repertoires wie seiner progressiven Bach-Interpretationen, wegen seiner an Besessenheit grenzenden Suche nach dem perfekten Flügel. Und nicht zuletzt wegen seiner exzentrischen Lebensweise und seines bizarren Aufzugs: Er trug selbst im Sommer Handschuhe und Schal. Und dann beschloss Gould im Alter von zweiunddreißig Jahren auch noch, keine öffentlichen Konzerte mehr zu geben. Der Musikjournalist Jonathan Cott besuchte schon als Jugendlicher jedes New Yorker Konzert von Gould; 1960 lernte er sein Idol persönlich kennen. 1974 führten die beiden drei mehrstündige Telefongespräche für den Rolling Stone, die den Kern dieses Buchs bilden. (KAMPA)
Wenn er vor seinem Flügel saß, auf niedrigem Hocker, fast mit Mundberührung auf der Klaviatur, schien er für den Zuschauer fast in den Flügel hineinkriechen zu wollen, so als wollte er die einzelnen Töne vor den Hämmern und den Stahl-Saiten selbst abrufen und kontrollieren. Kontrollfreak war er, mit einer gewissen Manieriertheit versehen, saß immer wie beschrieben auf einem kurzbeinigen Hocker, der Erde, dem Boden nahe, und sprach, während er spielte, vor lauter Begeisterung oder auch Entsetzen vor sich hin.
Ein verrückter Hund, jedoch ein Genie, am Flügel!
In Toronto geboren, gilt er als einer der verrücktesten, originellsten und eigenwilligsten Pianisten des 20. Jahrhunderts.
Seine Goldberg-Variationen machten ihn weltberühmt. Er beendete jedoch seine Konzertkarriere schon mit 32 Jahren, und produzierte nur noch Studioaufnahmen. Er war aber auch ein Radiomann, schrieb
Kritiken, musiktheoretische Essays und produzierte Hörspiele.
Jonathan Cott hatte die einmalige Chance für drei mehrstündige Telefoninterviews. Cott schrieb für den Rolling Stone und die New York Times und den New Yorker. Während Gould spielte, summte er
und sang, er kämpfte mit und gegen den Flügel, als wäre er Freund und Feind des Instruments zugleich. Er suchte immer einen Flügel mit straffem Anschlag, denn Gould wollte scharfe Konturen.
Gould interviewte sogar sich selbst, sein obsessives Temperament drangsalierte die Partituren. Der Autor empfand beim Hören der Goldberg- Variationen einen Zustand, den er als musikalische,
emotionelle und geistige Erleuchtung empfand. Cott lernte seinen „Gegenstand“ sogar selbst kennen, während einer Fernsehproduktion. Wer sich für Musik interessiert, muss dieses Buch lesen, denn es
enthält viele Geheimnisse der Interpretationskunst aber auch noch mehr Eigenwilligkeiten. Zum Beispiel stellt er sich ein Konzert „nie als Ganzes“ vor, und so sagt er provozierend, eine analytische
Vollständigkeit sei jedenfalls theoretisch möglich, solange man vom Klavier weg bleibt. Fazit für Gould, „wenn ich ehrlich bin, einmal im Monat, muss ich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Klavier
anfassen, sonst kann ich nicht mehr richtig schlafen.
Eine Nahaufnahme, die zu Herzen geht, geeignet für Menschen, die sich mit Musik, Künstlern, Komponisten und Interpretationen
auseinandersetzen.
Jonathan Cott ist Autor zahlreicher Bücher, veröffentlichte u. a. Interviewbände mit Glenn Gould, Henry Miller und über John Lennon und Yoko Ono. Er war langjähriger Redakteur des Rolling Stone und schrieb u. a. für die New York Times und den New Yorker. Cott lebt in New York.
Glenn Gould / Jonathan Cott
Nahaufnahme
Telefongespräche mit Jonathan Cott KAMPA
PRESSESTIMMEN
»Keiner beansprucht den Spitzenplatz unter den wahrhaft Verrückten so rechtmäßig wie Glenn Gould.« Spiegel Online
»Wer diese Seiten gelesen hat, begreift, dass das Exzentrische an Gould vor allem daran liegt, dass er sich selbst genug war. Dass er sich nicht scherte um Werktreue, sondern um seinen Bach, seinen Mozart.« taz
»Im wahrsten Sinne des Wortes eine Nahaufnahme.« Ekz Bibliotheksservice
»In diesen drei Interviews finden sich verblüffende Gedanken. […] Ein überraschendes Lese-Erlebnis, nicht nur für Glenn Gould-Fans!« Christian Kosfeld / WDR Westart
»Einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.« The Washington Post
»Gerade so, als müsse er eine Vorlesung halten, aber auch heiter, wie ein Flirt.«
Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung
Der Einzelgänger in der Politik: Michael Roth
Der langjährige Außenpolitiker Michael Roth schreibt in radikaler Offenheit von den «Zonen der Angst» der Berufspolitik. Vom innerparteilichen Machtkampf. Den sozialen Medien und dem drohenden Shitstorm. Dem Pranger, weil man die Rituale und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt. Dem falschen politischen Spiel mit gesellschaftlichen Ängsten. Darunter hat der Mensch Michael Roth immer stärker gelitten – und seine psychische Erkrankung erst spät erkannt. Mit seinem Buch möchte er anderen Mut machen, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Dabei schont er weder seine politischen Weggefährten noch sich selbst.
Fast sein halbes Leben lang war Michael Roth Berufspolitiker, zuletzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Ein leidenschaftlicher Unterstützer der Ukraine, der seine Haltung gegenüber Russland früh überdacht hat und auch deshalb nicht nur in seiner eigenen Partei in der Kritik stand. Roth wuchs in schwierigen Verhältnissen im nordhessischen «Zonenrandgebiet» auf. Mit 28 zog er in den Bundestag ein. Er erlebte die erste rot-grüne Koalition im Bund, die Jahre der Großen Koalition und schließlich das jäh gescheiterte Experiment der Ampel. Nach fast 27 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter und einer psychischen Erkrankung entschied er, seine politische Karriere zu beenden. Nun legt er eine sehr persönliche Geschichte über sein Leben in der Politik und mit der Angst vor: radikal offenherzig, analytisch klar und schonungslos selbstkritisch. (C.H.Beck)
Minister wissen es, Kanzler erst recht, Fraktionsvorsitzende stöhnen darüber, Abgeordnete leiden daran: Politikerstress! Politik macht müde und kaputt. Erst recht seit uns die unsocial-media drangsalieren. Übertreiben wir es mit der Allseits-Verfügbarkeit der Politikerklasse, die so viel talkshowen und uploaden, dass man manchmal nicht mehr weiß, wann sie eigentlich noch Politik machen, wo sie doch den ganzen Tag auch in Gremien sitzen müssen?
Da träumt der SPD-Politiker Michael Roth sich dann weg vom Politikbetrieb und sieht den weißen Möwen nach, die in Berlin vor dem Reichstag nach Freiheit schrill kreischen. Aber: „Es dauerte lange, sehr lange, bis ich lernte: Flucht ist keine Lösung.“
Man denkt zuerst vorschnell, da ist doch die SPD die Ursache, die elende „Ochsentour“, die smarten „Politikerfreunde“, ja das spielt eine Rolle aber der eigentliche Grund für die Problemlage sind die familiären Verhältnisse, der trinkende Vater, die mangelnde Elternliebe, das nicht verarbeitete Sein als Homosexueller, die als Triggerursache den Ausstieg aus der Politik, und zwar endgültig forcieren.
Ende einer Politikerkarriere, die ureigentlich doch keine war, denn die hohen Höhen, die oberen Weihen - das reguläre oberste Kabinetts-Ministeramt - hat Michael Roth nie erreicht. Immerhin war er zuletzt doch Staatsminister im Auswärtigen Amt, am Kabinettstisch geduldet, ohne ein eigenes Ministerium zu leiten, in Stellvertreter-Funktion und ganz am Ende Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
„Nach mehr als einem Vierteljahrhundert und sieben Legislaturperioden als direkt gewählter Abgeordneter meines nordhessischen Wahlkreises Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg habe ich erkannt, dass ich nicht mehr weitermachen will. Mit Mitte fünfzig scheint mir der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu wagen.“
Sein Buch, das sagt er selbst, ist ein klassisches „Memoir“, eine Erinnerungserzählung „…mit allen Unzulänglichkeiten, die der subjektiven Erinnerung geschuldet sind.“ Aber Roth schreibt Klartext und schont auch die Genossen nicht. Und sich selbst schon gar nicht, er bekennt sich zu seiner ständigen Angst: Machtkampf, die Angst, zu verlieren, aber auch zu gewinnen. Angst vor dem kommunikativen Raum der sozialen Medien, Angst vor dem Pranger, weil man die Rituale, Dogmen und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt.
Roth spürt ständig Leere, Erschöpfung und Furcht. Wenn es um Posten und Pöstchen geht bleibt Roth meistens „ohne“ zurück. Er ist zurückhaltend, das wird ihm als Arroganz ausgelegt. Wenn es um Frauenquote oder Regionalproporz geht, fällt er hinten runter. Sein Gefühl zu oft: „Das war’s, da kommt nichts mehr.“
Als „schwuler Kerl“ in der nordhessischen Provinz tut er sich schwer mit Freundschaften, dazu kommt die Chaosfamilie, der Vater, der ihn drangsalierte. Sein Alkoholismus bereitet Roth Panikattacken. Roth wird gemobbt als Außenseiter und Sohn eines Alkoholikers. Hinzu kam die Angst vor der Enttarnung der eigenen Sexualität. Roth fühlt sich als „Underdog“. Die Oma warnt vor der Politik: „Junge, du bist dafür viel zu sensibel.“
Roth empfindet Politik zunehmend als „Kompromissschmiede“ als „Gratwanderung“ zwischen „Verhandlungsbereitschaft und Machtkalkül“. Netzwerken kann er nicht so gut, Distanz wird als Arroganz ausgelegt, als „Provinzler“ liegt ihm das glatte Berliner Pflaster mit dem Macho-Männergehabe nicht. In Hessen holt er aber das beste Erststimmenergebnis.
Und der Blick auf die Kollegen: Lafontaine ein “brillanter Demagoge“ ...“Sargnagel für Schröders Kanzlerschaft“, Schröder „erster richtiger ‚Medienkanzler‘ der bundesdeutschen Politikgeschichte“, modern, schnoddrig „Alphamann“. Steinmeiers Ostpolitik „naiv und fatal“. Scholz hatte eine „Elefantenhaut, die mir fehlt.“ „Sein Blick auf den Diktator im Kreml war nüchtern und kalt.“ Merkel: „Zähe Pfarrerstochter aus der Uckermark“.
Roth entdeckt die Ostpolitik und erkennt als einer der wenigen Putins Terrorpolitik im Tschetschenienkrieg, die Ausschaltung der Regimekritiker als Anzeichen für eine aufkommende Diktatur, während seine Partei „Appeasementpolitik“ betreibt. Den Einmarsch Russlands in Georgien empfindet Roth als „offene Kriegserklärung an die europäische Friedensordnung“. Keiner will es so wahrnehmen. Seine Partei reagiert so: „Strich drunter ziehen, geschäftsmäßig und kalt abhaken.“
Nach der Krim-Annexion ist der Bau von Nordstream 2 für ihn „Wahnsinn“. Stegner, Mützenich, Schwesig wollen ihn bremsen, wenn er einen realistischeren Blick auf die „verbrecherische russische Diktatur“ einfordert. Auch Laschet, Profalla, Söder, Seehofer und Kretschmer singen das Verharmlosungs-Lied mit.
Die seelische Last wird immer schwerer, seine tiefen Gefühle schwanken zwischen Panik und Ohnmacht, Auszeit, Urlaub, Politikenthaltsamkeit bringen keine Lösung. Er leidet unter dem Kühlschrank-Klima in der Fraktion. Ausgestoßen, isoliert, abgewertet! Zum Einzelgänger verdammt!
Der Ukrainekrieg und die Debatte um Waffenlieferungen und der Gaza-Krieg tuen ein Übriges für den gezogenen Schlussstrich. Diese Kapitel sind besonders eindrucksvoll und spannend.
Roth ist nun „Alleiner“ und zieht als solcher die Reißleine und sucht Hilfe bei Therapeuten: „Ich habe manchmal noch Angst. Aber ich bin auf einem guten Weg.“
Ein offenes Buch, Seite für Seite, eine Art Selbstreinigungsprozess, Katharsis, wahrhaft, ehrlich, die Politik entzaubernd, den Medienbetrieb kritisierend, eine persönliche Abrechnung mit dem Politikbetrieb und dem internen SPD-Parteiengezänk. Niemanden schonend, schon gar nicht sich selbst. Sehr überzeugend!
Fazit: „Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und in der Politik gilt genau wie in der Schule: Die Rechthaber sind am unbeliebtesten“. Und „Verantwortungsvolle Außenpolitik kann man eben nicht nur aus dem Home-Office betreiben.“ Ein Klartext-Buch flottflüssiggutlesbar geschrieben, ohne Politik Schwurbelei, ein Offenbarungsbuch mit Charakter, ein ehrliches, emotional aufgeladenes Buch, von einem, der als „Störenfried“ empfunden wird, der es aber nicht anders als nur ehrlich meinte. Ehrlichkeit und Politik, ein altes, uraltes, neues Buch-Thema!
Pressestimmen
„es geht um die Frage, ob es heute in der politischen Szene überhaupt tolerabel ist, nicht ganz funktionsfähig zu sein ... schreibt mit bemerkenswerter Offenheit“
ARD, ZDF, 3sat Buchmessen Bühne, Harald Welzer
„Erklärt wie er heute auf die Ukraine, seine eigene Partei und die Gefahr psychischer Erkrankungen in der Politik blickt.“ Watson, Dariusch Rimkus
„Für mich das politische Sachbuch des Jahres.“ Zeit Online, Peter Tauber
„Michael Roth attestiert der SPD ... einen katastrophalen Zustand ... gibt Einblick in Zumutungen des politischen Betriebs“ WELT, Hannah Bethke
„Ein schonungsloser Blick auf die Politik und sich selbst ... lehrreich, fesselnd und immer wieder erschütternd.“ Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm
„Ein bemerkenswert offenherziges Buch ... sehr offener, persönlicher Rückblick auf sein Leben als Berufspolitiker.“ Süddeutsche Zeitung, Georg Ismar
„Das beste Buch über die Gesetze des heutigen politischen Betriebs - wer Politik studiert, betreibt oder sich auch nur dafür interessiert, sollte dieses Buch lesen.“ NL Der Siebte Tag, Nils Minkmar
„Seltene, bemerkenswerte Einblicke in den politischen Betrieb in Berlin ... sehr lesenswert.“ Rheinische Post, Jan Drebes
„Ein sehr lesenswertes, wichtiges Buch.“ Anne Will
TIPP 10 Gegenthese: Die Diplomatie versagt
Marc Trachtenberg/Markus Klöckner Chronik eines angekündigten Krieges Die Ukraine und das Versagen der Diplomatie Westend
Erst lieferte die Bundesrepublik 5.000 Helme in die Ukraine. Dann folgten Waffen, Panzer und Raketen. So wollte die deutsche Regierung den Frieden sichern, der Ukraine zum Sieg verhelfen - oder gar mit Sanktionen Russland ruinieren. Keines dieser Ziele haben westliche Strategen erreicht. Dabei wurden sie von etlichen Wortführern immer lauter und eskalierender beschworen und eingefordert.
Zahlreiche in diesem Buch zusammengeführte Zitate und nachrichtliche Ereignisse der vergangenen drei Jahre lassen ein Dokument entstehen, das zeigt, wie eine Politik der Konfrontation den Totalausfall der Diplomatie bedingt. Diese "Chronik eines angekündigten Krieges" führt uns vor Augen, warum die Ukraine-Politik gescheitert ist. Unabhängig davon, wie es weitergeht: Der - laut New York Times - "verheerendste Landkrieg seit Generationen" offenbart tiefe politische Abgründe. (WESTEND)
Wieder einmal wird Kurt Tucholsky zitiert mit dem Gedicht-Titel „Krieg dem Kriege“. Das Buch ist ein Rekonstruktionsakt über einen vermeintlich diplomatischen Totalausfall. Die Autoren nehmen schon in der Einleitung das Ergebnis vorweg, dass bereits die Sprache von „Konfrontation und Bellizismus durchdrungen sei, dies wäre das Resultat der Politik: Sie würde vom Frieden sprechen aber militärisch auftrumpfen. Zitat: „Europa droht in den Abgrund des Krieges zu rutschen“. Es beginne eine Saat aufzugehen, in der politischen und militärischen Eskalation, ausgehend von der Annahme Russland verstehe nur die Sprache der harten Hand. Dies führe jedoch zu einer dramatischen Lage, es müsste jedoch alles daran gesetzt werden, diesen Krieg so schnell wie nur möglich politisch zu beenden.
Wie das geschehen soll, vor allem im Einvernehmen mit Putin, sagen die Autoren jedoch nicht. Sie liefern eine Chronik der Berichterstattung der Politiker und anderen Akteure, und es wird das ewige Thema diskutiert, inwieweit die NATO-Ost-Erweiterung dazu beigetragen hat, dass es zu Putins Aggressions-Reaktionen gegenüber der Ukraine und dem Westen kommt. Haben die USA Moskau versprochen, dass die NATO sich nicht weitergehend nach Osten ausdehnen wird? Vermutlich gibt es nicht Schriftliches, aber in den einen oder anderen Aussagen der Politiker wurde diese Möglichkeit wohl schon angedeutet. Die Autoren wollen einen neuen Blick auf die Debatte werfen und bringen eine Reihe von Zitaten, etwa das des Außenministers Genscher, der in Tutzing gesagt hat, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, werde es nicht geben.
Auch Gorbatschow bestätigt, das Thema NATO-Erweiterung wurde überhaupt nicht diskutiert. Es herrschte eben die Frage vor, wird der Warschauer Pakt überleben ja oder nein? Hatten Baker und Genscher bei den Zusagen tatsächlich Osteuropa als Ganzes im Blick? Es wurde vorrangig über den Übergangsstatus der ehemaligen DDR diskutiert, alles andere war vor allem aus deutscher Sicht zweitrangig. Für die Autoren besteht kein Zweifel, dass Genscher an Osteuropa als Ganzes gedacht hat. Zitat Genscher: „Für uns ist es ein fester Grundsatz, die NATO wird nicht nach Osten erweitert werden.“ Aber es gab eben keine rechtsverbindlichen Zusagen oder schriftliche Vereinbarungen und schon gar keine Verträge. Die Autoren beharren darauf, dass auch mündliche Zusagen gelten. Es herrschte eben eine „konstruktive Zweideutigkeit“. Im zweiten Teil summiert das Autoren-Duo die Chronologie der deutschen Sicht, die mit 5000 Helmen begann und mit klaren Waffenlieferungen zurzeit endete; allerdings steht die Lieferung von Taurus nach wie vor aus. In diesem Buch wird eben der Aggressionsakt Putins weitgehend ausgeblendet. Es ist ein Buch der Antithese, als Dokument wichtig, als Analyse wirkt sie jedoch zu putinfreundlich.
Magie der Sprache
Zum Schmökern, Staunen, Genießen und (Wieder-)Entdecken: 50 Passagen, die die Schönheit und Originalität der deutschen Sprache feiern - von Autor zu Autor, von Buch zu Buch, quer durch die Literaturgeschichte
Mit Texten zu Sybille Berg, den Gebrüdern Grimm, Dörte Hansen, Otfried Preußler, Franziska von Reventlow, Friedrich Schiller u.v.a. DVA
Wenn man sich durch das Internet scrollt, kann man sich oft genug die Haare raufen über den aktuellen Zustand der Deutschen Sprache, was Stil, Rechtschreibung und Grammatik angeht. Da greift man doch
gerne zum Buch, erst recht dann, wenn es darum geht, der Magie der deutschen Sprache endgültig auf die Spur zu kommen.
REZENSION
Hauke Goos schreibt für den Spiegel, der einst auch ein Leuchtturm der Sprachbegabten war. Die SPIEGEL-Sprache, ein Fall für sich. Immer öfter treten nun die Autoren des Politmagazins mit eigenen
Buch- Publikationen an die Öffentlichkeit. Meist geht es um Politisches. Hier jedoch um die deutsche Sprache selbst, die von Ausländern gerne als „schwer zu lernen“ gekennzeichnet wird und die etwas
härter klingt als die romanischen Schwester-Sprachen, die musikalischer, melodischer klingen. Im Vorwort schreibt der Autor, er habe sogar die spontane Idee gehabt, unseren „trocken-Brötchen“-
Kanzler Olaf Scholz in dieses Buch aufzunehmen; eingedenk der Tatsache, dass Scholz nicht gerade als der große Redner gilt. Nicht von ungefähr lautet sein Spitzname „Scholzomat“.
Der Autor wollte halt ein Zitat aufnehmen, um zu zeigen, worum es in seinem Buch nämlich nicht geht! Also in Abgrenzung zu Scholz zu zeigen, „vilgos“, das leuchtende, funkelnde, glänzende, bisweilen
auch magische Deutsch. Anderswo aufzufinden, nämlich bei Autoren wie Karl Marx, Friedrich Hölderlin, Viki Baum, Hans Magnus Enzensberger Heinrich von Kleist, Elfriede Jelinek oder auch in Werken des
immer wieder zitierten Franz Kafka, die der Autor würdigt.
Goos leitende Idee für dieses Buch, Stil ist nichts anderes als die Übereinstimmung von Inhalt und Form!
Nehmen wir also ein paar Beispiele heraus. Ganz am Anfang formuliert Roger Willemsen, den so viele vermissen, weil er so früh verstarb zu Deutschland: Am schönsten ist „das Land als Versprechen, weit
weg.“
Enzensberger lobt Goos wegen seines Suchtverhaltens, Zitat: „Das Nikotin ist nur ein Nebeneffekt des Tabaks. Entscheidend sind die träumerischen Absenzen des Rauchers.“
Wer mitten in Hamburg residiert und für den SPIEGEL schreibt, wird natürlich schnell auf Theodor Storm kommen und seinen Schimmelreiter: „Am anderen Morgen, beim goldensten Sonnenlichte, das über
einer weiten Verwüstung aufgegangen war, ritt ich über den Hauke-Haien Deich zur Stadt hinunter“.
Der Leser fühlt sich mit im Sattel sitzend.
Christa Wolf und ihr „Geteilter Himmel“ wird zitiert: „Die Stadt, kurz vor Herbst noch in Glut getaucht, nach dem kühlen Regensommer dieses Jahres, atmete heftiger als sonst“.
Der umstrittene Ernst Jünger kommt mit seinem Buch in „Stahlgewittern“ - einem Weltkriegsroman - zu Wort: „Oft zerrissen jähe Blitze das Dunkel; Schüsse knallten, und ein Schrei verwehte ins
Unbekannte. Tim und die anderen kämpften, schlecht verpflegt und notdürftig bekleidet, als geduldige, mit Eisen beladene Tagelöhner des Todes.“
Joseph Roth kommt vor und Peter Handke, Friedrich Hölderlin, das berühmte Zitat von Vico von Bülow über „Englisch für Angeber“, Auch Alfred Polgar: „Das Café Central liegt unterm wienerischen
Breitengrad am Meridian der Einsamkeit“. Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist vertreten mit ihrem Roman über die Liebe zur Musik „Die Klavierspielerin“: „Eine Frau Doktor steht mit dem Schmerz
schon lang auf Du und Du. Sie ergründet jetzt seit 10 Jahren das letzte Geheimnis von Mozarts Requiem. Bis jetzt ist sie noch keinen Schritt weitergekommen, weil dieses Werk unergründlich ist.“
Mutig wählt der Autor sogar Nicoles Liedtext „Ein bisschen Frieden“ aus.
Aber danebenstehend eben auch Heinrich Manns Zitat zu seinem Essay „Der Haß“: „Man hat wohl Feinde und … kann aber nicht glauben, daß sie zu allem fähig wären“.
Das Buch, eine listenreiche Zitatensammlung mit den jeweiligen Interpretationen dazu. Lesenswert! Spannend! Zitierfähig!
Senden wir an dieser Stelle noch eine Fußball-Weisheit von Eberhard Stanjek, dokumentiert zum Spiel Deutschland- Österreich 1982: „Sie erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die sich da
unten abspielen, nicht weiter zerrede. Was hier geboten wird, ist schändlich“. Diese vornehme Zurückhaltung eines Fernsehkommentators, sonst um klare Worte nicht verlegen, ermuntert mich jetzt
auch, die eigene Kommentar-Klappe zu halten, das Buch einfach zum Nachblättern zu empfehlen. Wie heißt es so schön Lesen Sie selbst und entdecken Sie die Magie der deutschen Sprache! Aus subjektiver
Sicht!
Hauke Goos hat Geschichte studiert und kam 1999 zum SPIEGELreporter. Seit 2001 schreibt er für das Reportagen-Ressort des SPIEGEL. Er lebt in Hamburg.
Pompeji - Vulkanausbruch und Sex
Der Ausbruch des Vulkans Vesuv hat das Leben in Pompeji für immer angehalten. Doch die Ausgrabungen, die bis heute zu neuen Entdeckungen führen, fördern nur scheinbar eine ruhige Stadt am Golf von Neapel zutage. In Wirklichkeit brodelt es im Jahr 79 unter der Oberfläche gewaltig. Sklaven und Politiker, Kellnerinnen und Künstler, Gladiatoren und Straßenkinder werden zu den zentralen Figuren einer epochalen Umwälzung. Am Ende zerbricht das Römische Reich, und das Christentum wird zum neuen Bezugspunkt einer völlig veränderten Welt. Gabriel Zuchtriegel erklärt anhand alter und neuer Entdeckungen aus Pompeji, wie es zur größten spirituellen Revolution des Abendlandes kommen konnte. Er entwirft das lebendige Bild einer rohen und gewalttätigen Gesellschaft, die zugleich ihre Schönheit und Menschlichkeit offenbart – manchmal da, wo man es am wenigsten erwartet. PROPYLÄEN-Ullstein
Der Autor berichtet vom Ausbruch des Vesuvs und vom Niedergang Pompeijs in einer Sprache, als würde es um Live-Berichterstattung gehen. Zum Beispiel so: „Etwas mehr als zwanzig Sekunden braucht
der Donner, mit dem die Wolke aus dem Berg hervorgebrochen ist, bis er Pompeji erreicht. Dann hört man nur noch das Weinen der Kinder, das Wimmern der Verletzten, das Schreien der Esel und Kühe im
Stall und das Winseln der Hunde, die nicht von der Leine loskönnen.“
Die Annalen verzeichneten 1300 Opfern. Nur eines davon, ein Junge, fünf oder sechs Jahre alt, „… der unter der Treppe eines Hauses in den Armen eines Mannes starb. Der Mann trug bei sich: Gold-
und Silbermünzen, zwei Goldringe und ein Goldarmband.“
Zuchtriegel beschreibt das Tote lebendig. Ja sogar das Sexleben jener Tage wird entblößt. Etwa „Dating im antiken Pompeji“, Oral- und Analverkehr, Pornoaufzeichnungen, Hetero- und Homosexualität,
Fellatio und Cunnilingus. (Mal nachgooglen!)
Da wird der Autor deutlich, wenn er die sexualisierten Wand- und Grabschriften nachzeichnet: „Auf demselben Grabmonument ist zu lesen: »Hyginus, sei gegrüßt. / Edone bläst Pilades einen.«
Oder: »Ich habe die Wirtin gevögelt«, hat jemand an die Fassade einer Kneipe gepinselt. Griechische Wandgemälde von jungen Knabenkörpern und Statuen animierten zusätzlich...
9000 Quadratmeter groß ist das Ausgrabungsgelände Pompeijs mit
13.000 freigelegten Räumen. Zuchtriegel beklagt, wogegen er ankämpfen muss: „In 13.000 Räumen arbeiten Wind und Wetter, Feuchtigkeit, Pflanzen- und Pilzbefall gegen uns. Als wäre das nicht schon
genug, gibt es unter den Millionen von Besucherinnen und Besuchern, die jährlich kommen, leider auch eine kleine Minderheit, die es für eine gute Idee hält, ihre Namen auf antiken Wänden zu verewigen oder Mosaiksteinchen als Souvenirs mitzunehmen.“
Es gibt Pläne, ganz Pompeji zu überdachen, aber die Realisierung ist finanziell einfach unmöglich.
Ob Olympiaden oder Wagenrennen, Familiengeschichten oder Göttersagen, das Frausein oder Mänersex, das pralle Leben legt der Autor für uns frei, so spannend beschrieben, lebensnah und farbenfroh, dass
man gerne in Jugendjahren ins altsprachliche Gymnasium statt zur Konkurrenz gegangen wäre.
Übrigens, by the way, die erste Olympiade soll 776 v. Chr. stattgefunden haben. Nero wurde in vielen Disziplinen zum Sieger erklärt. Das würde Kanzler Merz erfreuen, auch mal zum Triumphator erklärt
zu werden, ohne irgendwelche Vorbedingungen. Bei den Olympiaden gab es übrigens sogar Musikwettbewerbe. Wär‘ doch was für Helene Fischer und Florian Silbereisen. Wir erfahren in dem Buch von Göttern,
Gräbern und Gelehrten, und auch von Politikern.
Sie verdienten in der Antike nichts. Sie hatten für Gladiatorenspiele, Theateraufführungen, Wagenrennen im Zirkus zu sorgen, eben für Brot und Spiele.
Auch das entstehende Christentum wird in dem Buch breit geschildert. Wir lernen auch Neues über Hinrichtungsformen, etwa über Kreuzigung, sie war im Römischen Reich die gängige Todesstrafe „für
Menschen, die nicht im Besitz des Bürgerrechts waren; römische Bürger hatten Anspruch auf eine humanere Exekution, zum Beispiel durch Enthauptung. Ursprünglich band man die Verurteilten an einen Baum
oder an einen Pfahl und überließ sie einem langsamen, qualvollen Tod durch Verdursten, Erfrieren oder Verhungern. Später ging man dazu über, sie an Holzpfähle mit einem Querbalken zu nageln (…) Der
Todeskampf der ans Kreuz Gebundenen oder Genagelten konnte sich über Tage hinziehen. Manche verdursteten langsam, in der kalten Jahreszeit kam Erfrieren dazu; Wundbrand, Herz- und Kreislaufversagen
taten ein Übriges. Es konnte vorkommen, dass Angehörige den Henker bestachen, damit er den Verurteilten mit einem Vorschlaghammer oder einem Holzpfahl die Beine brach – eine »gute Tat«, denn so
„starb er schneller…“
Das archäologische Credo des Direktors des archäologischen Parks Pompeij: „Bei den Ausgrabungen holen wir Trümmer des scheinbar Unwichtigen, des Vergessenen und Weggeworfenen aus dem Boden.
Während die Geschichtsschreibung einer Epoche so-zusagen ihre offizielle Biographie ist, gräbt die Archäologie gleichsam im Unbewussten.“
Ein großartiges Buch, es gehört unter den Weihnachtsbaum gelegt, für archäologie- und geschichtsinteressierte Italienfans, dort darf es dann unter dem Geschenkhügel unter Beobachtung der Engel gerne
ausgegraben werden.
Gabriel Zuchtriegel, geboren 1981, studierte in Berlin und Rom Archäologie und griechische Literaturgeschichte. Nach seiner Promotion an der Universität Bonn erhielt er ein zweijähriges Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für Forschungen in Süditalien. Doch daraus wurden mehr als zehn Jahre, in denen er in Italien forschte, lehrte und im Denkmalschutz arbeitete. Seit April 2021 ist er Direktor des Archäologischen Parks Pompeji.
Gabriel Zuchtriegel Pompejis letzter Sommer: Als die Götter die Welt verließen Ullstein PROPYLÄEN-Ullstein
Ein Lavendelduft-Krimi mit Klosterleichen
René Anou Tödliches Gebet: Ein Fall für Commissaire Campanard Heyne
Notre-Dame de Sénanque in der Provence: Seit fast 900 Jahren ruht die altehrwürdige Abtei inmitten leuchtender Lavendelfelder. Neuerdings macht hier ein Mönch von sich reden, der behauptet, der Teufel würde ihm die Zukunft zuflüstern. Als eine seiner Prophezeiungen eintritt, ein Mord an einem Klosterbruder, ist Commissaire Louis Campanard zur Stelle. Der Ermordete war für ihn nicht irgendwer: Vor Jahren stand Frère Bernard dem Ermittler in dessen dunkelster Stunde bei. Campanard schwört, denjenigen zu fassen, der diesen für ihn so wichtigen Menschen aus dem Leben gerissen hat. Doch die uralten Klostermauern geben ihr Geheimnis nicht freiwillig preis. Es heißt, hier sei das Böse eingezogen. Campanard will das nicht glauben, doch die folgenden Ereignisse stellen seine Überzeugungen auf die Probe … (HEYNE)
REZENSION
Nicht immer sind es die Handlungsstränge eines Krimis, die uns sofort überzeugen. Manchmal gewinnen die Romane einfach auch dadurch, dass eine besondere Figurenkombination gewählt wird.
In diesem Fall ist schon einmal das Besondere, dass ein Bruder aus dem Kloster Sénanque mit dem gut gelaunten Ermittler deswegen kooperiert, weil sie sich schon einmal gegenseitig geholfen
haben.
Oh Gott möchte man rufen, ein junger Novize wird von den Visionen des Teufels geplagt - nicht mehr und nicht weniger. Bitte hilf!
Und es kommt die Frage hinzu, welche Hexe mag auch mit daran beteiligt gewesen sein, dass kurz darauf ein Bruder spurlos verschwindet.
Wir befinden uns in einem Zisterzienserorden, der ein abgeschiedenes Leben verlangt und darauf dringt, dass die Brüder untereinander wenig Worte nur wechseln und schon gar nicht mit Leuten plaudern,
die mit einem Dienstausweis vor der Tür stehen.
Der Kommissar Campanard zeichnet sich jedoch durch Ermittlungsmethoden aus, die nicht gerade in einem Polizei-Lehrbuch stehen.
Es fallen auch so schlaue Sätze wie Sprache schafft Realität.
Da passiert es doch zusätzlich zu dieser philosophischen Erkenntnis a là Richard David Precht, dass eine verkohlte Gestalt aufgefunden wird, die über dem Lenkrad gekrümmt auf den Überresten eines
Fahrersitzes platziert ist.
Was war das nun wieder für eine Flammenhölle? Kommissar Campanard weiß, wann die Mönche plaudern, wann sie schweigen, wann sie beten, wann sie arbeiten und wann sie sich ihren eigenen Interessen
widmen, die sie durchaus haben. In einem Brief war der Kommissar aufgefordert worden, bitte hilf mir Licht in diese Sache zu bringen, ich kann mir niemand besseren vorstellen.
Verraten wir nichts von der weiteren Handlung und fühlen uns hier in der Provence in der 900 Jahre alten altehrwürdigen Abtei, die inmitten leuchtender Lavendelfelder steht, auch an ein
Schweigegelübde gebunden: Verrate in einer Rezension nicht allzu viel vom Inhalt eines Krimis, sonst spart sich der Leser den Kauf des Buches. Ein Krimi, der den Lavendelduft atmet, und von
schweigsamen Mönchen beredt berichtet und deren verhängnisvolle Geheimnisse aufdeckt.
René Anour lebt in Wien. Dort studierte er auch Veterinärmedizin, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Er arbeitet
inzwischen bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig.
René Anour Tödliches Gebet: Ein Fall für Commissaire Campanard HEYNE
Ein Buchgeschenk für Bürokraten
Patrick Bernau Bürokratische Republik Deutschland Report aus einem überregulierten Staat CH Beck
Deutschland hat viele Probleme – und die meisten haben eine gemeinsame Ursache: die Bürokratie. Ein Dickicht aus gut gemeinten Gesetzen, überflüssigen Detailregeln und antiquierten
Verwaltungspraktiken bremst die Entwicklung des Landes und gefährdet sogar die Demokratie. Patrick Bernau legt anhand einer Vielzahl von Beispielen aus dem Alltag der Menschen und Unternehmen den
Finger in die Wunde – ein Buch mit Aufreger-Potenzial, das gelegentlich aber auch zum Schmunzeln einlädt. CH Beck
REZENSION
Allein schon das Inhaltsverzeichnis mit den einzelnen Kapitelüberschriften für das Problem Überbürokratisierung beweist, wie breit angelegt diese Studie ist. Eigentlich hätte man eine solche Analyse
von der regierenden Politik, den Parteien, den elektronischen Medien oder der Wissenschaft erwartet. Das Thema reicht von der Ausgangsthese, dass Deutschland leidet, dass das Problem wächst, die
Politik blockiert, Misstrauen zunimmt, Überregulierung stattfindet, vor der die Verwaltung kapituliert.
Und dann geht es in die Tiefe, es fühlen sich halt eben alle zuständig für alles, der Föderalismus treibt Blüten, die Bundesländer bilden zuweilen Kartelle, die Verwaltungsverantwortlichkeiten
sind verworren. Jeder fühlt sich irgendwie zuständig. Die linke Hand weiß nicht was die rechte tut. Zu allem Übel kommt die regularienwütige Europäische Union hinzu, die das Ganze noch satt auf
die Spitze treibt. Der Papierkrieg blieb erhalten und wurde gesteigert, obwohl das papierlose Büro versprochen worden ist. Unter anderem von Windows. Wirklichkeit ist jedoch, dass alles ausgedruckt
wird, weil man dem System nicht traut, alles dokumentiert wird, weil viele Hierarchen meinen, sie müssten Kontrolle ausüben und die Eliten wollen/müssen beweisen, dass sie auch für etwas da
sind.
Ein kluger Satz leitet ein Kapitel ein: Die beste Moral bringt die schlechtesten Gesetze. Diesen Eindruck kann man nur bestätigen. Die Symbolpolitik tut ein Übriges. In den Untiefen der
Verwaltung entsteht keine Innovation, dennoch endet dieses Buch mit dem optimistischen Kapitel „Wie alles trotzdem funktionieren kann“ - in den unterschiedlichen Bereichen Politik, Verwaltung und
Wissenschaft, aber bitte auch bei uns selbst. Der Autor ist optimistisch und schreibt „Es kann also funktionieren.“
Schauen wir also in dieses Kapitel noch einmal näher hinein und halten wir fest: Fast 30 Milliarden bedeutet der Aufwand für die Befolgung neuer Gesetze. Dokumentationspflichten haben
überhandgenommen. Der Staat selbst wird überfordert, übrigens auch vom Volk, und das Volk fühlt sich gegängelt und wählt unzufrieden Populismusparteien.
Der existierende Personalmangel ist auch nicht gerade dafür geeignet das Problem zu lösen. Lange Planungsdauern führen die Bürokratiemonster erst recht vor. Wer soll also die Gesetze nun überprüfen,
eine neue zu bildende Bürokratieinstanz, die selbst bürokratisch wird und wirkt? Geschweige denn etwas verändert. Wer evaluiert Gesetze und untersucht, ob sie auch wirklich die Wirkung haben,
die diese behaupten? In der Digitalisierung sehen viele eine Chance zur Vereinfachung der Verwaltungsgesetze. Bisher hat die Digitalisierung eher die Bürokratie auf die Spitze getrieben als
vereinfacht. Eigeninitiative wird gefordert, positive Beispiele für Bürokratieveränderungen sollen Veränderungen bringen.
Der deutsche Wahnsinn zeigt sich im Gesundheitssystem: Rund drei Stunden am Tag arbeitet ein Arzt an bürokratischen Themen, bei Krankenpflegern ist es nur wenig weniger. Würde man die
bürokratische Belastung im deutschen Gesundheitssystem nur halbieren, könnte man die Arbeitskraft von rund 30. 000 in Vollzeit arbeitenden Ärzten gewinnen, allein in den Krankenhäusern rund 10.000
Ärzte, und von mehr als 60. 000 Krankenpflegern.
Ich warte gerade auf einen internistischen Termin vier Wochen. In solchen Zeiträumen kann man längst unter der Erde liegen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Also Herr Merz übernehmen sie,
bauen sie Bürokratie ab und teilen Sie dies mündlich und nicht per Mail, WhatsApp oder brieflich bitte auch Herrn Klingbeil mit. Und wo Vertrauen herrscht, müsste das eigentlich nicht dokumentiert
werden.
Patrick Bernau leitet die Ressorts Wirtschaft und Wert der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zuvor verantwortete er von 2012 bis 2018 die
Online-Wirtschafts- und -Finanzberichterstattung der F.A.Z. Davor wiederum hat er seit 2006 für die Sonntagszeitung gearbeitet. Im Ressort „Wirtschaft / Geld und Mehr“ beobachtete er vor allem die
IT-Wirtschaft, die Börse und die Wirtschaftsforschung.
Patrick Bernau Bürokratische Republik Deutschland Report aus einem überregulierten Staat CHBeck
Georges Simenon - ein Nicht-Maigret
Staatsanwalt Luisa ist überrascht, er findet in seinem Haus in einem Bett im zweiten Stock einen Unbekannten, der in dem Moment stirbt, als der Anklagevertreter das Zimmer betritt. Der Staatsanwalt vermutet ein Verbrechen, und so entwickelt sich nach und nach, der Dramaturgie eines George Simenon folgend, eine verwickelte Geschichte über eine Bande halbkrimineller Jugendlicher, die wie so oft im Alkohol-Dunst Verbrechen begehen, um sich gegenseitig zu imponieren. Die Gruppe hatte den fremden Toten bei einem Autounfall schwer verletzt und in das Obergeschoss des Staatsanwaltes verschleppt. Bei dem Toten handelte es sich um einen verurteilten Verbrecher. Wollte die Bande das Opfer auf einfache Art und Weise loswerden? Wer hat den Pistolenschuss abgegeben?
Es ist ein Simenon-Roman, der wie so oft eine starke facettenreiche Geschichte erzählt, interessante Charaktere beschreibt, ihr verborgenes Leben klarlegt und mit psychologischer Schärfe durchdringt. Nebenbei wird mit erzählt, dass der Staatsanwalt einem leichten Alkoholismus erliegt, denn immer, wenn er depressiven Überdruss verspürt, greift er zu zwei, drei Gläsern Rotwein. Auch der Autor aus Liège trank gerne zuerst mässig und später viel. Simenon war in Europa ein maßvoller Trinker, der sich erst in den USA zum Alkoholiker entwickelte.
Das Buch ist eher eine psychologische Studie denn ein Krimi, wie P. D. James im Nachwort schreibt.
Aber ist das bei Simenon nicht immer so?
Es ist wie bei Balzac eigentlich die Comédie humaine des menschlichen Lebens, die mitunter auch tödliche Pointen hat. Die knappen treffsicheren Dialoge, die präzisen Beschreibungen, die ungemütlichen
Wetterzustände, der Straßenbelag, die umgebende Landschaft, das ist immer fast geradezu pointilistisch detailliert beschrieben, und dennoch in knappe Sätze gepackt.
Es sind die scheinbar gewöhnlichen Männer und Frauen, die Simenon in seinem Roman „Fremd im eigenen Haus“ beschreibt. Ein Weihnachtsgeschenk und Buch für Freunde der europäischen Kriminalromane, die
oft in Frankreich spielen, dieser hier ist aber von einem Belgier geschrieben worden, der fast die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hätte, der Beginn der McCarthy-Ära hielt ihn dann aber
doch davon ab.
Georges Simenon, geboren am 13. Februar 1903 im belgischen Liège, ist der »meistgelesene, meistübersetzte, meistverfilmte, mit einem Wort: der erfolgreichste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts« (Die Zeit). Seine erstaunliche literarische Produktivität (75 Maigret-Romane, 117 weitere Romane und über 150 Erzählungen), seine Rastlosigkeit und seine Umtriebigkeit bestimmten sein Leben: Um einen Roman zu schreiben, brauchte er selten länger als zehn Tage, er bereiste die halbe Welt, war zweimal verheiratet und unterhielt Verhältnisse mit unzähligen Frauen. 1929 schuf er seine bekannteste Figur, die ihn reich und weltberühmt machte: Kommissar Maigret. Aber Simenon war nicht zufrieden, er sehnte sich nach dem »großen« Roman ohne jedes Verbrechen, der die Leser nur durch psychologische Spannung in seinen Bann ziehen sollte. Seine Romane ohne Maigret erschienen ab 1931. Sie waren zwar weniger erfolgreich als die Krimis mit dem Pfeife rauchenden Kommissar, vergrößerten aber sein literarisches Ansehen. Simenon wurde von Kritiker*innen und Schriftstellerkolleg*innen bewundert und war immer wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch. 1972 brach er bei seinem 193. Roman die Arbeit ab und ließ die Berufsbezeichnung »Schriftsteller« aus seinem Pass streichen. Von Simenons Romanen wurden über 500 Millionen Exemplare verkauft, und sie werden bis heute weltweit gelesen. In seinem Leben wie in seinen Büchern war Simenon immer auf der Suche nach dem, »was bei allen Menschen gleich ist«, was sie in ihrem Innersten ausmacht, und was sich nie ändert. Das macht seine Bücher bis heute so zeitlos.
Georges Simenon Fremd im eigenen Haus KAMPA
Der Nahe Osten-so fern
Die preisgekrönte Journalistin, Nahost-Expertin und Bestsellerautorin vermittelt
im Nahost-Komplex zwischen den Welten und weckt Empathie
für alle Seiten.
Wenn man versucht, die Geschichte des Nahen Ostens zu verstehen, ist es, als
würde man die Züge eines Schachspiels verfolgen – jedoch auf vielen
Schachbrettern gleichzeitig. Jeder Zug auf dem einen Brett löst Bewegungen auf
den anderen aus. Der 7. Oktober hat das vernetzte Spiel im Nahen und Mittleren Osten noch einmal in eine neue Phase katapultiert: Inzwischen ist die Hamas keine Gefahr mehr, die Hisbollah im Libanon
massiv geschwächt, die Islamische Republik Iran hat ihren Verbündeten in Damaskus verloren. Die gesamte Region kann sich in Richtung Frieden bewegen – oder ein einziger falscher Zug lässt alles in
sich zusammenbrechen. Natalie Amiri hat auf ihren Reisen unter anderem mit Frauen aus Gaza gesprochen,
mit Angehörigen entführter Geiseln und den kurdischen Kämpferinnen in Rojava. Ihr Buch bietet keine einfachen Antworten. Es ist ein Mosaik aus Stimmen, Ängsten, Hoffnungen und Widersprüchen.
Aus Geschichten, die zeigen, wie eng alles miteinander verknüpft ist – und dass wir nur verstehen können, wenn wir die Komplexität aushalten. (PENGUIN)
REZENSION
Der Nahe Osten ist uns so fern, obwohl er doch so nah ist. Der terroristische und mörderische Anschlag auf eine Party junger Leute und der Gegenschlag Israels mit schweren Angriffen auf die Hamas hat
uns wieder ins Bewusstsein gerufen, dass die palästinensische Frage immer noch nicht geklärt ist - nach Jahrzehnten kriegerischer Auseinandersetzungen. Und auch Friedensbemühungen.
Natalie Amiri, Deutsch Iranerin und studierte Islamwissenschaftlerin, Moderatorin des ARD-Weltspiegels und im Iran erfahrene Leiterin des ARD-Büros in Teheran sowie mehrfach ausgezeichnete
Publizistin, legt mit diesem Werk über den Nahostkomplex eine umfangreiche Analyse vor, die von Menschen, Träumen und Zerstörung berichtet. Schon eingangs zitiert sie den Bekenntnissatz Margot
Friedländers: „Es gibt kein jüdisches, kein muslimisches, kein christliches Blut, es gibt nur menschliches Blut.“
Es ist oft genug im Nahen Osten vergossen worden.
Die Journalistin berichtet von den hektischen Berichterstattungszeiten, als am 7 Oktober 2023 die Hamas den Angriff startete. Die Autorin ist sich schon eingangs bewusst, dass in ihrem Buch
auch jeder Satz, jeder Ton sofort Teil des Konflikts wird im Diskurs. Insofern war es für sie nicht leicht, dieses Buch zu schreiben, denn was schwarz auf weiß zu lesen ist, kann besser und schneller
überprüft werden, als die flüchtige quicke Berichterstattung in den schnellen Medien Rundfunk, Fernsehen oder Internet.
Apropos Internet: als um 6: 29 Uhr der Anschlag beginnt, werden schon die ersten SMS- Informationen ausgetauscht. Da heißt es zum Beispiel: „Schaut mal, wie krass das ist. Hier sind anscheinend
Terroristen bei uns.“ Was schwatzhaft gemeint war, wird brutaler Ernst.
Natali Amiri schildert minuziös die Einzelheiten der Geschehnisse, berichtet von den Geiseln, der Reaktion Netanjahus, zitiert aus Interviews, die sie geführt hat, etwa mit Ehud Olmert, besucht das
Westjordanland, untersucht die Berichterstattung der deutschen Medien, schaut in den Libanon, spricht über die syrische Befreiung, und natürlich geht ihr Blick auch in den Iran, denn dort war sie
lange Korrespondentin.
Die alles entscheidende Frage wird am Schluss gestellt: Wie schwer ist Frieden? Da braucht man nur einen Blick in die Ukraine werfen, um schon von vorneherein ratlos zu werden.
Wenn man sich aber dennoch um eine Antwort bemühen will, da findet die Autorin im Buch des Nahostexperten und Historikers Daniel Gerlach Antworten. Er weist auf die unterschiedlichen Definitionen des
arabischen Raums hin, was Frieden wirklich bedeutet, und dass in diesem Raum der Begriff davon, was ist ein positiver Frieden durch Abbau struktureller Ungerechtigkeit und der Schaffung eines
gesellschaftlichen Gleichgewichts im Nahen Osten, in diesem politischen Raum völlig fehlt.
Gerlach fordert die Staaten der Welt müssten klar sagen: Palästina existiert für uns!!! Eine Voraussetzung ohne Bedingungen, bevor ein positiver politischer Prozess überhaupt beginnen könnte. Gerlach
meint, Frieden sei kein Geschenk, er sei ein Recht und er beginne mit Gerechtigkeit. Schwer durchzusetzen!
Ein Buch für alle, die den Nahost-Konflikt besser verstehen wollen und versuchen, die Probleme des Nahen Ostens wirklich näher an sich heranzulassen.
Unser deutsches Interesse am Nahen Osten war leider immer schon begrenzt und ist oft genug von einer Perspektive verengt.
Ein Weihnachtsgeschenk für außenpolitisch interessierte und Weltspiegel-Zuschauer, vor allem aber für die, die entweder auf Seiten der Palästinenser oder der Israelis stehen.
Natalie Amiri, 1978 als Tochter einer Deutschen und eines Iraners in München geboren, studierte Orientalistik und Islamwissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) führte sie an die Universitäten von Teheran und Damaskus. Seit 2014 moderiert sie den „ARD-Weltspiegel" aus München. Ab 2015 leitete Natalie Amiri das ARD-Büro in Teheran. Im Mai 2020 wurde sie vom Auswärtigen Amt gewarnt, aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Iran einzureisen. Sie musste daher die Leitung des Teheraner Fernsehstudios abgeben. 2022 und 2024 wurde sie vom "medium magazin" zur Politikjournalistin des Jahres gekürt und gewann zahlreiche Preise, u.a. das „Glas der Vernunft“ (2023). Ihre Bücher „Zwischen den Welten“ (2021) und „Afghanistan“ (2022) wurden zu Bestsellern.
Der neue Hakan Nesser
Es ist Frühsommer und Prüfungszeit in Kymlinge. Sportlehrer und ehemaliges Multitalent Allan Fremling beschließt eines Abends, seinem strengen Ernährungsplan zum Trotz, eine Pizza nach Hause zu bestellen. Noch bevor sie abgekühlt ist, liegt er tot in seinem eigenen Hausflur. Zwei Schüsse in die Brust, einer in den Kopf. Inspektor Borgsen, der wegen seines melancholischen Gemüts oft Sorgsen genannt wird, soll sich der Sache annehmen. Als sich jedoch praktisch direkt unter Borgsens Balkon ein zweiter Mord ereignet, ist es Zeit für Gunnar Barbarotti und dessen Frau Eva Backman, zu übernehmen. Die Morde geben Rätsel auf. Fast sieht es so aus, als stelle jemand sich die Frage: Ist es immer falsch zu töten? BTB
REZENSION
Hakan Nesser ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens und Bestsellerautor. Es gelingt ihm auch wieder in seinem neuesten Roman, Aktuelles in die Handlung mit einzupflegen, ohne dass es zu aufdringlich oder nervig wäre. Er erwähnt den grausamen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine. An verschiedenen Stellen benennt er die wilde Politik einiger Diktatoren weltweit und nennt auch ihre Namen, und insinuiert sogar damit, dass sie weggeräumt gehörten; auf welche Art und Weise lässt er offen, aber der Leser liest es als finale Lösung deren Existenz und damit unserer augenblicklichen Probleme. Auch die allgemeinen Modetrends oder der musikalische Geschmack oder Wörter und Phrasen, die in der modernen Welt so üblich geworden sind, kommen in dem modernen Styling dieses Romans vor.
Nesser lebt die klaren, kurzen Sätze, und so beginnt sein Roman mit diesem: „Es war ein Abend im Mai.“ Unspektakulärer könnte man einen Krimi oder besser Thriller nicht beginnen.
Kurz zur Handlung: Ohne zu viel zu verraten, da ist ein alerter Sportlehrer, der seine Schüler tyrannisiert und mobbt. Er bestellt sich eine Pizza und liegt plötzlich tot im eigenen Hausflur, weil
zwei Schüsse in Brust und Kopf ihn töten.
Es kommen zwei weitere Morde hinzu, und nun liegt es am Ermittlungsteam unter Gunnar Barbarotti und dessen Ehefrau Eva Beckmann die Mordrätsel aufzuklären. Wo liegen die Motive für die
Tötungsdelikte? Hängen sie womöglich zusammen? Nach und nach entwickelt sich ein Spannungsbogen, der den Roman zu einem Page-Turner macht.
Zitieren wir einen packenden Satz aus Kapitel 2, er beginnt so: "Wenn du ein elfjähriges Einzelkind bist und erfahren hast, dass deine Mutter deinen Vater ermordet hat, hast du ein
Problem.“
Drei Aspekte sind in diesem Roman besonders interessant, ein weiterer Beamter mit Spitznamen „Sorgsen“ ist auch mit an Bord und ermittelt. Er leidet jedoch unter dem post-Covid-Syndrom. Die
Dialoge sind pfiffig kurz gehalten und treiben das Stimmungsbild voran. Das dritte Charakteristikum, wir wissen bald wer da als Mörder unterwegs ist. Hakan Messer weiß, wie man Bestseller schreibt,
und so ist auch diesem Buch eine große Leserschar gewiss.
Hakan Nesser Ein Fall für Gunnar Barbarotti Eines jungen Mannes Reise in die Nacht BTB
Håkan Nesser, geboren 1950, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig Sprachen übersetzt und mehrmals erfolgreich verfilmt worden. Håkan Nesser lebt auf Gotland.
Harald Loch rezensierte vor 4 Jahren das Buch
Kompass in der Zeitenwende
Heinrich August Winkler ist einer der bedeutendsten deutschen Zeithistoriker. Er ist aber auch einer der einflussreichsten deutschen Intellektuellen, der die politischen Debatten unseres Landes bis heute prägt. In diesem Buch erinnert er sich an seinen Lebensweg von Königsberg über Süddeutschland nach Berlin, an Begegnungen und Erlebnisse, an Gespräche und Kontroversen, an Irrtümer und Erkenntnisse. Doch es sind keine Memoiren im klassischen Sinne. Es ist ein Rechenschaftsbericht über ein Leben, das der historisch-politischen Selbstaufklärung der Deutschen gewidmet ist. Daher bieten diese Erinnerungen auch etwas, das heute so nötig ist wie lange nicht mehr: einen politisch-moralischen Kompass in den Zeitenwenden unserer Epoche. CHBECK
Gefährdungen der Demokratie durch Autokraten
China, Ungarn oder die USA: Weltweit befinden sich populistische Parteien im Aufschwung – oder autokratische Regime präsentieren sich als das leistungs- und zukunftsfähigere Staatsmodell. Wie ist es den modernen Diktatoren gelungen, sich in so vielen Ländern die Macht zu sichern und eine konkurrenzfähige Wirtschaft aufzubauen – obwohl es doch eine gesicherte Erkenntnis der Ökonomie zu sein schien, dass Innovation und Fortschritt nur in einer freiheitlichen Gesellschaft gedeihen können? Welche Kräfte lähmen die liberalen Demokratien, und wie könnten sie im weltweiten Wettlauf wieder an Boden gewinnen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Buches, in dem SPIEGEL-Journalist und Wirtschaftsexperte Michael Sauga eine Nahaufnahme der modernen Alleinherrschaften liefert: ihres Aufstiegs, ihrer Strukturen und Strategien, ihrer Probleme und ihres möglichen Falls. Seine Analyse korrigiert lang gehegte Annahmen über die Entstehung und Beharrungskräfte autokratischer Systeme und ist ein dringender Aufruf, auf die autokratische Herausforderung zu reagieren – und zwar auch mit einer ökonomischen Antwort. DVA
Politischer Frühling mit Merz?
Friedrich Merz steht vor gewaltigen Aufgaben. Während Trump und Putin die alte Weltordnung zerstören, droht die AfD die politische Mitte in Deutschland zu sprengen. Der neue Bundeskanzler will ganz anders regieren als die abgewählte Ampel-Koalition. Dabei sind die Herausforderungen, an denen die Ampel krachend gescheitert ist, dieselben geblieben: Wirtschaftskrise, Klimawandel, Migration und Aufrüstung der Bundeswehr. Ist Friedrich Merz, der bislang keine Regierungserfahrung hat und schon angeschlagen sein Amt antritt, seiner Aufgabe gewachsen? Und was muss er aus dem Desaster der Ampel lernen, um die vielleicht letzte Chance zu nutzen, unsere Demokratie vor dem endgültigen Aufstieg der extremen Rechten zu bewahren? In dieser entscheidenden Phase der deutschen Politik erzählt Bestsellerautor Robin Alexander die Geschichte hinter den Kulissen: von Merz‘ Tabubruch mit der AfD und Geheimgesprächen mit Olaf Scholz bis hin zum Drama um das Billion-Schuldenpaket. Ein packend erzähltes Buch, das zeigt, warum die politisch Handelnden in einer zersplitterten Parteienlandschaft und einer aufgeheizten Öffentlichkeit immer weniger imstande sind, die großen Herausforderungen zu bewältigen. (PENGUIN)
Rutschfeste Badematten - im Angebot
Manchmal ist es verdammt nervig was einem passieren kann. Da schickte mir der Autor, in Frankfurt am Main langjähriger Nachbar und Freund Eldad Stobezki sein Buch „Rutschfeste Badematten und
koschere Mangos“. Vom Titel allein schon fasziniert, steckte ich es in meinen Koffer und nahm es zur Buchmesse nach Frankfurt mit. Das hätte ich nicht tun sollen, denn von da an war es spurlos
verschwunden. Es war keineswegs unter eine Badematte gerutscht, auch nicht im Hotel auf dem Nachttisch vergessen worden. Ich suchte es überall, es tauchte einfach nicht wieder auf. In meiner
Bibliothek war es auch nicht abgeblieben. Ein Jahr lang suchte ich danach. Vergebens!
Diese Alltags-Geschichte, die ich jetzt am Anfang der Rezension erzähle, könnte genauso in diesem Buch stehen, denn wie heißt es so schön im Englischen „shit happens“.
Ein Jahr nach der Buchmesse finde ich diesen Band, den ich so viele Monate lang gesucht habe, zwischen meinen tausend Büchern eingeklemmt in einem Verlagsprospekt von der Frankfurter Buchmesse. Dort
hat es sich versteckt, ohne mir einen Ton davon zu sagen.
Entschuldigung Eldad, diese Rezension kommt also etwas verspätet; nicht etwa, weil ich das Buch schlecht finde, im Gegenteil, ich habe es auf dem Weg zur Buchmesse in Frankfurt in einem Rutsch
durchgelesen, geradezu verschlungen und habe oft gelacht, manchmal nur geschmunzelt aber zuweilen auch manche Träne vergossen. Es sind diese Miniaturen, die du aufgeschrieben hast, die einem im
Alltag genau so passieren und die einfach erwähnenswert sind, weil sie so besonders auf uns und in uns wirken.
In den Überschriften werden sie „Kiesel“ genannt, manchmal kicke ich solche Kieselsteine auf meinem Grundstück in die Ecke, da wo sie hingehören, nur sie fallen immer irgendwo anders hin als
gewollt.
So etwas ähnliches tuen deine Worte offenbar auch. Sie fallen irgendwo hin, aber ins Schwarze treffen sie dabei immer. Ein Beispiel: „Wenn wir von zu Hause weggehen, nehmen wir immer ein Stück Heimat
mit“.
In deinen Texten spürt man oft, dass du zwei davon hast. Bei manchen Menschen sind es noch sehr viel mehr Landschaften, die unter dem Begriff Heimat subsumiert werden können. Weil sie als Emigranten
mehr Heimat im Herzen haben als ihnen manchmal lieb ist.
Es sind Schmunzelworte, die du da auflistest. Du empfindest dich als „Wortklauber“ – ein Begriff der allgemein leider negativ besetzt ist (klauben wird aber im Ursprung bei Wikipedia als „mit den
Fingerspitzen, Nägeln oder Zähnen an etwas herumarbeiten; von der Hülse oder Schale befreien, pflücken, lesen, (aus)sondern, mit Mühe heraussuchen“ bezeichnet. Einigen wir uns auf „mit Mühe
heraussuchen“. Das tust du selbst wie eine Biene, die Wörter statt Honig sammelt: Begriffe aus dem Radio, aus Büchern, aufgeschnappt in der U-Bahn und immer wieder staunend darüber, was die deutsche
Sprache doch für Spitzfindigkeiten hat.
Wo liegt bei einem Streik der Lokführer der Unterschied zwischen „Unwägbarkeiten mit „ä“ und „Unwegbarkeiten“ mit „e“.
Du bist froh darüber, dass die Sonderzeichen im Polnischen, Tschechischen, ja sogar im Spanischen immer noch existent sind, denn España, sagst du, hat zurecht immer noch eine Locke auf dem spanischen
n.
Du arbeitest mit einem PC, und angesichts der gecrashten Festplatte kommst du auf die Urform der Keilschrift zurück. Kein upload nötig.
Deine Gedanken- und Mentalitätssprünge sind faszinierend, auch lustig, etwa wenn du dem Deutschlandfunk und seiner Redaktion Kultur vorwirfst, dass der neue vorgestellte Roman nicht „Kairo“, sondern
„Kairos“ heißt. Da hast Du wirklich einen Punkt, wie man es heute so schön formuliert.
Deine Miniaturen setzen sich immer wieder mit Sprache, mit Musik, dem Jüdischsein oder auch der Homosexualität auseinander.
Du fragst die KI was „Kastrati“ sind, wir lassen es hier einmal offen, bitte selber googeln oder KI austesten!
Du gibst Gott die Empfehlung, er hätte besser auf die Arche Noah verzichten sollen, dann hätte es ein besseres „Reset“ der Schöpfung geben können.
Wir begleiten dich in Buchhandlungen, wo Du mitunter Empfehlungen gibst oder auch an die Aldi-Kasse, wo wir den Aldi-Alltag miterleben.
In der Tat, das sind interessante geographische und intellektuelle Sprünge.
Immer ist es die Neugierde, die dich antreibt: Das WissenWollen, und das Ergebnis dann aber auch notieren und festhalten müssen, für deine Freunde oder für dein Buch.
Es geht mir auch so, dass ich mich ungern von Büchern trenne. Mein ganzes Haus ist voll davon, und ich kann kein einziges neues mehr in ein Regal stellen. Verzeih mir also bitte, wenn in diesem Wust
dein Büchlein untergegangen ist. Ich werde es nun in Ehren halten und an einem schönen besonderen Platz postieren.
Dieser Tage wollte ich drei Kisten voll aktueller Bücher an Büchereien weitergeben, natürlich ohne etwas dafür zu verlangen, ich will doch nicht an Rezensionsexemplaren etwas verdienen. Alle sagten
„um Gottes Willen wir haben keinen Platz dafür“. Die Gefahr besteht also auch weiterhin, dass Bücher sich einfach so davon machen und verschwinden, ohne einen Laut abzugeben.
Wenn ich das nächste Mal Radieschen einkaufe, werde ich mich an diese kleine Kiesel-Miniatur erinnern, als die Dame sagte, sie möchte sich die Radieschen noch von oben anschauen, als sie Radieschen
einkaufte.
So geht es mir auch, verzeih also bitte, wenn ältere Herrschaften manchmal etwas schusselig mit Büchern umgehen.
Maria Gazzetti, die lange Jahre das Frankfurter Literaturhaus geleitet hat, schreibt über dein Buch im Nachwort, deine Texte seien tagebuchartige, kurze, liebevoll geschriebene Miniaturen aus dem
Alltag, aus Lektüren über Radiosendungen, Musik und Opernbesuche, über Politik und das aktuelle katastrophale Weltgeschehen. Genau getroffen!
Ich bin gespannt, wann Du demnächst deinen zweiten Band vorlegst und über den Verrückten aus Washington berichten wirst. Auf diesen Worte-Spaß freue ich mich schon.
Eldad Stobezki Rutschfeste Badematten und koschere Mangos Edition W
Trojanow: „Das Buch der Macht. Wie man sie erringt und (nie) wieder loslässt“
Wie Karl Marx schon so treffend spottete: „Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Farce“, so gibt es auch den umgekehrten Prozess. Nachzulesen ist er in Ilja Trojanows Satire „Das Buch der Macht.“ In dieser literarischen Prosaadaptation des 1897 entstandenen Großgedichts des bulgarischen Autors Stojan Michailowski „Buch für das bulgarische Volk“ folgt nicht die Farce als Wiederholung der Geschichte, sondern die Gegenwart folgt der geradezu prophetischen Satire, so dass man versucht ist hinzuzufügen: „entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig“. Ob sie so zufällig wären, werden die Leserin und der Leser geneigt selbst entscheiden. Worum geht’s?
In 15 Tages- und Nachtlektionen enthüllt der Wesir, also der Regierungschef im osmanischen Kalifat, seinem als Nachfolger vorgesehenen Neffen, den er mit orientalischen Koseworten anredet, das
Geheimnis der Macht oder, so der Untertitel des Buches, „wie man sie erringt und (nie) wieder loslässt“. Die satirische Unterweisung hat es in sich. Sie fächert nicht nur die vielleicht auch in der
muslimischen Welt als Todsünde geltenden menschlichen Unarten als für den Machterhalt unerlässlich auf, sondern fordert dafür auch lässlichere Sünden trotz ihrer Hässlichkeit als notwendig. Der Wesir
preist nicht nur Mord und Totschlag, Bestechung und Befriedigung der Eitelkeit, er kommt auf autoritäre Tricks, die einem sämtlich bekannt scheinen. Ein jeder erlebt sie so oder in einer der vielen
Varianten in seiner Umgebung. Trojanow verfällt in seinem Remake auf einen genialen Trick. Er teilt sein Buch in zwei unterschiedliche Seiten: Rechts steht in blauen Lettern (man beachte die Farbe!)
die Originalsatire vom Machterhalt. Links steht in roten Buchstaben wie eine dialogische Unterbrechung des Redeflusses des Wesirs ein passender Text von Leuten, die dazu etwas zu sagen haben. Z.B.
bekennt der Wesir: „In den letzten dreißig Jahren habe ich mit zielstrebiger Beharrlichkeit Gift in das Maul der Öffentlichkeit gegossen, ein Gemisch aus Lügen, Verleumdungen und Unterstellungen“.
Daneben stehen Jonathan Swift mit der Sentenz „Die Falschheit fliegt und die Wahrheit kommt hinterhergehinkt; wenn also die Menschen der Täuschung gewahr werden, ist es bereits zu spät.“ Oder Hannah
Ahrendt: „Niemand hat je Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet.“
Dem Terrorismus der Macht, in blauer Schrift auf den rechten Seiten, folgen im virtuellen Dialog manche Apologeten der Macht wie der Kronjurist der Nazis Carl Schmitt: „Souverän ist, wer über den
Ausnahmezustand entscheidet.“ Andere widersprechen in roter Schrift auf den linken Seiten, wie z.B. Konstantin Wecker mit seinem Lied „Einen braucht der Mensch zum Treten…“ Heinrich Heine steht
auf einer linken, roten Seite mir seinem Gedicht von den „Zuckererbsen für jedermann“. Oder auch Erasmus von Rotterdam mit dem klaren Wort: „Macht ohne Güte ist reine Gewaltherrschaft“. Oder genauso
klar der „rote, linksstehende“ Immanuel Kant: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“
So liest sich das Buch auf weißem Papier in bleu-blanc-rouge unterhaltsam. Es ist abwechselnd gebildet und perfide wie eine Satire auf die Gegenwart – geschrieben vor mehr als 100 Jahren. Ein
erhellendes Nachwort von Ilija Trojanow zollt dem Dichter der Vorlage, seinem bulgarischen Landsmann Stojan Michailowski und der „evidenten“ Aktualität dessen Großpoems eine treffende
literaturgeschichtliche und zeitpolitische Reverenz.
Harald Loch
Ilija Trojanow: „Das Buch der Macht. Wie man sie erringt und (nie) wieder loslässt“
Die Andere Bibliothek, Berlin 2025 275 S. Originalausgabe nummeriert (im Schuber) 48 EUR, Extradruck (Hardcover) 26 EUR
Macht II - Macht im Umbruch - Variante Münkler
Welchen Beitrag kann die Politikwissenschaft zu politischen Entscheidungen leisten? Diese Frage stellt sich bei dem wegweisenden Buch „Macht im Umbruch“ von Herfried Münkler. Es geht ihm um „Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“.
Zunächst beschreibt er die Gegenwart als das Zusammentreffen der Bedrohungen durch Russland mit dem Rückzug der USA aus der atlantischen Verbundenheit. Er stellt sodann die Gefahren für den
Industriestandort Deutschland aus China, starke, durch Populisten beförderte Zentrifugalkräfte in der EU und einen wachsenden Migrationsdruck aus dem Süden neben der immer sichtbarer werdende
Klimakrise fest. Er problematisiert den Stand des freiheitlich demokratischen Rechtsstaats und seine Herausforderungen durch den Populismus von rechts und links. Dabei legt er den Finger auf eine von
ihm ausgemachte Effizienzwunde – die bremsenden Einspruchsrechte gegen wichtige Infrastrukturprojekte. Ob er damit auch große Teile der Zivilgesellschaft, nicht nur die „Omas gegen rechts“ trifft,
lässt er offen.
Die Grenzen Europas behandelt er als „geopolitische Herausforderung“.
Das Offenhalten der Grenzen („Wir schaffen das“) hat er mit guter Begründung für notwendig gehalten. Die danach erforderliche Öffentlichkeitsarbeit nach innen und das Einfordern europäischer Solidarität seien dagegen vernachlässigt worden und haben zum Erstarken populistischer Parteien beigetragen. Politische Führung hätte gefehlt; er klagt sie auf allen Ebenen ein und verlangt sie vor allem in und von Deutschland in Europa. Deutschland sei das Land in der Mitte Europas, sein bevölkerungsreichstes und wirtschaftlich stärkstes Land und sei verpflichtet, die politische Führung im Sinne eines „servant leaders“, also einer dienenden Führung anzustreben und einzunehmen. Nicht allein: Münkler stellt sich eine Führungsachse Paris-Berlin-Warschau, ergänzt durch eine Nord-Süd-Achse mit Italien bzw. Spanien und dem Norden, evtl. wieder mit Großbritannien in virtuos zu gestaltender Form vor. Diesem Kerneuropa mit einer innerhalb dieser Gruppe „dienend“ führenden Deutschland, misst er die mehrheitlich gebildete Entscheidungsgewalt über die Außen- und die Verteidigungspolitik Europas zu.
Die kleineren Staaten, die mir ihrer Vetomacht wie das Ungarn Orbans zunehmend nerven, könnten für den Verlust ihres Vetorechts „soft entschädigt“ werden, etwa mit größerer Duldung ihrer innerstaatlichen Sonderregelungen. Um den europäischen Führungskern und zweiten Kreis der ihrer Vetomacht beschnittenen, vor allem ostmitteleuropäischen Länder sollte sich ein dritter Ring als „abgeflachte“ Peripherie von Staaten wie die Türkei oder Ländern des Maghreb bzw. Ägypten, an Europa assoziierte Länder gruppieren. Diese Vision in politische Realität umzusetzen könne nur einer starken Führung gelingen. Der Umbau Europas nach diesem Muster würde seine Handlungsfähigkeit stärken, seine Reaktionsgeschwindigkeit vergrößern und auch Kräfte für eine eigene Rolle neben den anderen Akteuren der Weltpolitik freisetzen.
Münkler stellt in Frage, ob in Deutschland der Wille und das politische Personal vorhanden seien, die Risiken und Kosten einer solchen Rolle zu tragen. Voraussetzung dafür sei die wirtschaftliche
Erholung aus dem aktuellen Stillstand. Hierfür hält er eine Entbürokratisierung, den Rückbau der Verrechtlichung selbst kleinster unternehmerischer Entscheidungen und einen kräftigen
Investitionsschub in die Infrastruktur für notwendig. Hier nennt er vor allem Erneuerung und Ausbau der Schiene, um die Transportwege durch die Mitte Europas den Erfordernissen der Zeit
anzupassen.
In wichtigen historischen Rückblicken erinnert er sein Publikum an die Fehler deutscher Politik nach Bismarck, an die Suggestion der „Einkreisung“, die zwei Weltkriege mitverursacht habe und die
jetzt larmoyant auch von Russland als Vorwand für seine Expansionspolitik benutzt würde. Vor allem rechnet er mit dem Liebäugeln einiger politischer Akteurinnen und Akteure in Deutschland und
anderswo mit einer stärkeren Hinwendung zu Russland aus historischen Gründen ab. Dabei gingen die wichtigsten Werte des „Westens“, wie der freiheitlich demokratische Rechtsstaat, die Pressefreiheit
und wesentliche persönliche Freiheitrechte verloren.
Das alles klingt plausibel, selbst wenn man die Führungsvision für vielleicht zu wertkonservativ hält. Alle Argumente basieren aus einer schonungslosen Bestandsaufnahme der Gegenwart und sind im
Einzelnen gut belegt. Das Buch liest sich rasant, wenn man die fast apokalyptischen „Drohungen“ beim Nichtbefolgen der von Münkler angeschlagenen Agenda aushält. Das Anmahnen von Dringlichkeit beim
Umbau Deutschlands und Europas wird von außen befördert: Trump und Putin blasen uns den Marsch. Wohin er führen kann, zeigt Münkler deutlich, ab: „Es sind große Herausforderungen und gewaltige
Aufgaben, die auf die deutsche Politik zukommen, und es ist alles andere als sicher, dass sie diesen Herausforderungen gewachsen sein wird.“
Harald Loch
Herfried Münkler: Macht im Umbruch
Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
Rowohlt Berlin, 2025 431 Seiten 30 Euro
Tanzen - Singen - frei sein: Josephine Baker
Vor 50 Jahren, „am 8. April 1975 stand die 69-jährige Josephine Baker ein letztes Mal auf der Bühne. Vier Tage später erlag sie den Folgen eines Schlaganfalls“, schreibt Mona Horncastle, Kuratorin der großen Ausstellung in der Neuen Nationalgallerie in Berlin, in ihrem Nachwort zu den Memoiren unter dem Titel Das Revival der Josephine Baker. Deren Adoptivsohn Jean-Claude Bouillon-Baker datiert in seinem Vorwort den Beginn dieses Revivals: „Am 30. November 2021, einem Dienstag, sagten Paris und Frankreich ihr nicht »Adieu«, wie 46 Jahre zuvor auf den Stufen der Madeleine, die damals geschmückt war für ein nationales Staatsbegräbnis – sondern begrüßten sie an jener neuen, ewigen Ruhestätte, die sie nun beziehen würde.
Die französische Nation ehrte sie und stellte sie damit den großen Wohltätern der Allgemeinheit gleich.“ An diesem Tag kam sie auf Veranlassung des französischen Staatspräsidenten Macron ins Panthéon. Ihr eindrucksvolles Leben erzählt sie selbst zwischen Vor- und Nachwort in ihren Memoiren. Sie wurden in der Absicht geschrieben, ihre Entwicklungen zu bezeugen, sie entstanden allerdings in mehreren Teilen und in großen zeitlichen Abständen.
Ihre Leserinnen und Leser begleiten sie in ihrer Kindheit in St. Louis (Missouri), die sie in ärmlichsten Verhältnissen verbrachte. Sie war ein uneheliches Kind einer afroamerikanischen Waschfrau und
eines jüdischen Schlagzeugers. Ihr Vater trennte sich ein Jahr nach ihrer Geburt von der Familie. Sie erinnert sich an ihre Spiele, an ihre Verkleidungen, an die Morgenröte ihrer Talente, an ihre
Tierliebe und an ihren Freiheitsdrang. Daraus ergab sich auf wundersame Weise ein erstes Engagement in New York, aus dem eine „Berufung“ nach Paris folgte. Das wurde ihr Lebensmittelpunkt, sie wurde
1937 Französin und verstand ihren späteren Einsatz in der Résistance und in den Forces françaises libres als selbstverständlichen Dank an diese neue Heimat, an die Toleranz und die nicht rassistische
Gesellschaft von Paris. Von de Gaulle erhielt sie das Lothringerkreuz für ihren Einsatz als Offizierin der Luftwaffe des Freien Frankreich.
Den größten Teil ihrer Erinnerungen nimmt ihr kometenhafter Aufstieg in Paris zum Star der großen Revuen, der Cabarets ein, bald auch ihres eigenen. Sie lässt ihre Erfolge aufleben, ohne
selbstverliebt darin zu schwelgen, spricht zwischendurch von den Gerichten, die sie selbst gern kocht – „Ich habe unstillbaren Appetit“ - immer wieder von ihren Tieren, von Vögeln, Schlangen,
Krokodilbabys. Das alles trifft den persönlichsten Ton eines bescheiden gebliebenen Stars, einer jeden Abend betenden Katholikin, einer großzügigen, ihr Privatleben nicht vermarktenden Frau. Sie
bringt den Charleston nach Europa, wird bald über die Grenzen Frankreichs hinaus zum Weltstar. Sie bereist viele Europäische Länder, feiert überall Triumphe. In Berlin hetzt schon der braune Mob
gegen sie. Aber Max Reinhard versucht, sie an das deutsche Theater zu binden. Ihr Auftritt in München wird polizeilich untersagt. In Wien läuten sämtliche Glocken bei ihrer Ankunft – nicht zur
Begrüßung, sondern um die Gläubigen vor ihr zu warnen. Auch in Schweden gibt es Proteste, bis der König sie empfängt. Überall gelten ihr Tanz und ihre Hautfarbe als „anstößig“ – Rassismus
überall.
Eine Tournee in den USA konfrontiert sie mit den dortigen Rassengesetzen und der Schere im Kopf selbst bei den New Yorker Hoteliers, die keine Vermietung an Farbige vornehmen wollen, damit die
zahlende Kundschaft aus den Südstaaten nicht ausbleibt. Dramatisch erzählt sie vom Grenzübertritt über die Demarkationslinie zwischen dem de jure Farbige gleichstellenden Osten und dem nach wie vor
die Rassentrennung legalisierenden Süden. „no Jews, no dogs, no niggers“, fasst sie ihre unfassbaren, hautnah erinnerten Erlebnisse in den USA zusammen und ist heilfroh, wenn sie wieder in ihrem
Paris sein kann. Konsequent schließt sie sich nach Kriegsausbruch der Resistance an, um ihren Beitrag im Kampf gegen Nazideutschland zu leisten und singt und tanzt vor amerikanischen, britischen und
französischen Soldaten hinter der Front. Nach Kriegende nimmt sie im zerbombten Berlin an einem onzert mit Künstlern aus allen vier Siegermächten teil. Sie vertritt dabei Frankreich, dem sie im Krieg
selbstlos und ohne jedes Honorar gedient hat – jetzt ruht sie im Panthéon.
Harald Loch
Josephine Baker: „Tanzen, Singen Freiheit“ Memoiren
Die beeindruckende Lebensgeschichte der berühmtesten schwarzen Sängerin und Tänzerin
Mit einem Vorwort von Jean-Claude-Bouillon Baker und einer Einleitung von Marcel Sauvage sowie einem Nachwort von Mona Horncastle.
Aus dem Französischen übersetzt von Sabine Reinhardus und Elsbeth Rank
Reclam, Ditzingen 2025 281 S. 26 Euro
Neues Literaturhaus im Museum Finsterau
Verein
Literaturhaus DichterWald e.V. engagiert sich grenzübergreifend für historische und zeitgenössische Literatur, bietet Bildungsveranstaltungen an, Symposien, Schreibworkshops und Lesungen regionaler
und überregionaler Autoren. Unterstützt wird der Verein dabei von Journalisten, Autoren und interessierten Kulturschaffenden.
Standort: inmitten der dichten Wälder des Bayer- und Böhmerwaldes – fruchtbarer Nährboden für jegliche Art von Literatur – im Geburtshaus des Schriftstellers Paul Friedl, Freilichtmuseum Finsterau (Lkrs. Freyung-Grafenau).
Literaturhaus DichterWald e.V. organisiert von hier aus literarische Programme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Karl-Heinz Reimeier
1. Vorsitzender
Alexandra von Poschinger
2. Vorsitzende
Impressionen vor der Eröffnung
Schon 2007 erschienen
Der kaukasische Teufelskreis - ein Russlandbuch
Erich Follath Matthias Schepp Gasprom - Der Konzern des Zaren in:
Norbert Schreiber (Hg.): Russland. Der Kaukasische Teufelskreis oder Die lupenreine Demokratie Wieser Verlag Klagenfurt 2007 zuerst veröffentlicht in DER SPIEGEL.
Die Welt weiß viel über Exxon Mobil, General Electric, Toyota, Microsoft, die anderen Big Shots unter den Großunternehmen der Welt; sie weiß aber zu wenig über Gasprom. Was für ein Konzern ist das,
dessen Börsenkapitalisierung zwischenzeitlich 290 Milliarden Dollar überstiegen hat, dessen gegenwärtiger Marktwert höher ist als das Bruttosozialprodukt von 165 der 192 in der UNO vertretenen
Nationen? Wie tickt ein Unternehmen, das ein Sechstel der weltweiten Erdgasreserven kontrolliert und mit einem Fingerschnipsen die Energiezufuhr nach Westeuropa unterbrechen, unsere Wohnungen
erkalten lassen kann?
Die Gasprom-Story hat Helden und Halunken; sie spielt in den überheizten Politiker-Hinterzimmern von Moskau wie in der Eiseskälte von Sibirien, in den von Erpressung bedrohten Pipeline-Transitländern
Ukraine, Weißrussland und Armenien, »auf Schalke« im Ruhrgebiet der Malocher, wie auch im Schweizer Millionärssteuerparadies Zug und in Sotschi am Schwarzen Meer, Putins zweiter Sehnsuchtsstadt, wo
er mit den ebenfalls von Gasprom finanzierten Olympischen Spielen sein Lebenswerk krönen will. (…)
Weltmacht Gasprom, Europas wertvollster Kon¬zern, Putins Schwert: Auf dem großen Bildschirm im Kontrollzentrum kann mühelos die weltweite Expansion des Kraken besichtigt werden, dessen Fangarme in
alle Richtungen zuschlagen. Hier voll¬zieht sie sich zivilisiert, geräuschlos. Hier sind die wütenden Proteste der Regierungen nicht zu hören, für die die Gaspreise auf Weltmarktniveau angehoben
werden, weil Gasprom Geld braucht. Oder weil der Kreml Staaten bestraft, die sich wie die Ukraine und Georgien von Moskau ab- und der NATO und der EU zuwenden. Hierher dringen keine Debatten vor über
die zwischen den Herren Putin und Schröder abgesprochene Ostsee-Pipeline, den Ärger der Polen und Balten. Ungefähr in der Mitte der Europakarte blinkt die Pumpstation Kurskaja auf; von dort drehte
Gasprom der Ukraine Neujahr 2006 das Gas ab. Moskau hatte den Preis zunächst verdreifacht; die Verhandlungen mit Kiew drohten zu scheitern. Man einigte sich schließlich auf fast das Doppelte. Im
Januar 2007 wiederholte sich in Weißrussland das Spiel; tagelang stoppte Russland den Öl-Fluss. Wie¬der wurde den Westeuropäern bewusst, dass Gas und Öl für den Kreml auch politische Waffen sind.
Schon heute versorgt Gasprom rund 30 europäische Länder. Estland und die Slowakei hängen zu 100 Prozent am Gas aus dem Osten, Griechenland zu 80, Polen zu 60 und die Bundesrepublik Deutschland zu 36
Prozent.“