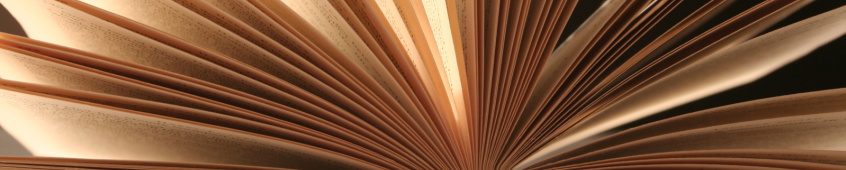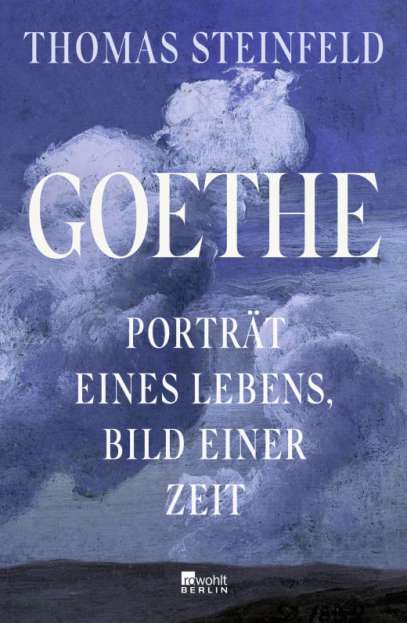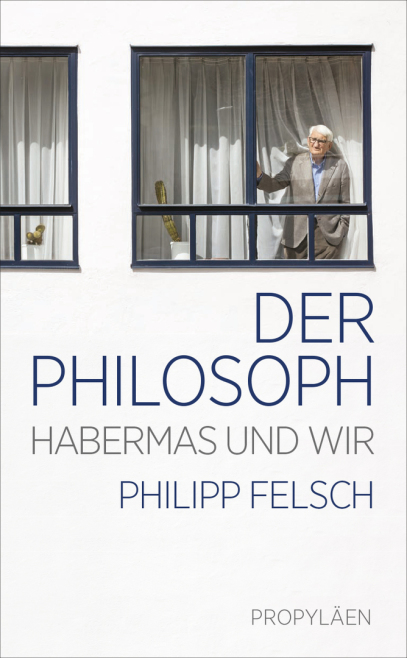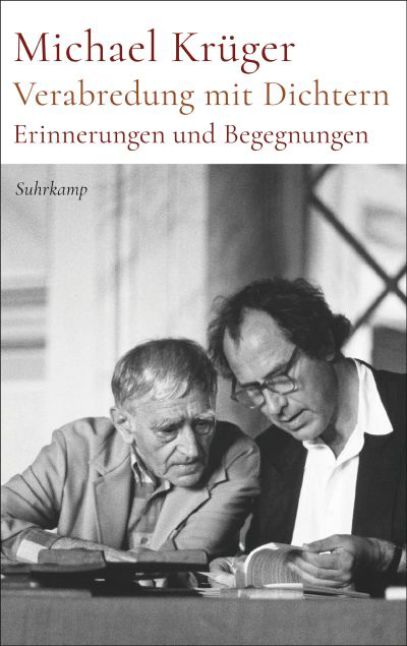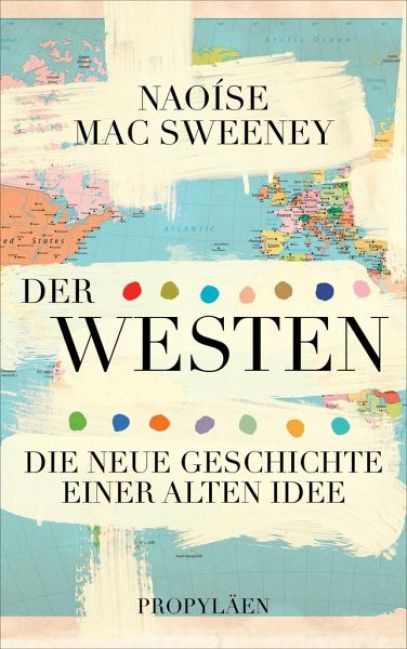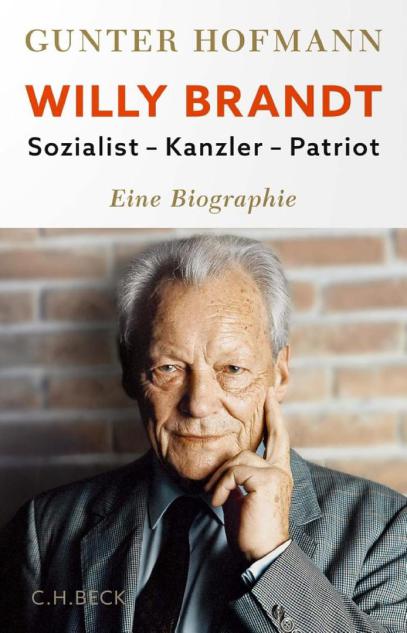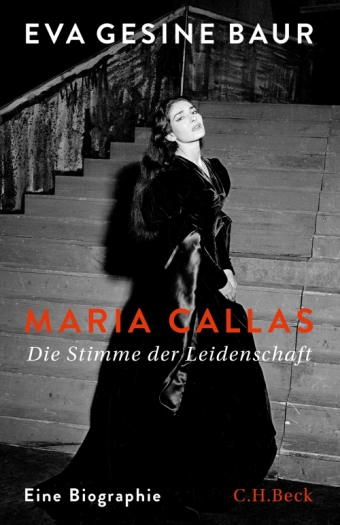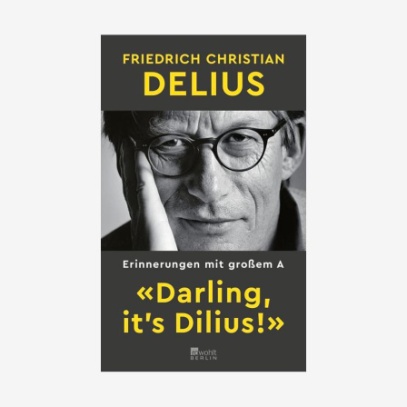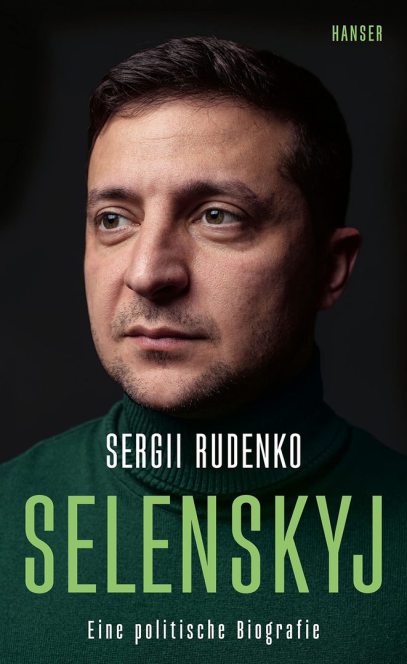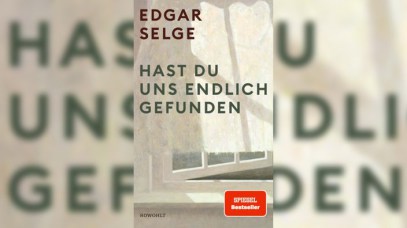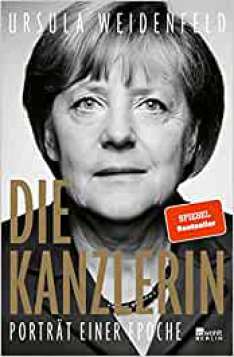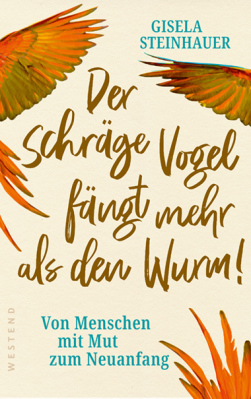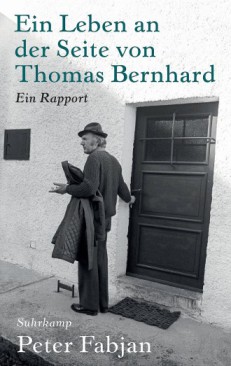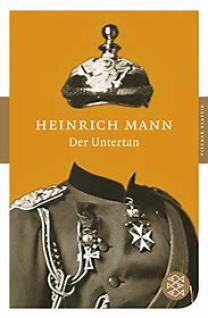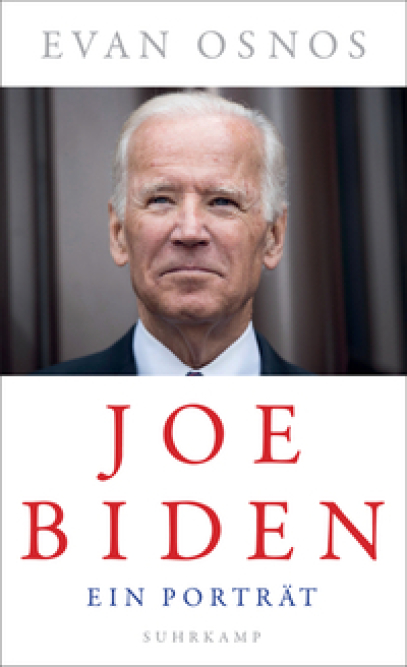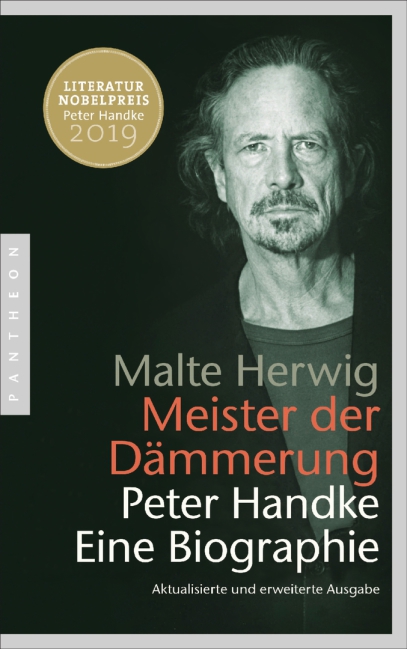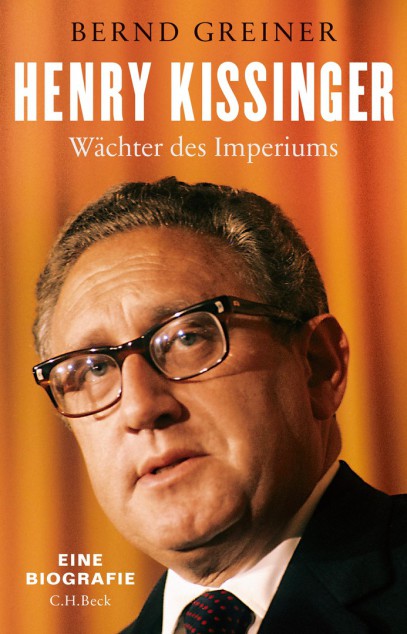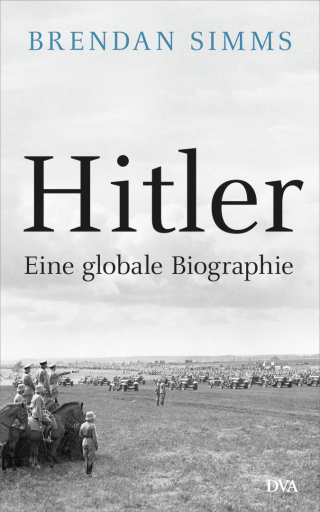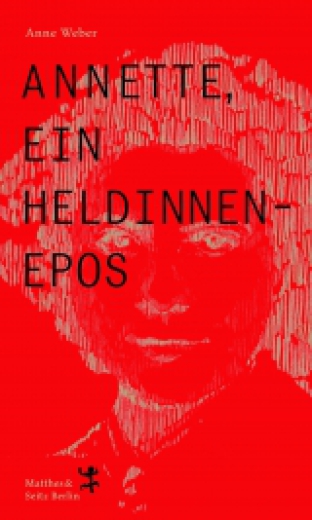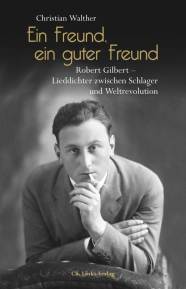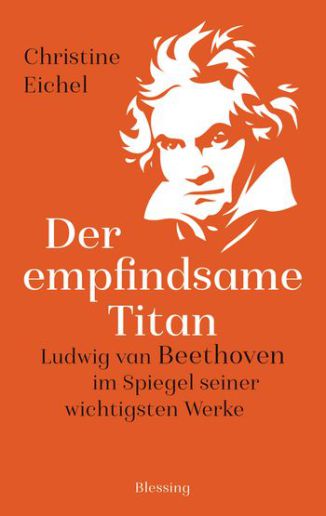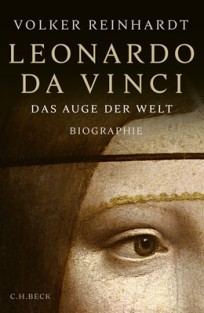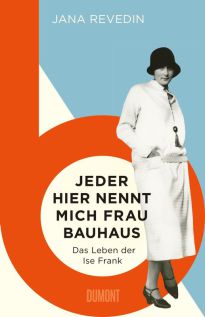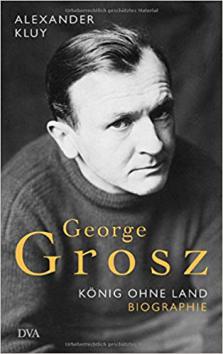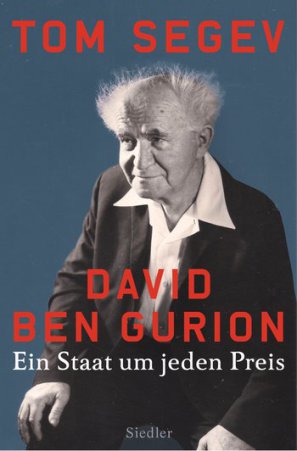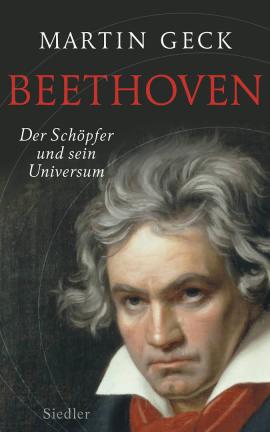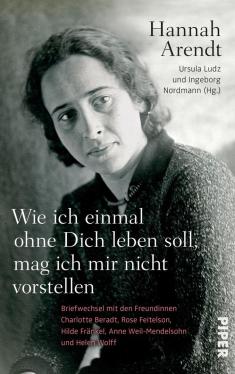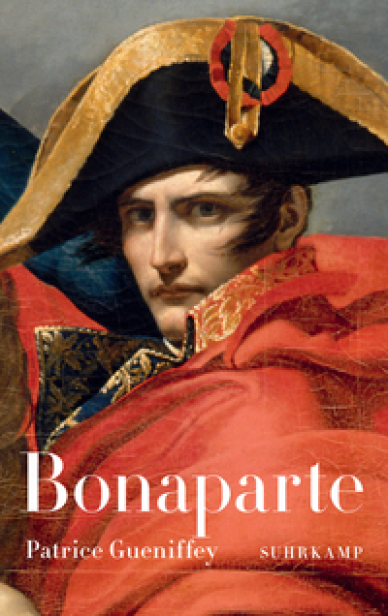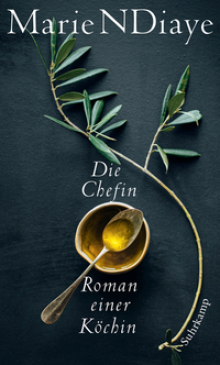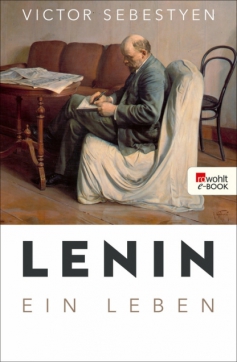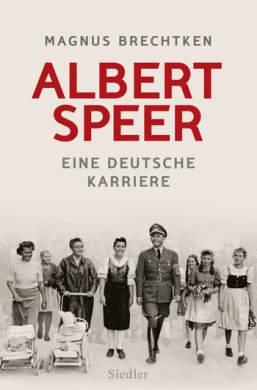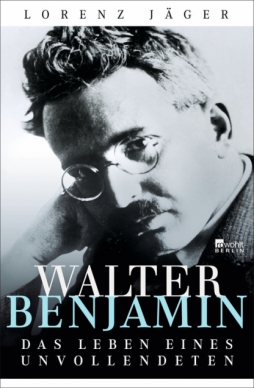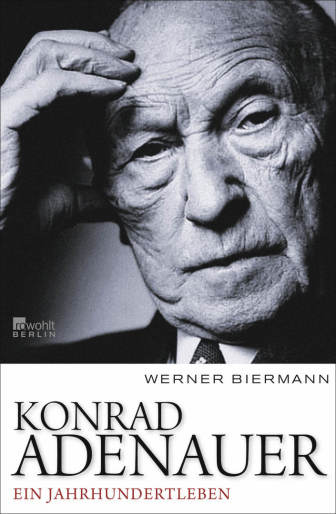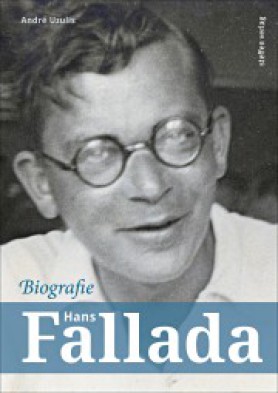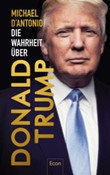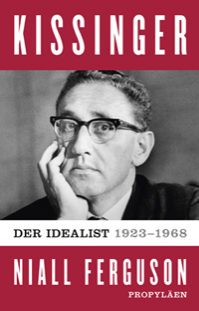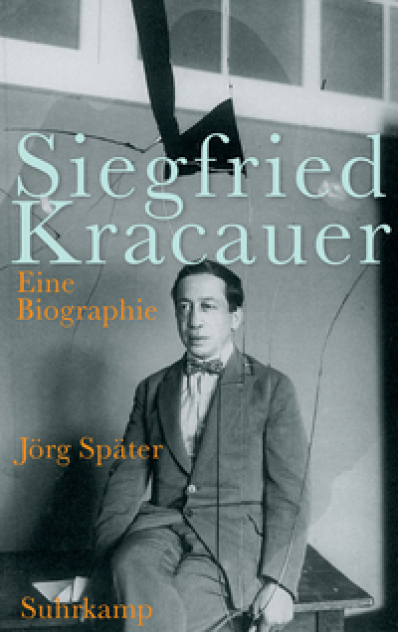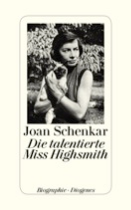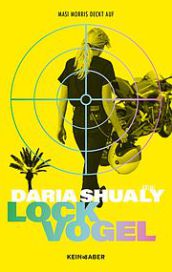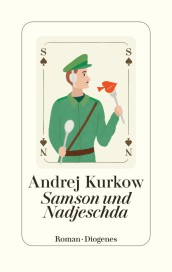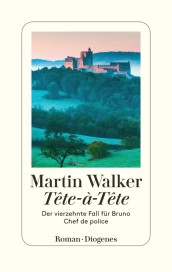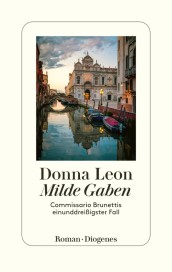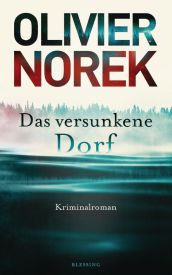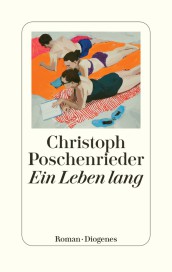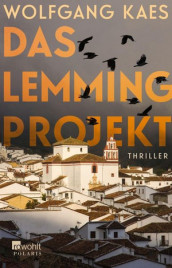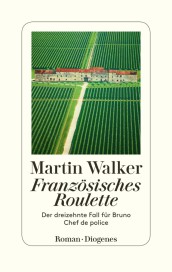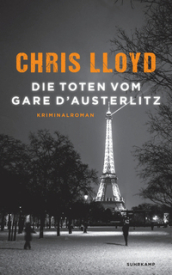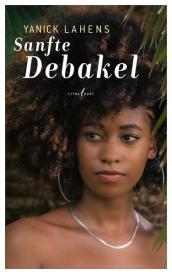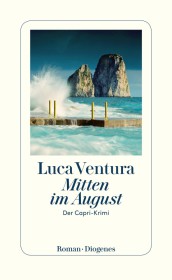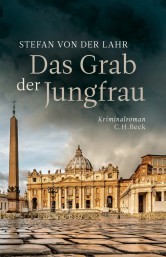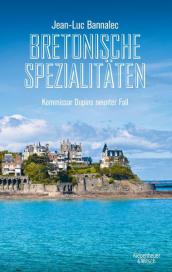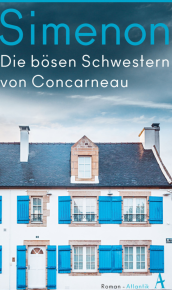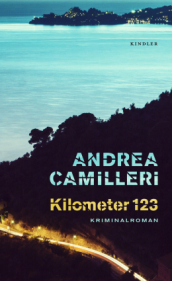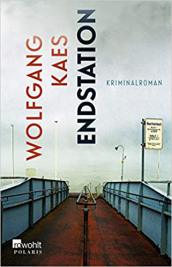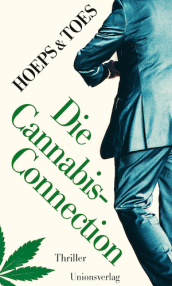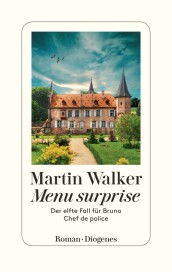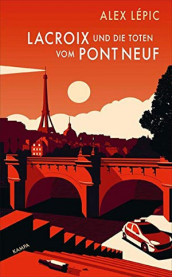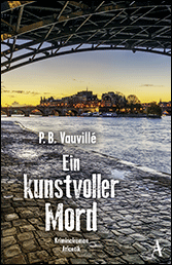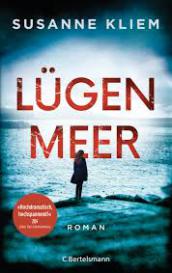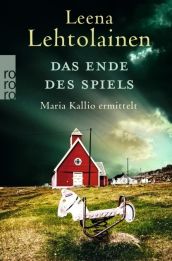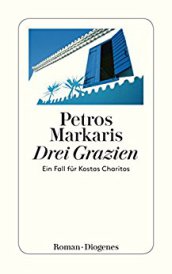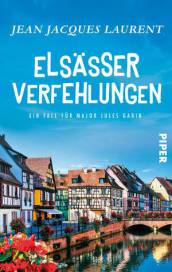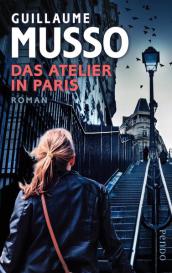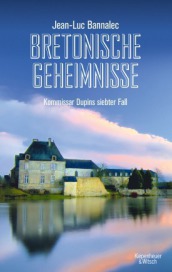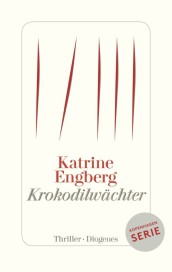Biographien und Tagebücher
Hier finden Sie das Leben der Anderen in Biographien und Tagebüchern
Klaus Mann:Literatur-Drogen-Todessehnsucht
Mit 542 Seiten legt Thomas Medicus, der unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Frankfurter Rundschau gearbeitet hat, nun als freier Publizist in Berlin, eine opulente Biographie des Thomas-Mann-Sohns Klaus Mann vor.
Sein Buch-Gegenstand: Ein bewegtes, turbulent-trubeliges Leben eines schillernden Bohemians, der als Schriftsteller jedoch im Schatten seines Vaters, des Nobelpreisträgers Thomas Mann
steht.
Medicus schildert die Münchner Kindheit, die Karriere des Dandys in der Weimarer Republik, seine homosexuellen Eskapaden und Krisen, bis zur politischen Emigration als Hitlergegner, als die Nazis
sich zu Verfolgern der Juden entwickelt hatten. Dieses schillernde Leben, das mit einem Selbstmord endet, ist für Medicus die symbolhafte Verkörperung eines gesamten Zeitalters, in dessen Höhen und
Tiefen und vor allem ständigen Gefährdungen Klaus Mann seinen Mann stehen muss und doch scheitert.
Es ist ein Leben voll Unrast und nicht Ruhe, voll permanentem Unterwegs-Sein. Hemmungslosigkeit bestimmt den Charakter von Klaus Mann, dessen Schreib- und Lesezwang ein Leben lang anhält, und das
durch exzessiven Lebens-Ausdruck geprägt war. Schon in seinem Tagebuch hält Klaus Mann fest: "Ich möchte so gerne berühmt werden.“
Klaus Mann nennt sich selbst „ ein Mensch meiner Art“, und diese Definition ist eine Selbsteinschätzung seines Schwulseins.
Für ihn ist die Romantik der Unterwelt unwiderstehlich, das tobende Dasein der Weimarer Republik mit Drogen, Tanz und wechselten Liebschaften ist genau das Richtige für ihn, seine Lebensweise. Dazu
gehört der Schnaps, der Champagner, Männer und Frauen, der Aufenthalt in teuren Hotels, das Herumreisen in ganz Europa kostet im Zug und im Flugzeug eine Menge Geld, und das Kapital dafür muss erst
durchs Schreiben sicher nicht leicht erwirtschaftet werden.
Androgyne Gestalten werden von nun ab Dauergäste im literarischen Werk Klaus Manns, der stets das Weibliche am Mann und nicht dessen Männlichkeit betont. Die Erotik ist auch Dauer-Thema in der
gesamten Biografie Klaus Manns, vielleicht an einigen Stellen doch auch etwas überbetont.
Groß und mächtig fällt allerdings auch der Schatten des Vaters auf den Sohn, das ewig beschriebene Thema im Verhältnis der Familie Mann untereinander.
Homoerotisch verführbar blieb Thomas Mann sein Leben lang auch, homoerotisch, wohlgemerkt, nicht homosexuell, schreibt Medicus über den Vater Thomas Mann, dessen Sohn diese Differenzierung nicht
vornimmt.
Diese sehr detailreiche, faszinierende gründliche, ausgezeichnet geschriebene Biographie ist außerordentlich nah am Leben des Literaten orientiert, der sich gerne in Transvestiten-Lokalen
herumtreibt, als Dandy fieberhaft unterwegs ist, die Liebschaften wechselt, ein nervös irrationales Bedürfnis nach ständigem Wechsel und Bewegung in sich trägt, der nie so recht zur Ruhe kommen kann,
über dessen Leben Medicus aber schreibt: „Weder der junge noch der ältere Klaus Mann war ein originärer Denker von analytischer Schärfe. Er sammelte die Früchte seiner weitläufigen Lektüren und
versuchte sich an einer Synthese. Stets ging es dabei ums große Ganze, mehr intuitiv als diskursiv. Das seismografische Erfassen gewissenhafter Entwicklungen gehört dabei zu seinen Stärken. Seine
Feststellung, man habe das ständige Gefühl, zwischen zwei Katastrophen zu leben, sollte sich bald als richtig erweisen.“
Mit seinem Schönheitskult, seiner Exzentrik, seiner Blasiertheit und Eleganz protestiert Klaus Mann gegen die Vulgarität der Welt.
Ausführlich entwickelt Klaus Medicus seine Interpretation vom Leben Klaus Manns auch aus den Werken des Autors selbst heraus.
Immer wieder sind es jedoch die Drogen, Kokain, Morphium, später auch Heroin, die an der Schaffenskraft des Autors nagen. Zur Geistesgeschichte der Weimarer Republik gehört eben auch die Geschichte
des psychedelischen Rausches.
Immer wieder treiben Selbstmordgedanken den emigrierten Autor zu Todessehnsuchts-Gedanken, die sich häufiger einstellen, sowie Einsamkeitsgefühle überhaupt.
Es ist immer wieder der Kampf um Anerkennung, der Klaus Mann vorantreibt und über die permanente Müdigkeit hinweghilft.
Eine erschreckende Klarheit liegt in dem Satz: „War ein Liebesobjekt nicht mehr verfügbar, begehrte Klaus Mann den Tod.“
zugleich drängte ihn die zunehmende literarische Erfolgslosigkeit in die Ecke.
Nach der Niederlage des Nazi-Regimes kehrt Klaus Mann nach Deutschland zurück, kann jedoch nicht mehr recht Fuß fassen. Als er die US-Armee verlässt, schreibt er in sein Tagebuch „Entlassung,
Unsicherheit, Entwurzelt, Ekel.“
Klaus Mann wird zu einem Spielball seiner Emotionen und Launen, mit denen er nicht mehr zurechtkommt.
Es ist eine Art rasender Stillstand in, dem er sich befindet. Verdeutlicht man sich, dass er in zwei Jahren und knapp fünf Monaten 60mal den Ort in Europa wechselt, 1200 Hotelzimmer kennengelernt hat, kann man erkennen, welcher Art von getriebener Mensch Klaus Mann war, eine Art nomadische Unrast trieb ihn an.
Am Ende inhaliert Klaus Mann Gas und schneidet sich die Pulsadern auf.
Ein schwieriges Leben war an sein Ende gekommen, die Drogen nährten den Teufelskreis von Regression, Realitätsflucht und Todeswunsch.
Hinzu kam die Vermeidung von Entscheidungen, die notwendig gewesen wären, häufig aber entweder nicht getroffen oder widerrufen wurden, schreibt Medicus, umso trauriger sein Suizid in „wortloser Einsamkeit“, mit diesen Worten endet Medicus seine eindrucksvolle, faszinierende detailreiche, spannend zu lesende Biographie über Klaus Mann, eine Nahaufnahme auf ein tragisches Leben, auf einen Literaten, dessen wichtiges Werk „Mephisto“ mir immer noch auch heute in bleibender Erinnerung geblieben ist.
Thomas Medicus Klaus Mann Ein Leben Rowohlt
Thomas Medicus, geboren 1953, schrieb u.a. für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und war stellvertretender Feuilletonchef der «Frankfurter Rundschau», viele Jahre arbeitete er für das Hamburger Institut für Sozialforschung. Heute lebt Thomas Medicus als freier Publizist in Berlin. 2012 veröffentlichte er die Biographie «Melitta von Stauffenberg», die NZZ dazu: «Was Medicus ausgegraben und recherchiert hat, ist sowohl bemerkenswert als auch bisweilen unglaublich. Gut geschrieben ist es zudem.» 2020 folgte die Doppelbiographie «Heinrich und Götz George», über die der «Deutschlandfunk» meinte: «Aufsehenerregend … In der Lebensgeschichte bricht sich mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte.»
PRESSESTIMMEN
Süddeutsche Zeitung
Die opulente Klaus-Mann-Biografie ermöglicht eine Neubewertung des Lebens ... Medicus hält viele Fäden zur Lebensgeschichte eines Getriebenen in der Hand und macht deren oft fatales Zusammenwirken
deutlich.
Harry Nutt, Berliner Zeitung
Eine kluge Biografie, die mit Klischees aufräumt und Überraschendes offenbart ... so anschaulich und detailliert erzählt.
Berliner Morgenpost
Eine fulminante Biografie ... die erste, die dem schillernden Klaus Mann in jeder Beziehung gerecht wird.
Tilman Krause, Die Welt
Eine große Biographie.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ein eindrucksvolles Porträt … Medicus beschreibt vor allem die zerrissene Persönlichkeit Klaus Manns, die zu Extremen neigte und einen scharfen Verstand mit tiefer Verzweiflung vereinen musste.
MDR Kultur
In Medicus' detailgesättigtem und exzellent geschriebenem Buch spiegelt sich mehr als ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte - und Familiengeschichte.
General-Anzeiger
Spielerisch wechselt Thomas Medicus zwischen dem Leben und Schreiben Klaus Manns, schafft eine profunde heutige Einschätzung.
ORF
Beeindruckend ... Ein absolut lesenswertes Buch. Diese Biografie ist ein Muss für Mann- und geschichtsinteressierte Leser.
MDR
Eine detailreiche und überaus angemessene Biografie ... Die überragende Qualität besteht darin, dass sie im Spiegel von Klaus Manns Lebens auch die ganze Epoche lebendig werden lässt.
Universell - wirksam - begabt: GOETHE
Wen würde Goethe am 1. September in Thüringen wählen? Müßige Frage! Das großartige „Porträt eines Lebens“ des 1954 geborenen Literaturwissenschaftlers Thomas Steinfeld schließt wenigstens jede nationalistische oder, wie man gegen Ende von Goethes Leben sagte, „vaterländische“ Partei auf seinem Wahlzettel aus. Das Lebensporträt des in aller Welt als größten deutschen Dichter gefeierten Goethe bildet nicht nur seine Literatur vom „Götz“ und Werther bis zu Faust I und II, Wilhelm Meister und den Wahlverwandtschaften und manchen nahezu unbekannten Werken mit knappen Zusammenfassungen, zuweilen vom Bekannten abweichenden kritischen Würdigungen und den Zusammenhängen ihrer Entstehung überzeugend ab.
Dieses Porträt zeigt den ganzen Menschen von seinen Anfängen in der Frankfurter Familie, seinen Jugendjahren dort und den Studienjahren in Leipzig und Straßburg bis zu seinem Lebens- und Wirkungsmittelpunkt in Weimar. Es berichtet von dem leitenden Verwaltungsmann und frühen Kulturmanager in dem gar nicht so unbedeutenden thüringischen Herzogtum, mit dessen Landesherrn er sich unkonventionell verstand und dem mit er sich später auseinanderlebte.
Das Lebensbild blickt dem Naturforscher nicht nur über die Schulter, sondern reflektiert auch seine Erfolge und Irrtümer auf diesem Gebiet. Goethe war keiner, den das weibliche Geschlecht kalt ließ. Steinfeld zählt sie alle auf, diskret, jede zu ihrer Zeit: Als Einundzwanzigjähriger verliebte er sich im elsässischen Sessenheim in Friederike Brion, ließ sie aber bald allein. Legendär war seine nicht nur auf den langjährigen Briefwechsel zu reduzierende Freundschaft zu Charlotte Freifrau von Stein. Mit Christiane Vulpius hatte Goethe vor ihrer Heirat jahrelang zusammengelebt und auch Kinder bekommen, die bis auf den Sohn August sämtlich früh verstarben. Nach dem Tod seiner Frau verliebte er sich in Marienbad als Übersiebzigjähriger in Ulrike von Levetzow, die damals siebzehn Jahre jung war.
Goethes Italienreise ist legendär und auch auf seine Reisen in die Schweiz oder auf den französischen Kriegsschauplatz bei Valmy nimmt der Biograf sein Publikum mit. Die Zeiten waren turbulent: Die Französische Revolution, Napoleons Siegeszug bis vor die Tore von Moskau und sein Rückzug, die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress, die rasante Entwicklung von Naturwissenschaften, Medizin und Technik – das alles ergeben die „Bilder der Zeit“, wie der zweite Teil des Buchtitels heißt.
Goethe war universell interessiert, begabt und wirksam, als Dichter genial, als Kern der Weimarer Klassik bis heute unübersehbar. Seine Freundschaft zu Schiller nimmt in Steinfelds Buch einen ebenso angemessenen Raum ein wie sein Einfluss auf die kurze Blüte der Universität Jena mit den Philosophie-Größen Fichte, Schelling und Hegel. Was er anfasste, gelang meistens mit einer gewissen Lässigkeit. Sein eigener Arbeitsbereich war glänzend strukturiert und Steinfeld zitiert Berichte über die konzentrierte und gedächtnisstarke Arbeitsweise des Mulitalents.
Alles das ist längst in der überbordenden Goethe-Literatur wohlbekannt, meistens bejubelt und gehört zum gefälligen Hintergrundrauschen des deutschen Bildungsbürgertums. Wer das wie Steinfeld alles überblickt, fesselnd erzählt und würdigt, muss selbst universell interessiert und gebildet sein. So liest sich dieses Porträt Goethes als eine kritische Literaturgeschichte der deutschen Klassik, als eine Gesellschaftsgeschichte eines thüringischen Kleinstaates und die vieles umwerfende Geschichte Europas während Goethes langer Lebenszeit, als ein Entwicklungsroman des großen Dichters und als Einladung, Goethe wieder zu lesen.
Das Buch zitiert mannigfach Gedichte, Briefe, Romane und Theaterstücke – sämtlich in überzeugender Textauswahl und glücklich eingepasst in die fortlaufende Erzählung über ein eindrucksvolles Leben. Gern legt man so ein gutes Buch nicht aus der Hand.
Harald Loch
Thomas Steinfeld, geboren 1954, war Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», bevor er zur «Süddeutschen Zeitung» wechselte, dort lange Jahre das
Feuilleton leitete und zuletzt als Kulturkorrespondent in Italien arbeitete. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Er ist Autor vielbeachteter
Bücher, darunter «Weimar» (1998), «Der Sprachverführer» (2010), «Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx» (2017) und «Italien. Porträt eines fremden Landes» (2020). Für seine Übersetzung von
Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden» war er 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Thomas Steinfeld lebt in Südschweden.
Thomas Steinfeld: Goethe Porträt eines Lebens, Bilder einer Zeit
Rowohlt Berlin
Habermas - ein deutscher Philosoph
Der Münchner Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer beklagte dereinst in seinem 1976 erschienenen Buch: „Das Elend der Intellektuellen“ die mangelnde Analysefähigkeit der Linken Theorie. Sontheimer hatte kurzerhand auch die Linke Theorie zur Keimzelle politischer Gewalt erklärt.
Hier wollen wir das Elend insofern weniger differenziert betrachten als eine intellektuelle Debatte in Deutschland angesichts von Instagram und Tiktok, heutzutage ist sie eher wieder in die universitären Kanäle des Elfenbeinturms zurückgedrängt worden, und wie im Fall von Habermas ein 90ter Geburtstag herhalten muss, dass wieder einmal über Erkenntnis und Philosophie debattiert wird.
Der Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt sich mit dem Philosophen Habermas zunächst einmal in Form von
persönlicher Erinnerungskultur, denn er wuchs schon bei seinen Großeltern in Gummersbach als Nachbar der Familie Habermas auf. Dieser persönliche Bezug motiviert ihn, sich mit dem Autor zu
beschäftigen, der manchen Kampf in der intellektuellen Kampfzone der Bundesrepublik theoretisch wie journalistisch praktisch geführt hat. Verstanden und Missverstanden!
Dennoch hat der widersprüchliche Denker einer ganzen Epoche sein Gesicht gegeben. Jeder Student der Politikwissenschaft oder Soziologie der 1970er Jahre hatte die Habermas- Werke aus dem Suhrkamp Verlag zu Hause zu stehen, zuweilen ungelesen, zuweilen zur Hälfte verstanden, zuweilen auch mehr durchdrungen, allerdings mit dem Restrisiko bis zu einem gewissen Grad an Unverständlichkeit als Leser übrig und alleine geblieben zu sein.
In einer persönlichen Rahmenhandlung beschreibt der Autor, wie er sich dem Denker in Starnberg In dessen Eigenheim nähert, durchaus mit einer gewissen Ehrfurcht verbunden. Dass der Philosoph ihm in fabrikneuen Reeboks entgegenkommt, fasziniert den Kulturwissenschaftler und beweist ihm die bürgerliche Moderne des 90-jährigen, der auch zu aktuellen Themen wie den digitalen Medien, dem Ukraine-Krieg oder der Krise im Nahen Osten durch publizistische Aktivitäten in Tages- und Wochenzeitungen Stellung nimmt.
Der Autor nähert sich bei Tee und Marmorkuchen dem großen Denker, und so beschäftigen sich die beiden relaxed mit Gesellschaftsanalyse: „Bei Habermas atmet jedenfalls alles gepflegte Normalität.“ Der Autor empfindet die Annäherung aber auch so: „Das Charisma, das er im Gespräch entfaltet, war mir weder aus seinen Büchern noch von seinen öffentlichen Auftritten bekannt.“
Der Verleger von Habermas, der renommierte Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld, hielt Habermas für den „hellsten Intellekt der Generation“. Unseld verdiente einiges an den berühmten Titeln von Habermas
„Strukturwandel der Öffentlichkeit“, „Erkenntnis und Interesse“, „Theorie des kommunikativen Handelns“ und vielen anderen Werken. Allein die Literaturliste in diesem Denkerbuch ist ebenso lesenswert,
aber eher für den politikwissenschaftlich geschulten Studenten-Geist der 1970er Jahre. Habermas zu lesen ist in einer Gesellschaft, in der die philosophische Debatte an den Rand gedrängt ist und die
Tagespolitik die Schlagzeilen bestimmt, ein Minderheiten-Vergnügen, ein Trend, den man mit einer Überschrift aus dem Buch bezeichnen könnte: „Abschied vom
Tiefsinn“.
Habermas dagegen hat selbst bibliographischen Hunger. Das heißt, seine Quellen-Quellen sprudeln geradezu, doch Habermas bekennt, er sei kein „Weltanschauungsproduzent“.
Sein Philosophie-Konkurrent Peter Sloterdijk nennt ihn verächtlich „Genie der Paraphrase“, später kritisieren andere Autoren, Habermas habe einen Mangel an Originalität. Aber Zeitgenossen erinnern sich eben auch immer wieder an Vorlesungen des Gesellschaftsanalytikers, dessen Ausführungen „dunkel, fremd und hoch kompliziert“ wirkten, in einer „schwierigen Diktion“ formuliert, jedoch von einer unglaublichen Anziehungskraft.
Gerade die Rebellen der Alt-68er lasen ihn, empfanden jedoch zunehmende Entfremdung.
Wer mit Habermas diskutiert, muss ein ungeheuerliches Maß an „Begründungsanstrengung“ aufbringen, schrieb der Soziologe Oskar Negt.
Das begriffliche Instrumentarium von Habermas produziert Begriffe wie „Rationalisierung“,“ Lernprozesse“, „Öffentlichkeit“, „Erkenntnisinteresse“, „Diskurs“ „Kommunikation“, „Strukturwandel“,
„kommunikative Kompetenz“ „herrschaftsfreier Raum“ und viele andere mehr.
Habermas hat ein persönliches Handicap, eine Gaumenspalte, die ihm das Mündliche erschwert und das Schriftliche dafür ersatzweise befördert. Er meidet deshalb moderne Medien wie Radio und
Fernsehen, schrieb eher für die ZEIT oder SÜDDEUTSCHE als Medienintellektueller.
Habermas fürchtet in seinem Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, dass Mediennutzende, wie Kinogeher, Radiohörer und Fernsehzuschauer eine Gesellschaft entstehen lassen, die nicht mehr der Kraft
des Buchstabens vertraut, erklärt ein Kernsatz des Buches von Philipp Felsch.
Verzweifelten die einen an der Entrücktheit seiner Sprache, ging sie den anderen nicht weit genug, meint wohl auch, Habermas ließ das Radikale vermissen,
dennoch schreibt er an seinen Verleger Unseld: „Du bewegst dich in einer Welt von Rotariern, mit der mich nichts verbindet“.
Habermas hat die Lust am schwierigen Denken und Schreiben.
In der Debatte „Historikerstreit“ spielt Habermas eine große Rolle, indem er den Vergleich der ursächlichen Verkettung von Auschwitz und Gulag als eine verharmlosende Apologie zurückweist. Der Berliner Historiker Ernst Nolte hatte in einem FAZ Artikel geschrieben, die nationalsozialistische Judenvernichtung sei eine Reaktion auf die Massenmorde des Stalinismus.
Habermas versteht sich bis heute als linker Sozialdemokrat, der den Grünen gegenüber misstrauisch blieb.
Als Hildegard Hamm-Brücher ihm 1999 den Theodor-Heuss-Preis überreicht, sah Habermas ein, dass er in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen war. Zehn Jahre vorher galt er noch als Anarchist. Als
er den „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“ erhält, sitzt das ganze Kabinett des Bundes in der Paulskirche.
Wenn es um Krieg geht und die Debatte darum erweist sich Habermas als wahrhaft staatstragender Denker, allerdings ist er auch der Überzeugung, dass man sich im Krieg gegen die Ukraine um einen Waffenstillstand bemühen müsse, und die Suche nach einer Verhandlungslösung im Konflikt mit Russland unumgänglich ist.
Er sieht auch durchaus den Abstieg des Westens, verbunden mit einem Niedergang der politischen Institutionen in den Vereinigten Staaten.
Der Kulturwissenschaftler Felsch ist bestürzt, dass er Habermas als den eigentlich letzten Idealisten nun endgültig fatalistisch erleben muss. Felsch kommt zu dem Fazit, dass die Widersprüche
zwischen Theorie und Praxis endgültig offenbar werden, Habermas in seinem Wirken in seiner Zeit, im Prinzip die bundesrepublikanische, am stärksten verhaftet war, und gerade dies ein zeitloses
Vermächtnis darstelle.
Ein schlaues Buch des Annäherns an einen großen Philosophen, der die wichtigen Debatten der Bundesrepublik initiiert und geprägt hat. Die wiederum hat ihn nicht immer verstanden oder auch gerne
missverstanden. Ein Buch für Erinnerungspolitiker, Geisteswissenschaftler, besonders Philosophen, Politologen und Soziologen und Kulturwissenschaftler, die das Debattenklima der alten Bundesrepublik
verstehen wollen, ein anspruchsvolles Buch. Und eine Lektüre für Richard David Precht.
Philipp Felsch Der Philosoph Habermas und wir Propyläen
Videos
Jürgen Habermas - und das Begreifen der Gegenwart (youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=wqLFMevtutk
Philipp Felsch, geboren 1972, ist Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Studium las er lieber die Bücher von Michel Foucault und Niklas Luhmann als den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Sein Buch „Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte, 1960–1990“ (2015) wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, zuletzt erschien „Wie Nietzsche aus der Kälte kam“ (2022).
Lebenserinnerungen eines Verlegers
Das Buch ist eine Reise ins Äußere und ins Innere. Wir folgen Michael Krüger in die Länder, die er besucht hat und mit ihm in das Innere der Menschen, denen er begegnet ist im Laufe seine Verleger-Lebens. Und zugleich verrät er auf dieser Lebensreise durch die Zeiten etwas über sein eigenes Inneres.
Seine Aufzeichnungen, Biographie würde er es sicher nicht nennen, beginnen mit einigen Stoßseufzern über „Summen für drittklassige Romane und halbseidene Sachbücher“ des Buchmarktes, „denen man schon
von weitem ansieht, dass sie nach drei Monaten wieder vergessen sind.“ Krüger beklagt mangelndes Kulturverständnis in Bayern, am Beispiel der Bayerischen Akademie der schönen Künste, der er einmal
vorstand, „vom Staat so wenig geliebt“, es bleibt ihm ein Rätsel: „Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in Bayern Intellektualität traditionellerweise nicht besonders hoch im Kurs
steht“
Krüger vermeidet Branchengetratsche und Skandalgeplauder: „… dazu habe ich nicht die geringste Lust. Man vergiftet sich nur selber, wenn man sich auf das Niveau dieser neuen Blog-Warte begibt.“
Dennoch erfahren wir in dem Buch interessante Interna, zum Beispiel, dass Fassbinder einen autobiografischen Roman, schreiben wollte, es einen Vertrag gab, aber er diesen nicht mehr hat schreiben
können.
In einer Aufzählung von KÖNNTE, HÄTTE, MÜSSTE erzählt Krüger, was dieses Buch alles nicht ist. So lesen wir über Menschenbegegnungen, Szenen, Länder, eine Nachkriegskindheit zwischen Nikolassee,
Schlachtensee und Wanze, die ersten Romanerfahrungen mit Faulkner, die Gedichte und Hörspiele von Günter Eich, Knut Hamsun, Hermann Hesse, die Stücke von Tennessee Williams. Krüger gibt zu, sich mit
seinem etwas angeberischen Eifer als Vielleser in nicht-literarischen Kreisen nicht nur Freunde gemacht hat.
Geradezu mit hinterlistigem Humor beschreibt er die linken Irrwege seiner Zeitgenossen, die mit revolutionärem Geschrei die Verlage als neue Chefs kapern wollten. Krüger trifft Linke wie Wagenbach
und Feltrinelli, beschreibt die diskussionseifrigen Hinterstübchen- Treffen, während sich in der wirklichen Wirklichkeit die international operierenden Konglomeraten von Verlagen zu
Riesen-Unternehmungen zusammengeschmolzen wurden: „Man schlief als Autor des Limes Verlages ein und erwachte bei Bertelsmann, der dann wenig später Random House und schließlich sogar Penguin hieß
oder umgekehrt.“
Da ging sie dahin die so genannte Avantgarde.
Wir lernen seinen Verlagsgründer Dr. Carl Hanser kennen, der schon vor Urzeiten die Frage stellte: „Was verliert Europa, wenn es Russland verliert.“
Ein reines Lesegnügen für Buchinteressierte, wir verschlingen Anekdoten und Anekdötchen, erfahren über die Lust vom Büchermachen und den Frust, Lästereien am Rande, Vorder- und Hintergründiges, das
Buch ist eine Personen-Fundgrube und ein Bestiarium der Büchermacher.
Krüger klaubt seine Geburtstagessays und Todesreden über verstorbene Zeitgefährten auf, wir lesen seine Gedichte, seine eindrucksvollen Impressionen über den römischen Winter während seiner
Aufenthalte in der Villa Massimo. Natürlich trifft er Alberto Moravia, Natalia Ginzburg, Umberto Eco, die Verlegerin Inge Feltrinelli, „die schrillste und schönste Frau der Buchmesse“.
Heute macht Krüger seine Reisen nur noch in seinem Kopf, in seiner Phantasie, hört dazu Gilmour von Pink Floyd zu, in seiner blühenden Phantasie sitzt er in der Küche von Gregor (und Beatrice) von
Rezzori, der einen Risotto zubereitet, und alle hören Bruce Chatwin zu, der seine Abenteuer in Patagonien erzählt. „Und alles ist gut.“
Köstlich, wenn Krüger beschreibt, wie auffällig simpel seine Klamotten bei Preisverleihungen sind, diese ihm auch irgendwie zuwider. Oder solche Bekenntnisse über Marcel Reich-Ranicki: „Offen gesagt, war mir R-R als Unterhalter lieber denn als Kritiker“ oder Sätze wie „Wenn der Botschafter zu einem Streichquartettabend lädt, weiß man, was einen erwartet. Man sitzt da und muss ein vergeistigtes Gesicht machen.“ Das macht eben Lust und Laune, das Buch zu verschlingen. Wir erfahren so nebenbei, dass der Titel „Tadellöser & Wolff“ von Krüger stammt, der Autor Kempowski ihn ganz und gar nicht wollte.
Krüger bringt den Filmemacher Werner Herzog mit Mühen zur Schriftstellerei: „… man muss als Verleger Geduld haben! Zu Herzog habe ich immer gesagt: Du bist eigentlich ein Dichter. Aber weil dir das
zu langweilig ist, zu Hause zu sitzen und Gedichte zu schreiben, musst du wie ein Berserker Filme drehen“.
Michael Krüger hat beschlossen, mindestens hundert Jahre alt zu werden, denn es gibt noch so viel zu entdecken Krüger benennt am Ende des seine „Leerstellen“. „Natürlich geht die Welt demnächst
unter. Aber nicht vor der nächsten Buchmesse“.
Dies ist ein Buch von einem Büchernarren über Büchernarren, im Suhrkamp-Verlag publiziert, einem „Käfig voller Buchnarren“.
Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler-
und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler
in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen
hat. Seit 1981 war er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.
Im Jahr 1972 veröffentlichte Michael Krüger erstmals seine Gedichte, und 1984 debütierte er als Erzähler mit dem Band Was tun? Eine altmodische Geschichte. Es folgten weitere zahlreiche Erzählbände,
Romane, Editionen und Übersetzungen. Die Cellospielerin ist sein erster Roman im Suhrkamp Verlag. Michael Krüger lebt in München.
Veranstaltungen mit Michael Krüger im Februar finden Sie unter diesem Link
https://www.suhrkamp.de/person/michael-krueger-p-2687
Presse
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste (WELT/NZZ/rbb Kultur/Ö1)
Sachbuch-Bestenliste (DLF Kultur/ZDF/DIE ZEIT)
SPIEGEL-Bestseller
»Es wirkt fast, als wollte Krüger sich dafür rechtfertigen, dass er eben keine klassische Autobiografie geschrieben hat ... Das wäre nicht nötig gewesen. ... [Er hat] eine mitreißende Geschichte
seines Lebens verfasst. ... Man [möchte] ihm ... eine Bitte äußern: Schreiben Sie bitte auch in Zukunft keine schnöde Autobiografie. Schreiben Sie lieber noch mal ein derart herrliches,
überraschendes Buch!«
Sebastian Hammelehle, DER SPIEGEL
»Eine Reise in das Herz der europäischen Literatur.«
DIE ZEIT
»... ein vergnügliches Buch, in dem nahezu jede Autorin, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts schrieb, einen Auftritt hat.«
Arno Widmann, Frankfurter Rundschau
Naoíse Mac Sweeney: Der Westen Die neue Geschichte einer alten Idee
Ist die Erzählung von der griechisch-römischen Herkunft der Westlichen Zivilisation nicht längst widerlegt? Naoíse Mac Sweeney stellt dazu verstörende Fragen, überraschende Antworten und bedenkenswerte Ausblicke. Vielleicht ist die 1982 in London geborene klassische Archäologin und Professorin an der Universität Wien auch besonders prädestiniert für eine „neue Geschichte“ der alten Idee vom Westen. Sie ist als Tochter chinesischer und irischer Eltern geboren. Ausgangspunkt ist ihr Blick nach oben in der Library of Congress in Washington, wo 16 Bronzefiguren die Entstehung der westlichen Zivilisation repräsentieren sollen: Homer, Herodot, Michelangelo, Beethoven usw. Sie sucht als Frau mit Einwanderungsgeschichte ihren Platz in dieser Geschichte. Stimmt der „Stammbaum“ dessen, was man unter dem Westen oder der westlichen Zivilisation versteht noch, hat er je gestimmt?
Die Autorin wählt einen klugen, eigenwilligen Ansatz: Sie schreibt kurze biografische Essais über 14 Persönlichkeiten aus mehr als zwei Jahrausenden und beginnt mit Herodot, dem „Vater der Geschichtsschreibung“. Er ist in der Nähe vom klassischen Troja, also in Asien geboren und hatte anatolische und griechische Eltern. In Athen gelangte er zu frühem Ruhm, war aber von der nach Perikles beginnenden Ausgrenzung als „Fremder“ so betroffen, dass er nach Italien auswanderte und dort sein Hauptwerk schrieb. Er gehörte zwei Kulturkreisen an und in seinem Werk finden sich keine Stellen, die etwa die anatolisch-asiatische Welt niedriger als die griechisch-europäische darstellen. In dieser Eingangsbiografie macht Mac Sweeney schon deutlich, worauf es ihr ankommt: Die antiken Zivilisationen waren weder „westlich“ noch „orientalisch“. Sie bestanden gleichzeitig, mit- und auch nebeneinander, befruchteten sich gegenseitig. Sie setzt das in ihren nächsten Skizzen fort. Wenn sie über Livilla, die Lieblingsenkelin des ersten römischen Kaisers Augustus schreibt: „Es gab nur wenige Reiche, die auf kulturelle und rassische Reinheit weniger bedacht waren als die Römer. Der Geschichtsschreiber Livius behauptete, die ursprüngliche Bevölkerung der Stadt habe aus Einwanderern bestanden, die aus allen Himmelsrichtungen gekommen seien – angezogen von Romulus‘ Politik der Nichtdiskriminierung.“ Und so geht es weiter in der Demontage der Erzählung von den „klassischen“ Ursprüngen der westlichen Zivilisation.
Hellas und das römische Imperium waren Sklavenhaltergesellschaften. Gesammelt und überliefert wurde die griechische Antike von arabisch-muslimischen Gelehrten in Bagdad. Byzanz setzte die römische Tradition fort, wurde aber im 4. Kreuzzug von weströmischen Kreuzrittern wie ein Feind überfallen und geplündert. Katholische und orthodoxe Konfessionen kämpften gegeneinander bis die Türken Konstantinopel/Byzanz eroberten. Das brachte Russland ins Spiel und machte Moskau zum „dritten Rom“, das noch heute in der Propaganda unter Putin eine Rolle spielt. Keine Kontinuität nach Westen bis zur Renaissance, als man sich in Italien und im westlichen Europa der griechischen Gedankenwelt annahm, ohne sie zu kopieren.
Nach Sweeney ist die Erzählung von der westlichen Zivilisation und ihrer Überlegenheit eng mit dem europäischen Imperialismus, mit der Versklavung von Millionen Menschen aus Afrika und einem unhistorischen Rassismus verbunden.
Der Widerspruch zwischen der in den jungen Vereinigten Staaten proklamierten Gleichheit aller Menschen und den ihnen zustehenden Menschenrechten einerseits und der weiter praktizierten Sklaverei selbst bei den prominentesten Politikern der jungen USA wurde durch die Erzählung von der westlichen Zivilisation der Weißen übertüncht, die Diskriminierung unter Berufung auf die griechisch-römische Antike, angereichert durch das Christentum, gerechtfertigt. Ein krasses Beispiel ist die Geschichte der Phillis Wheatley, die 1761 in Boston als siebenjährige Sklavin verkauft wurde. Ihre Besitzer ließen ihr eine breite Bildung zuteilwerden, so dass sie als Jugendliche nicht nur Englisch, sondern auch Latein und Griechisch beherrschte, Sie schrieb Gedichte, die ihr keiner abnahm. Schließlich wurde ein Tribunal von 18 weißen Männern einberufen, die Phillis prüfen sollten. Sie bestand diese Prüfung vor dem Gouverneur der damals noch britischen Kolonie glänzend und ihre Gedichte wurden veröffentlicht und ein großer Erfolg.
Die dreifache Diskriminierung – schwarze Sklavin, Jugendliche, weiblich – war geplatzt. Das britische Empire wird durch den mehrmaligen Premierminister Gladstone als Rechtfertigungsregime für Weltherrschaft repräsentiert. Gegen Ende ihres spannenden Buches kommt Mac Sweeney auf Hongkong zu sprechen. Hundert Jahre war das Gebiet an der chinesischen Südküste britische Kronkolonie. Ihre Gesellschaft war westlichen und chinesischen Zivilisationen und Traditionen verpflichtet. De Autorin bedauert das von China betriebene Scheitern der Gleichzeitigkeit und sich ergänzen Gemeinsamkeit von westlichen und fernöstlichen Elementen.
Mac Sweeney schreibt, dass der Westen aufhören müsse, sich die griechisch-römische Antike als einzigartigen und reinen Ursprung vorzustellen: „die historischen Fakten lassen auf eine Große Erzählung von der Geschichte des Westens schließen, die weit komplexer, reicher und divers ist. Sie ist ganz entscheidend von einer Dynamik geprägt und damit Imstande, Veränderungen zu begrüßen.“
Harald Loch
Naoíse Mac Sweeney: Der Westen Die neue Geschichte einer alten Idee
Aus dem Englischen von Jens Hagestedt und Norbert Juraschitz
Propyläen, Berlin 2023 526 Seiten 34 Euro
Willy Brandt - der Mensch und Kanzler
Die inzwischen vielzitierte BRANDT-Biographie von Peter Merseburger, viel gelobt und von Gunter Hofmann auch mehrfach zitiert, hat noch sechs weitere Biografien als Nachfolger. Brandt - die
attraktive Biographien - Natur, rätselhaft, mysteriös, unentzifferbar, noch heute.
Hofmann sucht einen eigenen MEIN-BRANDT-Ansatz, denn er war dabei, oder daneben oder als ZEIT-Parlamentskorrespondent mittendrin im Politszenario in Bonn und Berlin.
Seine Biographie folgt keiner strengen Chronologie, das macht das Lesen für den Normalleser etwas schwierig. Sie lebt auch vom Zitatenschatz früherer Veröffentlichungen, von Einschätzungen anderer
Personen, von autobiografischen Schriften, aus denen Hofmann sehr, sehr ausführlich zitiert. Kritiker monieren dennoch sachliche Fehler. Für einen der Geschichte verpflichteten Verlag wie CHBeck
überraschenderweise fehlt die Bibliographie völlig!!!
Es geht Hofmann darum, das Rätsel, das Mysterium Brandt auflösen, den Menschen zu interpretieren.
Ausgangspunkt seiner Betrachtungen sind in vielen Fällen autobiografische Schriften und zeitgenössische Reden von Brandt, den er in langen Zitaten immer wieder ausführlich zu Wort kommen lässt. Die
auch von anderen Autoren genannten Leitfiguren spielen in Zitaten mit.
Die zentralen Fragen in Hofmanns Buch: Was für ein Mensch war Willy Brandt, wieso trat er für die Moderne ein, wie waren die Beziehungen zwischen Brandt-Wehner-Schmidt und Grass als Sonderbeispiel,
wo lagen die Motive für die Ostpolitik? Thema auch: Brandt und die Wiedervereinigung und Brandt in seinem Verhältnis zu Kohl. Seltsam, die SPD steht nicht an prominenter Stelle.
Kommen wir also zur Ostpolitik, jenes heftig umstrittene Kapitel deutscher Politik damals - und heute wieder, als wäre die Ostpolitik der SPD am Ukraineüberfall und am Gasdebakel schuld.
Ja, Brandt misstraute Egon Bahrs These „Wandel durch Annäherung“. Brandt fürchtete, es müsse sich auch der Westen wandeln und dem Osten annähern. Übrigens stammt die Annäherungs-Formulierung von
einem Beamten im Außenministerium, nicht von Egon Bahr, er sagt selbst „Ostpolitik ein Marathonlauf von tausend Tagen“. Er nutze die verdeckte, schweigende Diplomatie im Hintergrund, mit „back
channels“ aus dem Geheimdienstmilieu.
Hofmann reklamiert, die Ostpolitik würde "aus ihrem historischen Kontext" gerissen, und was den Ukrainekrieg angeht, formuliert Hofmann „'Mein Brandt“ hätte sich wohl den Einwand zu Herzen genommen,
die Ukraine sei im Schatten der deutschen Russlandpolitik gestanden".
So ist die deutsche Debatte um Appeasement-Politik leider etwas schwarz-weiß-undifferenziert gefärbt.
Auf der Krim verhandelte Willy Brandt mit Breschnew bei einer Bootsfahrt auf dem Schwarzen Meer, er machte aber auch klar: „Dieser Vertrag bedeutet nicht, dass wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten
rechtfertigen.“ „Ich wollte, wir wollten, dass ungelöste Fragen der Vergangenheit uns nicht daran hinderten die Zukunft zu gestalten.“
Hoffmann interessiert vor allem die innere Entwicklung Brandts, er versucht dem Menschen nahezukommen. Betrachtet Hofmann Willy in einer psychologischen Dimension lässt er Brandt sagen „…war ich
(Brandt) vielleicht ein bisschen zu eigen“. „Wer ihm zu nahekam, engte ihn zu sehr ein. Wenn ihm jemand nahe kam, vermisste er es.“
Auf die SPIEGEL-Frage, ob Kandidat Brandt empfindlich sei, antwortet Willy „Sicher, manchmal ja. Es wechselt sehr.“ Brandt hatte depressive Phasen.
Gunter Hofmann schreibt, er wolle nicht ins Psychologisieren geraten, wenn er etwa die Rolle des Vaters des unehelichen Willy Brandt beleuchtet, den Brandt aus dem Kopf und aus dem Lebenslauf
streichen will. Aber die Psychoebene kommt an vielen Stellen des Buches doch zum Vorschein, und es ist eben die Stärke des biographischen Ansatzes von Hofmann diese zu interpretieren.
Brandts Leben ist ein Leben ohne Vater, fast ohne Mutter, kein Chefredakteur herrscht über ihm, frei wollte er sein, sich nicht unterordnen müssen, Emanzipation als Selbstbehauptung: „Freiheit
schreibt er sehr früh sehr groß.“
Wenn es ums Persönliche geht, zeigt Brandt sich gegenüber Journalisten zum Beispiel spröde.
Es sind die kleinen Beobachtungen und Bemerkungen am Rande, die diese Biographie so farbig machen. Etwa: „Brandt war ein Pfennigfuchser“. Oder, dass Brandt in Berlin durch Wilhelm Furtwängler die
klassische Musik lieben lernt. Sprachen lernen fällt ihm leicht, sich ins Fremde einzufühlen und darauf einzulassen ebenso. Brandt schwärmte auch für sein kleines Landhaus in Südfrankreich, nicht nur
von Skandinavien.
Das Angebot, Chefredakteur von dpa zu werden, kommt für Brandt zu spät, es liegt schon ein Angebot vor, Attaché der norwegischen Militärmission in Berlin zu werden. Brandt sagt zu.
Verfolgung befürchtend, nutzt Brandt diverse Namen: Willy Brandt, Herbert Frahm, Felix Frank, Martin und andere Pseudonyme.
Brandt mochte krumme Lebensläufe, er hatte ja selbst auch einen.
Brandts Verhältnis zu Günter Grass nannte Merseburger eine „scheue Freundschaft“. Die Kapitel über Grass, Wehner und an einigen Textstellen über Helmut Schmidt sind sehr ausführlich, einfühlsam und
erhellend. Lars Brandt über Wehner, wenn die Familie Wehner auf Ödland zu Besuch kam: „Es lag in seiner geheuchelt freundschaftlichen Privatheit allseitige Verlogenheit.“
Bandt schafft es nicht zur Beerdigung Wehners zu gehen. Zu tief waren die Verletzungen. Warum? Nach dem Moskauer Eklat fühlte sich Brandt von Wehner verraten, spätestens nach dem Zuruf aus Moskau,
„Der Herr badet gern lau“. Die Entschlusskraft des Kanzlers wurde damals heftig angezweifelt. Brandt sagt selbst zur BASTA-Politik: „Den Tisch beeindruckt der Faustschlag wenig. Wen sonst?“
Erschreckend, was die Journalistin und nahe Freundin Wibke Bruhns sagt: Brandt war am Ende, wusste nicht weiter, trug sich mit Selbstmordgedanken und bedauerte, keine Pistole zur Hand gehabt zu
haben.
Was bleibt ist sicher der Satz: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Das war Brandts Überzeugung: „Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte.“
Ein farbiges Porträt des SPD-Kanzlers, mit eigenem Ansatz, etwas üppig zitatfreundlich und genau deshalb verwundert es, dass ein Literaturverzeichnis fehlt!
Gunter Hofmann: Willy Brandt. Sozialist, Kanzler, Patriot. C.H. Beck, München 2023.
Gunter Hofmann war bis 2008 Chefkorrespondent der ZEIT.
Rezensionen
„Gunter Hofmanns fesselnde Biografie über Willy Brandt zeigt einen Politiker auf der Suche nach einem besseren Deutschland und liefert eine überzeugende Verteidigung von dessen Ostpolitik.“
Süddeutsche Zeitung, Joachim Käppner
„Eine glänzende Biografie … Für Hofmann war Brandt ein Mann mit Charakter. Ein Patriot. Und ein Politiker mit Klasse.“
Frankfurter Rundschau, Michael Hesse
„Eine von Sympathie getragene sehr persönliche Annäherung an Willy Brandt“
Der Tagesspiegel, Ernst Piper
„Gunther Hofmann lässt Atmosphärisches lebendig werden … Man stößt immer wieder auf erhellende Anmerkungen des Bonner Korrespondenten.“
Deutschlandfunk Andruck, Michael Kuhlmann
„Näher als diese (Biographie) ist noch keine Darstellung dem Menschen Brandt hinter dem Mythos Brandt gekommen.“
Dresdner Morgenpost
„In seiner Biografie geht Gunter Hofmann auch auf aktuelle Streitfragen ein.“
Das Parlament, Joachim Rieker
„Eine überzeugende Interpretation von Brandts Politik aus dem Blickwinkel heutiger Problemstellungen. Wer der politischen Persönlichkeit Brandts näherkommen möchte, dem sei die Lektüre des Buches
sehr angeraten.“
sehepunkte, Bernd Rother
„Eine spannende Lektüre“
Chrismon
VIDEO
Links Vorwärts Gespräch mit dem Autor https://www.youtube.com/watch?v=mAxqQe_eMtI
Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung
https://willy-brandt.de/aktuelles/audio-video/willy-brandt-sozialist-kanzler-patriot/
Audio
Das Tragische war ihr Talent: Die CALLAS
Maria Callas hatte den tiefen menschlichen Instinkt für das Tragische. Das waren ihre Lieblingsrollen auf der Bühne und im richtigen Leben, vor allem auch, was ihre Beziehung zu Männern angeht. Die
Callas war eine Diva, geplagt von Selbstzweifeln und der Angst, von den Männern, aber auch von ihrem Publikum nicht geliebt zu werden. Zugleich war sie in der Welt der Primadonnen eine Kämpferin,
durchaus konkurrenzbewusst. Sie lebte nach dem Motto: Bitte nie jemanden um einen Gefallen, du kriegst sowieso nichts geschenkt im Leben. Mit 17 Jahren schon singt sie in Puccinis Oper "Tosca". Ihre
Stimm-Technik von hundertprozentiger Perfektion zu Glanzzeiten, ihre Darstellung intensiv und voller Dramatik, ihre Gestik überzeugend, ihr schauspielerisches Talent faszinierend.
Ihr Leben war der pure Luxus, Champagner im Maxim in Paris, Jetset-Treffen in Moritz mit Karajan, Benefiz-Bälle in New York, sich unter die juwelenbestückten Promi-Gäste mischen, mit Filmstars am
Strand im Sand spazieren, Glamour, Glamour, Celebrities.
Die Behauptung hielt sich aber hartnäckig: Die Callas hat kein Herz.
Die Autorin schildert in 30 Kapiteln und auf mehr als 500 Seiten die Callas als „schizophrene Person“, auf der einen Seite erfolgreiche Sängerin und Diva, auf der anderen Seite Frau und Liebende,
zwei Personen im Widerstreit, im Berufsleben ein außerordentliches Stimmphänomen der Gegenwart, privat mehr unglücklich als glücklich. Begeistert, aber auch kritisch aufgenommen vom
Publikum.
Kollegen im Umfeld nennen sie launisch, herrisch, eine Frau mit versengendem Ehrgeiz, unbeliebt, nimmersatt auf Erfolg und Geld ausgerichtet.
Zum Beispiel wird die Rivalität zwischen der Konkurrentin Tebaldi und der Callas als ein Duell Taube gegen Adler etikettiert, Friedensvogel gegen Raubvogel.
Die Callas war eine Primadonna mit hitzigem Temperament im Herzen, sie war die Königin der Scala in Mailand und zugleich der Star der Boulevardpresse, weil sie unendlich lange mit dem griechischen
Reeder und Tankerkönig Onassis zusammen und auch auseinander war.
Ihr Lebensmotto war: „Was ich zu sagen habe, singe ich.“
Die Callas, eine streitsüchtige Diva, am Opern-Set ein Stimmwunder, das auf der Bühne auch die Faust ballen konnte und zugleich die Menschen vor Rührung zum Weinen brachte.
Während in Europa der Erfolgsschlager „Weiße Rosen aus Athen“ die Hitlisten eroberte, sang die Callas Hauptrollen auf den Opernbühnen dieser Welt und produzierte eine Schallplatte nach der
anderen.
Sie unternahm nicht lebensgefährdende Suizidversuche, vergaß, ihre chronische Sinusitis konsequent zu behandeln, die ihrer Stimme schadete, sang erkrankt dennoch auf den internationalen Bühnen die
größten Opernrollen.
Von den Männern wurde sie immer wieder enttäuscht. Aber sie gab sich nie auf, wenn sie abgewiesen wurde, rappelte sie sich wieder auf, kämpfte gegen probenschlappe Regisseure, feindliche Opernintendanten bis an die Grenzen der physischen und psychischen Belastbarkeit, nein besser gesagt, sie kannte gar keine Grenzen.
Zuweilen blieb das Publikum im Zuschauerraum kühl, wenn sie sich wieder einmal überfordert hatte. Kollegen meinten, sie ist zu den Gestalten geworden, die sie auf die Bühne gebracht hatte, Opfer der
angeblich sadistischen Neigungen von Onassis, die sie zur Selbstverleugnung veranlassten.
Im richtigen alltäglichen Leben las sie „Readers Digest“ und wollte von den Verbrechen der Obristen in Griechenland oder den revolutionären Geschehnissen der 68er in Paris so gut wie gar nichts
wissen. Dennoch sang sie lebensnah wie viele damals zu den Songs der Beatles oder zu den Lyrics von Frank Sinatra, wenn sie sich deren Stimmen von einem Kassettenrecorder ins Haus holte.
Die Callas brauchte die Resonanz des Publikums wie das tägliche Brot.
Am Ende ihrer Karriere von nervöser Erschöpfung geplagt, durch Überarbeitung und Überanstrengung ausgelaugt musste die Lebensbilanz-Rechnung für Maria, der Frau, von der Callas, dem Star, bezahlt
werden. Jetzt sagt sie oft, ich bin es müde, benutzt zu werden, den Klatsch, die Rache und die Intrigen auf und hinter den Bühnen zu ertragen.
Eva Gesine Baur hat nicht nur Literatur- und Musikwissenschaft und Gesang studiert, sondern auch Psychologie. Das alles kommt ihr in diesem umfangreichen biografischen Sittengemälde über die Diva
Callas zugute, weil sie die menschlichen Gründe und Abgründe genau darzustellen weiß. Diese Biografie ist ein detailliertes Personen-Panoptikum jener Zeit, eine Schilderung des Operngeschäfts und der
Klassikszene, eine Diva-Studie, die den Opernbegeisterten fasziniert. Zugleich werden wir in eine Zeit zurückbeordert, als das Starsein, prominent in Film, Fernsehen, Presse und Illustrierten, mehr
noch fasziniert hat als heutzutage im digitalen oberflächlichen Leben zwischen Internet, Facebook, Tiktok und Instagram, wo sich das Prominentsein abnutzt und sehr stark relativiert. Außerdem sind
die Klassikstars im Dschungelcamp noch nicht angekommen.
Eva Gesine Baur ist promovierte Kunsthistorikerin und hat zudem Literatur- und Musikwissenschaft, Psychologie und Gesang studiert. Sie hat Bücher über
kulturgeschichtliche Themen und unter dem Namen Lea Singer mehrere Romane veröffentlicht. 2010 wurde ihr der Hannelore-Greve-Literaturpreis verliehen, 2016 der Schwabinger Kunstpreis.
Maria Callas Die Stimme der Leidenschaft Eine Biograpie C. H. Beck
Friedrich Christian Delius - Biographie in Alphabetform
Also fast am Ende des Lebens sagt sich der Schriftsteller, jetzt könnte man doch noch eine Biographie schreiben, aber es ist etwas die Scheu da, es denn dann auch wirklich zu tun. Erst recht bei dem Selbst-Skeptiker Friedrich Christian Delius, denn wie heißt das Eigen-Zitat unter dem Buchstaben A am Anfang seiner Lebensbeschreibung in Alphabetform: “Achtzig Jahre, dazu sollen andere was sagen.“ Und doch tut er es dann selbst.
Delius findet eine eigene ABC-Form, alphabetisiert alle kürzeren und längeren Kapitel unter dem Anfangsbuchstaben A, und erst im zweiten Buchstaben dekliniert er die einzelnen Themen von A bis Z
durch. Getreu dem Motto Fontanes, das unter dem Stichwort Anfang gelistet wird: „Der Anfang ist immer das Entscheidende“, sagt unser aller Fontane, „hat man’s darin gut getroffen, so muss der Rest
mit einer Art von innerer Notwendigkeit gelingen, wie ein richtig behandeltes Tannenreis von selbst zu einer graden und untadeligen Tanne aufwächst.“
Beim Schreiben der ABC-Biographie fürchtet Delius schon im Vorwort Begradigungen, Vereinfachungen, Beschönigungen, Selbstüberschätzungen - genau das Gegenteil dessen, was Aufgabe von
Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist.
Da ist sie also, seine Skepsis, die ihn nicht davon abhält, einen normalen, spielerischen Ansatz, ein Selbstporträt in Collagen zu wählen, und er gesteht gleich zu Beginn: „Dies Buch hat also viel
mehr Lücken als Seiten.“
Wir erfahren in Folge seine Blutgruppe A, Rhesus-positiv, dass er dereinst als Honorar für einen Kalendertext hunderttausend Blatt bestes DIN-A4-Papier erhält, dass Günter Kunert Abendrotpostkarten
aus aller Welt sammelt, wir finden Delius‘ Absage, in Klagenfurt beim Bachmann-Preis zu lesen, und Absagen, wenn schlechte Manuskripte bei ihm als Lektor im Wagenbach-Verlag ankommen.
Zur politischen Bewegung Achtundsechziger wird Delius grimmig, sie sei so auf ihre eigenen Mythen und Klischees hereingefallen wie sonst keine, denn: „Alles war anders, nämlich viel
widersprüchlicher, mehrdeutiger, spielerischer.“
Adenauer ist für Delius „Kindheitskanzler, Wahlplakatekanzler, Zeitungskanzler“. „Je älter er und ich wurden, desto mehr wollte ich, dass er zurücktritt.“
Delius ist Fußballfan, sein Team-Motto findet er in Sammy Drechsels legendärem Fußballbuch „Elf Freunde müsst ihr sein“.
Delius Biographie ist bodenständig, geburtsheimatverbunden, nicht abgehoben, nicht selbstlob-verliebt.
Delius kommt aus Nordhessen. Er liebt „Ahle Worscht“, eine nordhessische schmackhafte Landwurst: „Ein Biss, und schon sind die Äcker, Heuballen, Ställe, Bauernstuben, Mittagsglocken, Kornfelder
wieder da, und vieles mehr.“
Delius beschreibt ein üppiges Picknick mit Günter Grass, durchlebt erneut Erinnerungen an RAF-Zeiten, entdeckt wieder alle Tanzstundenbekanntschaften, die keine Liebesbekanntschaften
werden.
Bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bekennt er im Bewerbungstext: „Lesen und Schreiben gelernt und zugleich stotternd und stumm geworden.“ Mit Literatur und Schreiben überwindet
er sein Sprech-Handicap.
Delius würdigt die Verlegerpotenz von Klaus Wagenbach, seinem Förderer, obwohl er mit diesem im Streit liegt wegen des radikaleren Kurses in Zeiten der RAF, in der „bleiernen Zeit“.
In einem Artikel zum Tod von Delius heißt es in der ZEIT.: „Erstens er ist immer dabei gewesen. Zweitens: Er war stets einer der Leisen im Umkreis der Lauten. Und drittens nutzte er diese beiden
Umstände, um zu einem diskreten und deshalb psychologisch für alle Zwischentöne besonders empfänglichen Chronisten der Ereignisse zu werden. Tatsächlich lässt sich die Geschichte Deutschlands von den
letzten Kriegsjahren bis in die Gegenwart anhand seiner Bücher rekonstruieren“, schreibt Iljoma Mangold.
Angesichts seiner Kontakte zu renommierten Schriftsteller-Kollegen in der DDR beschreibt Delius die Stasi-Haltung so: „Sie vermuteten Konspiration, wo es um Freundschaft ging, sie vermuteten
Staatsfeindlichkeit, wo es um Literatur ging. Da ich viel mit dem Auto unterwegs war zwischen verschiedenen Freunden und Kollegen, gaben die Beobachter mir den Decknamen ‚Fahrer‘ “.
Albert Schweitzer ist dem zehnjährigen Dorfjungen ein Vorbild, Albert Camus ein Idol des 18jährigen, Alexander Fest wird zu seinem Verleger und Alexander Kluge ein gern gelesener Autor, wenngleich
Delius fürchtet: „Niemand wird schneller als er durchschauen, was du für ein naiver, mittelmäßiger Kerl bist.“ Und trotzdem schreibt Delius unentwegt weiter: „Alleinsein, Einsamkeit, Abstandhalten,
Meinungsvorsicht, Zweifel, Freude am Fragen, Schweigen, das sind die ersten Voraussetzungen, um zu schreiben.“
Gegenüber vier konkreten Rezensenten empfindet Delius Rezensionsfrustration, ihre Namen nennt er nicht, auch die FAZ ignoriert seine Buchneuerscheinungen oft, meine Diagnose mit A:
Literaturkritiker-ALLERGIE!
Stichwort „Amazon: Nicht eine Bestellung, kein Cent bis heute. Das soll so bleiben.“ Unter dem A-Buchstaben notiert Delius auch: „Amour Fou“, hier heißt es unkonkret: „Die eine oder andere. Mehr muss
nicht verraten werden, auch hier nicht.“
Dem Läufer Liebrichs setzt er ein kleines Extra-Kapitel-Denkmal und enthüllt die Gelbsucht-Krankheiten der Weltmeister-Elf, der 1954 zur Leistungssteigerung in wenigen einzelnen Spritzen gemeinsam
Traubenzucker verpasst worden war.
Zurück zum Autorendasein: „Was ist die größte Anstrengung im Literaturbetrieb? Erst die Anstrengung, dazuzugehören? Dann, dort nicht an den Rand gedrängt zu werden? Oder endlich die Anstrengung, sich
da rauszuhalten? Sind das überhaupt Anstrengungen?“
Trotz Computerwelten im Alltag des Schriftstellers: „Phantasie, Handwerk, Denken, Fleiß, Formulieren - bleibt meine Sache, zum Glück.“ Sein alter Macintosh samt Tastatur mit Schweißspuren ist
inzwischen im Literaturarchiv Marbach zu besichtigen“, erwähnt Delius am Schluss. Mit dem Kapitelstichwort AZZURRO beendet der Italien- und Romfreund seine Alphabet-Biographie, und wie heißt es so
schön bei ihm: „Es gibt kein Ende, es gibt nur Anfänge.“
Trotzdem ist an dieser Stelle die Rezension nun zu Ende. Es ist ja auch wahr: Für Delius war auch Schluss - mit dem Leben - am 30. Mai 1922 - in Berlin.
Audios
NDR
SWR
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman «Wenn
die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» (2019) und der Erzählungsband «Die sieben Sprachen des Schweigens» (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis
und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit einundzwanzig Bände.
Friedrich Christian Delius Darling, it's Dilius Erinnerungen mit großem A Rowohlt
Vom Fernsehmann zum Staatsmann: Selenskyj
Bücher sind nun mal eine träge Ware. Es dauert verdammt lange im Produktionsprozess, bis sie auf den Markt kommen, schließlich im Laden landen und dort auch mal versanden, wenn die Presse oder der Kunde sie nicht wahrnehmen wollen. Zuweilen müssen Buchproduzenten gegensteuern, wenn sie ein Thema schnell auf den Markt bringen müssen, um Profil zu zeigen oder zügig ein aktuelles Thema vor der Konkurrenz zu besetzen oder ganz einfach ein Geschäft vor der Konkurrenz zu machen.
Sergii Rudenko’s politische Biografie über Selenskyj ist so eins. Vor dem Kriegsbeginn konzipiert und dann schnell aktualisiert, als die Russen in der Ukraine einmarschierten. Das Buch ist sehr
detailreich in den Tiefen der ukrainischen politischen Entwicklung verfangen. Die vielen Namen, Verbindungen, Organisationen, Oligarchen, Hierarchen sind für den westlichen Leser nur schwer in die
politische Logik der Ukraine einzuordnen.
Das Buch zeigt den Aufstieg eines Mannes vom Komiker zum Staatsmann, vom Fernsehstar zum internationalen Führer eines Landes, das sich im Krieg mit Russland befindet.
Der Autor verspricht im Vorwort, nicht zu moralisieren, keine Vorurteile zu bedienen oder gar zu manipulieren, es gehe ihm um Fakten, allein um Fakten. Von denen liefert er dann sehr, sehr viele.
Schon eingangs gibt er in der Biografie zu verstehen, dass dereinst Historiker über Selenskyjs Rolle werden befinden müssen, dessen künftiges Schicksal immer mit dem endgültigen Bruch mit Russland
verbunden sein wird.
Wir erfahren sowjetische Erbschaftsangelegenheiten, etwa dass genug Geld für die Raumfahrt vorhanden war, aber nicht für die Heizung der Dorfschulen. Wir lernen Selenskyjs Vorgänger Janukowitsch
näher kennen, der irgendwann nach Russland abhaut. Gescheiterte Pressesprecherinnen kommen ebenso vor, wie Oligarchen, die es sich im Machtzentrum vom Präsidenten gemütlich gemacht haben.
Andererseits verschwinden Aufsteiger auch schnell wieder von der politischen Bildfläche.
Der Autor diagnostiziert dem ukrainischen Präsidenten reformerische Schwäche in Fragen der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und der Landesführung im Allgemeinen und benennt zugleich
Geldgeschäfte im Ausland über sogenannte Offshore-Konten. Selenskyj gab das mit der Begründung zu, man habe als Fernsehsender dem direkten Einfluss gegenüber der eigenen Politik im Lande so entgehen
wollen.
Es ist also auch ein Buch über Affären, Pfründe und persönliche Beziehungen zum Präsidenten, die für den schnellen Aufstieg erfolgreich waren. Kollegen beurteilen den Staatsmann in der Rolle des
Geschäftsmannes so: Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Keine Sentimentalitäten.
Im Schlusskapitel kriegt der Autor dann die Kurve, wenn er im Epilog über den Kriegspräsidenten spricht, hinter dem heute - geeint, stark und als uneinnehmbare Bastion - die ukrainische Gesellschaft
stehe.
Manchmal gilt auch der umgekehrte abgewandelte Satz Gorbatschows: Wer zu früh schreibt, den bestraft die Historie.
Sergii Rudenko SELENSKYJ Eine politische Biografie HANSER
Sergii Rudenko, geboren 1970, ist ein in Kyjiw beheimateter ukrainischer Journalist. Im ukrainischen Programm der Deutschen Welle ist er mit einer wöchentlichen
Kolumne vertreten. Außerdem ist er Chefredakteur beim privaten Informationssender Espreso.tv, der 2014 aus der Maidan-Bewegung hervor gegangen ist. Sein in der Ukraine 2020 erschienenes Buch ist die
erste Biografie Selenskyjs und wurde für die internationale Publikation aktualisiert.
Fodorová über Reinerová
Ausnahmsweise darf ich einmal persönlich werden. Mein Alterssitz liegt an der tschechischen Grenze, und seit die Russen dieses Land besetzt hatten, 1968 war das, interessiere ich mich für diese Land, seine Menschen, seine Politik und seine Literatur. So habe ich einige Werke von Lenka Reinerová gelesen, ihr politisches Schicksal kennengelernt und konnte – kurz vor ihrem Tod – in Prag ein letztes langes Interview mit ihr führen.* (veröffentlicht im Wieser Verlag)
So war ich gespannt auf das Buch von Anna Fodorová „Lenka Reinerová Abschied von meiner Mutter Mit einem Nachwort von Jaroslav Rudis“, erschienen bei btb.
Ich muss zugeben, ich war und bin ergriffen von diesem sehr persönlichen Abschiedsbuch einer talentierten Autorin, die von Haus aus als Psychotherapeutin in London arbeitet und deren Spezialgebiet generationenübergreifende Traumata sind. Ihr breit gefächerter Ausbildungsgang vom Architekturstudium, über Drehbucharbeit bis zur Psychotherapie ist sehr inspirierend für die Entwicklung ihres Buches, das zugleich Selbsttherapie ist und die Selbstwerdung der Autorin immer mit erzählt. Das Konstruktive aus architektonischem Denken und der Sinn für Dramaturgie aus der Drehbucharbeit mischen sich in dem Abschiedsbuch zu einem überzeugenden Konzept.
In einem Vorwort zu meinem Reinerová-Buch schrieb ich: „Lenka, die Kronzeugin der Prager deutschen Literatur! ‚Man muss Tscheche, Deutscher oder Jude sein‘, sagt Peter Demetz über sein Prag. Lenka Reinerová war alles, in einer Person, vor allem Europäerin, mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute, an die Gleichheit und die Gerechtigkeit. Sie hat die letzten Tage Habsburgs erlebt, Masaryks Erste Republik, die deutsche Besatzung, die erstarrten Jahre im Kommunismus und das Scheitern des ‚Prager Frühlings‘, die samtene Revolution und heute den wuchernden von ihr nicht gerade geliebten Kapitalismus. Und die Blöcke, sie zerbrachen.“
Lenka Reinerová hat ein mehr als bewegtes, wildes, politisches und persönliches Schicksalsleben hinter sich gebracht: Den Überfall der Deutschen „Ich überlebte, - weil ich am Tage der Besetzung nicht im Lande weilte“ -, die Verfolgung durch Kommunisten, die russische Besatzungszeit, die Wendezeit, sie saß in Gefängnissen und war lebenslang auf der Flucht. Widerstände, Tragödien, Verluste, Freunde und Erfolge prägten ihr Leben.
Als Schriftstellerin reduzierte sie ihre Berufsbezeichnung auf Erzählerin, weil sie eben darstellen wollte, was ist, wie ihr Kollege Egon Erwin Kisch, der ihr Vorbild war. In der Literatur fand sie selbst einen Ruhepunkt.
Es ist ein sehr poetisches, lebensnahes und persönlich anrührendes Buch, das Fodorová da gelungen ist.
Sie wuchs mit dem Geklapper von Schreibmaschinen auf. In „starrsinniger Bewunderung“ beschreibt sie die Leidens- und Lebensgeschichte ihrer Mutter, heiter-ironisch, melancholisch, liebevoll und doch auch distanziert analytisch, aber auch Zweifel sähend, denn Reinerovás Mantra war „Man darf sich nie selbst bemitleiden“. Das empfand die Tochter als unbarmherzig.
Es war also nicht „einfach gewesen, mit Eltern aufzuwachsen, die Helden waren“. Und zugleich mit einem Trauma erwachsen zu werden, das die Mutter empfindet, dank ihres Überlebens im Holocaustwahn des Naziregimes und allgegenwärtiger Seelenpein, weil der Verlust naher Menschen zu beklagen ist und der mitempfundenen Schuld, überlebt zu haben. „Das Trauma, für das es keine Worte gibt.“
Es ist auch ein Buch über das Altern und die Beschwernisse, die damit verbunden sind, vor allem, wenn die Mutter in Prag lebt und die Tochter in London arbeitet.
Mit 91 Jahren liest Reinerová noch das Buch „The Da Vinci Code“ und John le Carré und kritisiert die Schriftstellerkollegen. Aber ihr Ende naht doch bald. Nie glaubte die Tochter daran, dass ihre Mutter einmal sterben könnte, und doch geschieht es: „Gegen Morgen schlägt sie kurz die Augen auf, aber sie blickt irgendwo hin in die Ferne. Auf die Frage: “Woran glauben Sie?“ hat sie einem Kollegen geantwortet: “An das Leben.“
Anna Fodorová, 1946 als Tochter der Prager Schriftstellerin Lenka Reinerová (1916 – 2008) in Belgrad geboren, wuchs in Prag auf. Sie studierte an der Akademie der Künste, Architektur und Design in Prag, seit August 1968 lebt sie in England und machte ihren Filmabschluss am Royal College of Art in London. Sie drehte mehrere Animationsfilme, veröffentlichte ein Kinderbuch und schrieb Drehbücher für die BBC. Heute lebt sie in London und arbeitet als Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt psychoanalytische Psychotherapie generationenübergreifende Traumata.
Pressestimmen »Ein schonungsloses ehrliches Buch“ Deutschlandradio kultur
*Norbert Schreiber Lenka Reinerová Närrisch an das Leben glauben Lenka Reinerová im Gespräch mit Norbert Schreiber Wieser Verlag
„Meine Grundidee ist, beizutragen zur gegenseitigen Verständigung und Abschaffung aller Vorurteile und was es da noch so gibt…“ Lenka Reinerová
„Literatur, das ist eben diese Art, das wirkliche Leben darzustellen. Das ist alles.“ Lenka Reinerová
Zum Buch
Lenka Reinerová war die letzte lebende Kronzeugin der Prager deutschsprachigen Literatur aus der Generation Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch. Sie war Tschechin, Deutsche, Jüdin und bekennende Europäerin in einer Person, mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute, an die Gleichheit und die Gerechtigkeit. Sie hat die letzten Tage Habsburgs erlebt, Masaryks Erste Republik, die deutsche Besatzung, die erstarrten Jahre im Kommunismus und das Scheitern des »Prager Frühlings«, die samtene Revolution und heute den von ihr nicht gerade geliebten Kapitalismus. Der Radiojournalist Norbert Schreiber (Hessischer Rundfunk) besuchte die Literatin, die in den kulturellen Zirkeln der 20er und 30er Jahre in Prag ein und aus ging, von den Nazis und Kommunisten verfolgt, als Exilantin eine Irrfahrt rund um Welt erlebte. Lenka Reinerová starb am 27. Juni 2008 im Alter von 92 Jahren in Prag. Mit ihrem Tod ist diese Epoche der 20er und 30er Jahre in Prag aus dem Leben in die Bücher versunken. Ihre Stimme erklingt im „Prager Deutsch“ Ein letztes Dokument aus einer untergegangenen Welt.
Norbert Schreiber traf die Schriftstellerin in ihrer Prager Wohnung zum „hr2-Kultur Doppelkopfgespräch“ kurze Zeit bevor sie nach langjähriger Krankheit verstarb. Ihr gesamtes Leben lag ihr das deutsch-tschechische Verhältnis und das von ihr gegründete Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren am Herzen.
Auszug aus dem Einleitungstext
Eine Haushälterin empfängt freundlich auf tschechisch und bittet mich in das Wohn-Arbeitszimmer. Die „Grande Dame“ der deutschsprachigen Literatur in Prag begrüßt mich sehr herzlich, ihre munteren Augen verraten, dass sie sich freut auf ein Gespräch mit einem Deutschen aus Frankfurt am Main - trotz ihrer körperlichen Beschwernisse durch die langjährige Krebskrankheit und Chemothearpie. Sie trinkt einen Tee und bietet mir etwas zu trinken an. Sie sitzt etwas versunken in ihrem kleinen Sesselchen und blickt auffordernd zu mir auf: Lass uns beginnen, scheint sie zu signalisieren und beginnt schon selbst, mich auszufragen, wer ich bin, was ich tue, woher ich komme, sie stellt die „W“-Fragen der Journalisten, was das Interview soll, wo es gesendet wird, was ich vom deutsch-tschechischen Verhältnis halte, wie es denn ankomme, dass sie nun die Ehre hat, vom deutschen Parlament zum Gedenktag der nationalsozialistischen Opfer etwas äußern zu dürfen. Sie stellt die Fragen so, als müsste sie selbst noch etwas über unsere Begegnung schreiben.
Derweil habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihr vielleicht ein zu langes Gespräch zumuten werde, aber auf die Frage „kurzes oder langes Interview“, hat sie selbst entschieden und wie selbstverständlich, nachdrücklich betont: „Wir haben Zeit.“
Einen Tag nach unserem Interview wird die Schauspielerin Angela Winkler ihre Rede zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag verlesen und sie wird es nur im Fernsehen anschauen können, wenn ihre Rede von jemand anderem verlesen wird. Das deutsche Volk wird Lenka Reinerová nicht mehr hören können, ihr Gesundheitszustand bindet sie an ihr Zuhause.
Aber ich werde sie gleich hören können, ihre „Stimme einer untergegangenen Welt“ für mich ganz allein, für einen einzelnen Deutschen der sie besucht, wird sie erklingen in ihrem „Prager Deutsch“.
Auszug aus dem Interview
Es gibt einen Kafka-Spruch über Sie, und der stammt vom Verleger Klaus Wagenbach, der besagt: Wenn man hören will, wie Kafka gesprochen hat, dann muss man nur der Reinerová zuhören, denn sie spricht „Prager Deutsch“.
„Eben, genau, das ist mein Prager Deutsch, und ich wurde schon unendlich oft gefragt, was das eigentlich sei, das Prager Deutsch. Es ist kein Dialekt, es ist meiner Meinung nach vielleicht eine besondere und eine bisschen eigenwillige Art des Deutschen, der deutschen Sprache, zweifellos beeinflusst durch die geographische Lage. Darin sind österreichische Einflüsse. Für mich, ich bin ja kein Wissenschaftler, ist das Prager Deutsch weicher und – wenn ich so sagen darf – ein bisschen schlampiger als das deutsche Deutsch. Das deutsche Deutsch ist exakt, sehr präzis, und wir sind, das kommt vielleicht vom Tschechischen wieder, wir sind etwas lockerer. Ich höre diesen Unterschied. Aber dass ich als geborene Pragerin, als eine in dieser Stadt aufgewachsene Person, Prager Deutsch schreibe, kommt mir ganz natürlich vor.
„…das ist eben diese Art, das wirkliche Leben darzustellen. Das ist alles.“
Lenka Reinerová
Verleger Lojze Wieser schreibt zum Erscheinen des Buches: „Lesen und hören. Einsam und doch gemeinsam. Eine Verbindung, die die Tonalitat der Sprache zum Klingen bringt und die uns in gedruckter Form beim Lesen die Möglichkeit gibt, die Entwicklung des Gedankens in all seiner Zerbrechlichkeit nachzuzeichnen, dem Sich - Hintasten zu folgen, alle Seiten der Unsicherheit zu spüren, und dem Lesenden das Zugeneigtsein - zum Gedanken, zum Autor, zur Autorin, zum Thema - finden lässt. Die Idee kam von Norbert Scheiber vom Hessischen Rundfunk. Man müsse sehen, wie die vielen Gespräche, die von ihm und seiner Kollegenschaft im Laufe der Jahrzehnte geführt wurden, für die Leserschaft nutzbar gemacht werden. Wie macht man eine CD, die man gut lesen kann, und wie macht man ein Buch, das man gut hören kann? Es folgten viele Gespräche und Abwägungen. Viele sinnvolle und zu verwerfende Gedanken wurden gewälzt und nicht zuletzt viele Versuche in der Buchbinderei gemacht, bis die richtige Form der Umsetzung gefunden war. GEHÖRT GELESEN ward geboren. Ein Buch mit doppeltem Umschlag, wo sich im aufklappbaren und doch nicht flattrigen Schutzumschlag die CD zum Herausnehmen und Hören befindet und das sich von außen doch nicht von einem Buch unterscheidet. Nun liegt der zweite Band der neuen Reihe GEHÖRT GELESEN im Wieser Verlag vor.
Pressestimmen „Vielen Dank für dieses tolle Tondokument. Sehr weise Worte und außerdem noch typisches Prager Deutsch gehört, das leider kaum
mehr in der Form gesprochen wird.
Portal Radiokunst
Edgar Selge Hast du uns endlich gefunden?
Edgar Selge ist ein beeindruckender erfolgreicher Schauspieler, und er wagt sich nun mutig auf ein neues Terrain: das Schreiben! Es ist also sein erster Roman, ein Debut, in dem er Autobiographisches
mit Fiktionalem mischt. „Jetzt sitze ich hier und schreibe das auf. Hoffentlich verschwinde ich nicht zwischen den Sätzen. Je genauer ich bin, desto fremder werde ich mir.“
Der Text enttäuscht nicht, Selge verschwindet nicht zwischen seinen Sätzen, im Gegenteil, es schwindet vielmehr das mir Fremdsein dieses Charakterdarstellers von Satz zu Satz, und wir gewinnen als
Leser nach und nach ein klares Bild von ihm und einer typisch deutschen Familie, mit strengem Über-Vater, einem Gefängnisdirektor und der Mutter, die treu im Haushalt zu dienen hat.
Selge blendet in die autoritäre Nachkriegszeit zurück. Er erfährt das strenge Erziehungsregiment der Eltern wie ein Déjà-vu. Selge berichtet vom Freud und Leid in seiner Kindheit. Sein Vater ist
strafversetzter Gefängnisdirektor, der gerne vor Publikum Klavierkonzerte gibt. Die Gefangenen dürfen zuweilen seiner klassischen Hausmusik lauschen.
Er beschreibt das Elternhaus so: Kultur steckt in ihnen, Gedichte haben sie im Kopf, Musik pulsiert in ihrem Blut und in den Fingern. “Ich bin derselbe Träumer“, sagt Selge und stellt zugleich die
Frage: „Was für ein Teufel steckt bloß in mir? Wie lange werden sie draufschlagen müssen auf mich, auf meinen Po, auf meinen Rücken, in mein Gesicht, bis dieser Teufel endlich Reißaus nimmt?“
Es ist also Gewalt im Spiel im Hause Selge. Der Debütautor mischt Sprachkritisches, Musikkritisches, Familienkritisches. Sein Fazit: „Mensch, Edgar, sag was los ist! Meine Liebe zu meinem Vater. Das
ist, was los ist. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“ „Dann triffst du meine Wange, voll und klatschend. Ich greife mir vor Schmerz ins Gesicht…. Du musst zuschlagen. Das ist
ein Zwang. Du musst die Welt in Ordnung bringen. Du musst mit Ohrfeigen die Welt besser machen.“ Das geht bis zur sexuellen Übergriffigkeit, die Selge nachempfindet.
Auch ich bin in jener Zeit aufgewachsen, zum Glück ohne diese Gewalterfahrungen, aber die Zeiten damals, die Gedanken, das Empfinden, die Erlebnisse sind nachfühlbar, sie gleichen sich. Es ist eben
der Muff von tausend Jahren und es sind zugleich die Folgen eines tausendjährigen Reiches.
Selge liebt Musik und Sprache, das spürt man an jeder Stelle des Buches. Er komponiert lustige Vergleiche, etwa „Da sehen die Häuser aus wie Kaffeetanten.“ Und immer wieder erfahren wir
Musikalisches. Wenn Selge etwa bei Marschmusik und Piccoloflöten die Beine nicht mehr stillhalten kann. Posaunen den Brustkorb dehnen. Oboen ihren Resonanzraum unter der Schädeldecke suchen. Das
Fagott zwickt, schneidige Trompeten fassungslos machen, die Tuba saukomisch klingt und das Horn todtraurig. Er schreibt sogar von versoffenen Tönen.
Solchen Beschreibungen folgen in knappen Sätzen klar formulierte Erkenntnisse, wie etwa: Reue kann nicht kontrolliert werden. Grundsätzlich nicht. „Wer das versucht, züchtet Schauspieler.“
Die Eltern sind für Selge keine Einzelwesen, sondern eine herrschende Institution. Es ist eine Macht, die verhört, schlägt, bestraft. Selge fragt: „Was ist die Wildnis in uns allen?“ Oben, im
Apfelbaum, spielt er als junger Bub Krieg und ahmt Bombardierungen nach.
Auf Seite 229 schildert Selge die Monotonie des Alltags, den Spießrutenlauf durch den täglichen Parcours der Haushaltspflichten, verursacht durch den „entsetzlichen Kreislauf“ der Mahlzeiten. Das
reicht vom Haus saubermachen, übers Aufstehen und Essen planen, zum Einkaufen, bis zum Töpfe rausholen, Messer, Bretter raus, Gemüse schneiden, Bohnen schnippeln, Fleisch vorbereiten, Wasser
aufsetzen, Zwiebel anbraten, Abwasch, Boden sauber halten, Mülleimer rausbringen, Fußmatten ausschlagen, Wäsche waschen, abnehmen, bügeln, zusammenfalten und so weiter und sofort. Alles bleibt an der
Hausfrau hängen. Alles klebt an ihr dran „Diese Männer, die ihr Leben auf dem Erbe der Frauen aufbauen! Aber ihren Frauen das Haushaltsgeld zustellen!“ Oder „Für meinen Vater bedeutet Fleisch auf dem
Teller die Wiederherstellung seiner Grundrechte.“
Das Thema Gewalt in der Familie, das Ur-Thema Nazi-Erbe wird im Text verarbeitet, etwa die Fragen wie kann man noch von edlem Menschentum reden angesichts der Kriegsgräuel und Judenvernichtung.
Als ihm auch die Mutter als Strafmaßnahme Schläge verpasst, empfindet Selge sie eher als eine Behauptung, ein Moment wie auf der Theaterbühne. Sie spielt das Schlagen, Edgar Selge schluchzt, um ihr
wenigstens das Gefühl zu geben, dass ihre Strafe eine Wirkung hat. Die Mutter sagt, so weh kann das jetzt nicht getan haben. Und doch ist es Gewalt, die weibliche, die sanftere Variante.
Es ist ein Buch vom Suchen und Finden, von Lüge und Ehrlichkeit, vom Erwachsenwerden und Kind bleiben, ein träumerisches und realistisches Buch zugleich. Ein Romanmonolog ohne eigentliche Handlung,
eine Selbstvergewisserung ohne Gewissheiten, weil der Zweifel weiterlebt.
Michael Krüger, einst Verleger und selbst Schriftsteller, rezensiert den Roman mit den Worten: Selge schreibt mit Ernst, Lakonie und trifft den "richtigen Ton". Es ist ein Debüt im Alter von 73
Jahren, mit seelischem Tiefgang, lakonischem Humor, Selbst- und Fremderkenntnis zugleich, befruchtet vom Können eines großartigen Schauspielers.
Edgar Selge Hast du uns endlich gefunden Rowohlt
Abschied von Angela
Das Urteil über die Kanzlerin Angela Merkel hat die Welt längst gefällt. In Deutschland gehen die Meinungen weiter auseinander. Erst im Abstand und unter Berücksichtigung dessen, was oder wer ihr nachfolgt, wird eine historische Beurteilung möglich sein, die dann vielleicht „nachhaltig“ sein wird. Deshalb tut die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld gut daran, ihr „Porträt einer Epoche“ ohne große Bemühungen ihrer vielfältig bewiesenen Urteilskraft eher als zeitgenössische Chronistin zu zeichnen.
Das wird ihr ein großes Publikum sichern, denn viele Deutsche wollen vor Ablauf der selbstbestimmt endenden Kanzlerschaft noch einmal wissen, was Merkel eigentlich bewirkt oder auch, was sie nicht
bewirkt hat.
Ganz ohne eine Beschreibung von Kindheit und Jugend in der DDR ist die Kanzlerin nicht zu erklären. So erfährt die staunende Leserin einiges über die von Merkel in Leipzig und Prenzlauer Berg gelebte
Bohème-light, wie sie damals möglich war. Anders als Ralph Bollmann in seiner umfangreicheren Merkel-Biographie beschränkt sich Weidenfeld dann im Wesentlichen auf die Kanzlerin und verzichtet
weitgehend darauf, die CDU-Vorsitzende als zweiten Fokus in den Blick zu nehmen. Das Sichtbare zählt für sie. Dabei lässt sie vielfach die Kanzlerin selbst zu Wort kommen.
Als Merkel z.B. der damalige Star im Kabinett von Guttenberg wegen der Plagiatsvorwürfe von der Fahne gehen musste, zitiert Weidenfeld die Kanzlerin mit einem vielleicht auch für aktuelle Fälle brauchbaren Wort vom 21.2.2011: „Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden … berufen, sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister … und das ist, was für mich zählt.“ Der hatte mit Merkels Segen gerade die Wehrpflicht abgeschafft. Zu einem Epochen-Porträt zählen auch die Stimmen der Zeit. Aus der Vielzahl derer, die die Autorin aufruft, ohne sich dem Urteil anzuschließen, sei die aus der umstrittenen Flüchtlingsfrage der „sonst strengen“ Zeit-Journalistin Jana Hensel zitiert: „Da bin ich mir sicher, dass wir eines Tages feststellen werden, dass sie recht hatte. Dass der Wir-Schaffen-das-Satz das größte Kompliment gewesen ist, das sie uns machen konnte. Sie hat uns Deutschen damit ein Stück ihrer Größe und Würde als Auftrag zurückgegeben. Und wir werden es schaffen, nun auch ohne sie.“
In einem interessanten Kapitel beschreibt Weidenfeld die Kanzlerin im gesellschaftlichen Rahmen des Feminismus auch ihre Beziehung zu Alice Schwarzer. Als sie gefragt wird, ob Deutschland angesichts vieler weiblicher Vorstandmitglieder in der CDU auf dem Weg ins Matriarchat sei, antwortet sie schlagfertig: „Nein, wir wechseln nur vom 20. ins 21. Jahrhundert.“ Mit solchen Zitaten porträtiert Weidenfeld treffend die Kanzlerin und eine Epoche, in der es immer auch um Quoten und vor allem um gleiche Rechte geht.
Die promovierte Physikerin Merkel hatte zwei Erkenntnisse abzuwägen: Die Kernenergie ermöglicht die Stromgewinnung ohne klimaschädliches Kohlendioxid aber Kernkraftwerke bergen ein hohes Risiko und
die Entsorgung der radioaktiven Rückstände ist nicht gesichert. Am Ende entscheidet sie angesichts der Reaktorkatastrophe von Fukushima für Sicherheit und setzt verstärkt auf Wind und Sonne, um das
Klima zu schonen. Diese Entscheidungsfindung sieht im Rückblick wie ein Zick-Zack-Kurs aus, erscheint aber – trotz ihrer handwerklich mangelhaften Umsetzung – nachvollziehbar. Einen Großteil ihrer
weltweiten Reputation hat der Kanzlerin ihre ja nicht in die Wiege gelegte Europa-Zuwendung eingetragen, ihre von Strenge und später Nachsicht geprägte Haltung gegenüber Griechenland, ihr
Friedensengagement in der Ukraine-Krise und in der Auseinandersetzung mit dem Iran.
Ihr weltweites Antreiben in der Klimapolitik geht vielen nicht weit genug, anderen viel zu weit. Die Epoche, die Weidenfeld als die Zeit der Kanzlerin porträtiert, geht aber weiter. Das Urteil über die Weichen, die Merkel in ihrer Kanzlerschaft gestellt hat, werden künftige Historiker fällen – wahrscheinlich dann wiederum kontrovers. Was die Autorin dieses Buches leistet, ist eine sorgfältige, weitgehend vorurteilsfreie Chronik, die aktueller kaum sein kann und die das lesende Publikum verschlingen wird.
Harald Loch
Ursula Weidenfeld: Die Kanzlerin - Porträt einer Epoche
Rowohlt Berlin, 2021 320 Seiten 22 Euro
Spontane Lebensentwürfe im Talk
Das Leben bejahen oder als Last empfinden, und die dritte Möglichkeit ist: Sein Leben zu ändern. Das sind drei Möglichkeiten mit dem Dasein konkreter umzugehen. Die Autorin Gisela Steinhauer schreibt ihr eigenes Leben auf und parallel dazu das Leben der Anderen, das sie in Interviewform im Radio in Talkformaten ihren Gästen entlockt und in dem Buch farbig beschreibt.
Gisela Steinhauer hört in der Kindheit, von Märchen-Schallpatten abgespielt, schöne warme Stimmen, als dafür noch Abtastnadeln korrekt in Rillen positioniert werden mussten. Sie hört eben gerne zu.
In ihrer Kindheit leben noch drei Generationen unter einem Dach, das prägt das Miteinander.
Steinhauer liebt die Neugierde, schräge Vögel, die Unangepassten, und ihr Motto ist neben dem Zuhören eben das Fragen. Für Journalismus hilfreich.
Bei einer Ayurveda-Meditation lässt sie Personen und Interviewbegegnungen aus ihrem reichhaltigen Journalistenleben Revue passieren. Die eine oder andere Szene aus ihrem Radioleben nehmen wir dabei
auch mit - lästige Konferenzen in ARD-Redaktionen zum Beispiel.
Das Buch ist ein Katalog des Lebens, um Schlüsse daraus zu ziehen. Ein Bilderbuch des Lebens: Die Schauspielerin Lea Wyler, die Projekte in Tibet Nepal und Afrika auf die Beine gestellt hat, ist
Interviewpartnerin, Hugo der Retter aus dem Regenwald wandert nach Papua-Neuguinea aus, baut dort eine Schweinefarm auf und lässt sich ins Parlament wählen. Gisela Steinhauer empfängt einen Schamanen
im Studio, der mit Eulen und Adlern hantiert und blinde Pferde sehend macht. Sie lernt auskunftsfreudige Trauerredner kennen und den liebgrantigen Nobelpreisträger Grass, bei dem sie an einem
Hitzetag um ein Glas Wasser betteln muss, aber bei dem es gelingt, hinter dem Schnauzbart mit den richtigen Fragen auch mal ein Lachen hervorzuzaubern. Günter das Raubein schenkt ihr als Belohnung
eine Radierung der „Zwiebel“ und lässt ihre Interviewkunst per Brief loben. Einst war eine Interviewpartnerin eine Bembel-Keramikerin, heute führt sie als Reiseleiterin Touristen durch die
Wüste.
Solche Lebensentwürfe liebt die fleißige Journalistin, die mehrere Radio-Talks der ARD betreut. Ihr Credo formuliert sie im Interview mit dem Stadtmagazin des Siegkreises: „Die originellsten Wege
zeigen schräge Vögel, die ihre Flugrichtung ändern. Vielen davon bin ich auf meinen Reportage-Reisen begegnet und sie haben mich begeistert. In meinem Buch treffen sie aufeinander … warum also sollte
ich Menschen interviewen, die sich nur für sich selbst interessieren?“
Gordon Munro, der Butler-Trainer war ihr Gast, ein international bekannter Bilderfälscher ebenso, auch die Bestseller-Autorin Cornelia Funke und nicht zuletzt der Humorexperte Harpe
Kerkeling.
Dieses Buch ist ein Personen-Panoptikum-Kaleidoskop, mit Texten, nachdenklich und leichtfüßig zugleich, humorvoll und analytisch portioniert, spontan und frech formuliert, zugewandt,
frisch-fromm-fröhlich-frei artikuliert, liebenswürdige Blicke auf diesen vielfarbigen Menschenzirkus, in dem Akrobaten und Clowns, Normale und Verrückte ihre Lebens-Salti vollführen, Unangepasste und
Risk-Menschen, die in für sich einfach alles ausprobieren und dabei ihren Alltag für immer auf den Kopf stellen.
Im Schlusswort bekennt sich die Autorin als Erich-Kästner-Fan. Darum beenden wir diese Buch-Rezension mit einem Zitat von ihm, passend zu schrägen Vögeln und Neuanfängern: "Bei Vorbildern ist es
unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken
gesagt oder getan hat, wovor wir zögern."
Gisela Steinhauer, geboren 1960, ist Moderatorin bei WDR 2 ("Sonntagsfragen"), WDR 5 ("Tischgespräch") und bei Deutschlandfunk Kultur. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie u.a. mit dem Kurt Magnus Preis, Radio Journal Rundfunkpreis und dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Sie lebt in Köln und Berlin
„Ein Interview mit Gisela Steinhauer ist wie ein Tanz. Sie führt – und beide schweben elegant und sicher über das Parkett.“
Dörte Hansen
„Wenn Gisela Steinhauer mit Menschen spricht, rückt man sofort näher ans Radio heran. Ihre feine, kluge Art, zuzuhören und nachzufragen, hat mich stets sehr beeindruckt.“
Christine Westermann
„Gisela Steinhauer bereichert seit mehr als 30 Jahren das Programm des WDR. Nun hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht und erzählt die Geschichten von Menschen mit Mut zum Neuanfang.“
WDR2 Thadeusz
„Steinhauer erzählt … hinreißend. … Viele schöne und interessante Beiträge, die wach machen, den Leser zum Lachen oder Weinen bringen.“
Susanne Laschet in der Aachener Zeitung
“ Ein Buch mit viel Tiefgang und Leichtigkeit.“
Domradio
„Ein tolles Buch – absolut lesenswert und inspirierend.“
Kreativ durch die Krise – die Storymacherin
„Nach über eintausend Interviews hat diese Ausnahmejournalistin nun ein Buch über schräge Vögel geschrieben. Durch Zufall bin ich auf den Titel gestoßen und war sofort Feuer und Flamme.“
Cristián Gálvez, der Montagmorgen-Impuls
Steinhauer Gisela Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm Von Menschen mit Mut zum Neuanfang WESTEND
Der Schatten-Bruder von Thomas Bernhard
Der „Schatten-Mann“ tritt heraus aus dem Dunkel und bekennt als Peter Fabjan: Ich bin der Bruder von Thomas Bernhard, hatte ein Leben an seiner Seite und schreibe jetzt einen „Rapport“, der bei
Bernhards Hausverlag SUHRKAMP veröffentlicht wird, obwohl ich doch ureigentlich ein Mediziner bin, dem die Grundlage für ein Leben als Künstler fehlt.
Das Leben des Anderen, des Bruders, wird „nur geduldet“, schreibt Fabjan. Beide Brüder leben in Parallelwelten, die räumliche Nähe in Gmunden „bedingt ein verstärktes Miteinander“, es ist so etwas
wie ein Distanz-„Miteinander“, möchte man meinen, als wäre Corona schon unterwegs.
Die Familienverhältnisse sind so kompliziert, dass der Autor 105 Seiten braucht, bis sie en Detail geklärt sind und er zu seinem eigentlichen Thema, dem Verhältnis zu seinem Bruder, kommen
kann.
Die Süddeutsche Zeitung moniert, da wäre eine Ahnengalerie hilfreich gewesen.
Beide Brüder hatten dieselbe Mutter. Peter Fabjan hatte jedoch das Glück, in eine Familie hinein geboren zu sein. Als uneheliches Kind wurde Thomas Bernhard ins Pflegeheim abgeschoben, er wuchs aber
später bei seinen Großeltern auf. So erkennt Fabjan, dass die Kindheit seines Bruder-Patienten „wohl in frühster Kindheit erstorben“ war.
Den eigentlichen Vater Alois Zuckerstätter wird Thomas Bernhard nie kennenlernen. Der verfällt der Trunksucht und begeht 1940 in Berlin Selbstmord.
Bernhard provoziert, verachtet, stößt geliebten Menschen vor den Kopf, löscht aus, wechselt zwischen Warmherzigkeit und Eiseskälte, heftiger Brutalität und Zuneigung.
Bernhard leidet an einer tuberkulösen Rippenfellentzündung und Morbus Boeck, einer systemischen Erkrankung des Bindegewebes, die zur Herzerweiterung führt. Eine Herztransplantation wird erwogen, aber
verworfen.
Fabjan lebt das Leben des Anderen, er ist Mediziner und gerät erst spät in die Rolle des behandelnden Arztes und Nachlassverwalters seines berühmten Bruders.
Peter Fabjan mischt in diesem 200-Seiten-Buch Briefzitate mit Familienbildern, Medizinberichte mit Anekdoten, Tagebuchnotizen mit Beobachtungen der Sterbebegleitung. Hintereinander weg lernen wir in
Kurzkapiteln wichtige Menschen kennen, die der Autor mit Thomas Bernhard gemeinsam getroffen und erlebt hat: Nachbarbauern, Handwerker, Immobilienmakler, Politiker, Architekten, Verleger, Regisseure,
Schauspieler, Künstler, Kleinadelige, Hocharistokraten.
Wir lesen Notizen, Protokolle, Lebensläufe, Reiseberichte, Krankengeschichten, Nachlassnotizen, Übersichten der Liegenschaften und des Immobilienbesitzes, Organisationsfragen zum Erbe,
Lebensstationen und ein kurzes Fazit auf Seite 191 sowie den Lebenslauf des Autors selbst, der in diesen „Thomas-Bernhard-Teppich“ eingewoben ist. Personenregister und Ahnentafel, wie gesagt,
fehlen leider.
So ist das Buch mehr Krankenakte als Literatur, mehr Dokument als Poesie. Der Text ist nah und doch so fern. Der Bruder-Autor bekennt: "Wenn Thomas nicht mehr lebt, werde ich meine Zuneigung viel
stärker empfinden, als er es mir heute erlaubt." Die Frage für das Buch ist aber auch, wie viel Nähe und Distanz Fabjan sich in der Rolle des Bruders und behandelnden Mediziners erlaubt. Man spürt
eher die Ferne zu Thomas Bernhard, und der ist da wie immer brüsk und radikaler zu sich und anderen: „Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es
ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“
Peter Fabjan Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard Ein Rapport SUHRKAMP
Der "Schatten"-Bruder: Heinrich Mann
Er ist der Schatten-Bruder: Heinrich Mann, Bruder von Nobelpreisträger Thomas Mann. Während sein Bruder Heinrich in Ost und West gerne gelesen und gefeiert wurde, blieb die große Anerkennung Heinrich Manns in der aufstrebenden Bundesrepublik der Adenauer-Zeit versagt. In der DDR dagegen war er beliebt, sollte zur Lebenszeit und auch nach seinem Tode politisch vereinnahmt werden. Als „politischer Träumer“ mit Weltverbesserungs-Ansatz und radikalem Idealismus starb er verarmt in den USA.
Günther Rüther möchte unser Bild auf Heinrich Mann, Autor vom „Untertan“, zurechtrücken, ihn ins rechte Bild rücken. Er teilt seine Biographie in vier Abschnitte: das Wihelminische Reich, den Ersten
Weltkrieg und die Weimarer Republik, in die Zeit im USA-Exil, dem Land der Träume und in die Exil-Endphase des Lebens in Los Angeles.
Als Idealist setzt Heinrich Man auf Wahrheit und Gerechtigkeit, er träumt als Idealist von einer besseren Welt. Seine Traumverlorenheit fällt in der Buchhändlerlehre schon dem Lehrherrn auf, der
Heinrich Mann Gleichgültigkeit und Wortkargheit attestiert. Bei ihm mischen sich depressive Momente mit Zeiten der ausgelebten Lebenslust.
Heinrich Mann träumt von einem guten Leben: Satt zu essen, schönes Wetter in einem schönen Land und dann und wann eine angenehme Frau. Dabei schätzt er Schriftsteller, die soziale Wirklichkeit in
ihren Werken abbilden, etwa Zola in Frankreich oder Hauptmann in Deutschland.
Ärzte attestieren ihm die damals unter Künstlern modische Krankheit, die so genannte Neurasthenie, ein Zustand der Schwäche und Überreiztheit. Man fühlt sich nämlich schlecht, reist von Kur zu Kur,
leidet an den Folgen der modernen zivilisatorischen Fehlentwicklungen. Überhaupt war sein Lebenswandel von „unerfüllten Sehnsüchten und Träumen bestimmt“ wie Rüther schreibt.
Wir erfahren in der Biographie, dass Heinrich Mann im Geist der Zeit auch fahrlässig antisemitisch denkt, weil sich die Juden als Rasse gegen die Tendenzen des modernen Nationalstaatsprinzips wenden.
Das passt erst mal so gar nicht zum Bild des Humanisten, Pazifisten und Sozialisten Heinrich Mann.
Die Biographie folgt chronologisch den Haupt-Lebenslinien Heinrich Manns und der Linie seiner Werke, die er geschrieben hat.
In einem Brief an seinen Bruder Heinrich kritisiert Thomas Mann dessen literarische Arbeit: Oberflächlicher Stil, Sätze, denen die innere Geschlossenheit fehlt, vor allem aber sprachliche Haltung und
Strenge.
Von da an, war ihr brüderliches Verhältnis gestört, Heinrich war tief verletzt, fühlte sich gründlich missverstanden, ihre Beziehung sollte sich, so der Autor, nie wieder ganz erholen. Während Thomas
Mann mit den Buddenbrooks und anderen Werken von Erfolg zu Erfolg eilt, bleiben Heinrich Manns Werke in kleinen Auflagen hängen.
Heinrich Mann verweigert sich der „Kriegsbesoffenheit“ in der Weimarer Republik, er träumt und schwärmt von Menschenrechten und Völkerfrieden, von Gerechtigkeit und Freiheit im Inneren, von
Überwindung des Untertanengeistes, und er denkt europäisch, fußend auf den einigenden Kräften des europäischen Geistes und einer zukünftigen deutsch-französischen Freundschaft.
Von den Nazis wurden auch Heinrich Manns Bücher verboten und verbrannt.
Ausführlich widmet sich Rüther der deutschen Exilkolonie um Brecht, Werfel, Koestler, Feuchtwanger, die an der Cote d`Azur ihnen Zufluchtsort vor den Nationalsozialisten finden, der auch Heinrich
Mann angehört.
In seinem Buch „Der Haß“ richtet Heinrich Mann sich gegen die Nazi-Tyrannei, sie seien „Hohepriester des Hasses“.
Von Lissabon aus tritt Heinrich Mann die Atlantikreise per Schiff an. Als „Ghostwriter“ in einem Filmstudio hält er sich gerade so über Wasser, schriftstellerische Erfolge bleiben aber aus, Mann ist
angewiesen auf die Unterstützung seines Bruders. Der russische Botschafter steckt ihm ab und an etwas Geld zu. Seine Kontakte nach Ost-Berlin hatten ihn in der jungen Bundesrepublik verdächtig
gemacht. Es gelang ihm, wie Rüther schreibt, kein Neuanfang auf dem amerikanischen Büchermarkt.
Heinrich Mann stirbt am 11.März 1950 in Sonta Monica den „Gehirntod“. Elf Jahre nach seinem Tod wird Heinrich Manns Urne in der Heimaterde in Berlin im Beisein von Walter Ulbricht beigesetzt.
Dieser erklärt kurz und bündig „Heinrich Mann ist unser“.
Der Biograph Rüther resümiert ebenso knapp: Mit diesen Worten fügte er ihm einen Schaden zu, von dem er sich bis heute nicht vollständig erholen konnte.“
Rüthers Biographie ist eine stark politik-historisch geprägte Analyse, die den Werken Heinrich Manns und ihrer literaturhistorischen Einordnung breiten Raum lässt, ohne das schwierige Verhältnis von
Bruder zu Bruder überzubetonen, ergänzt um eine Zeittafel, Anmerkungsapparat Literaturauswahl, Abbildungsnachweis und Personenregister. Was fehlt, ist jedoch leider ein kommentiertes Werkverzeichnis
von Heinrich Mann. Ein Buch für literaturgeschichtlich Interessierte Leser.
Günther Rüther Heinrich Mann Ein politischer Träumer Biographe MARIX
Günther Rüther, Dr. phil., Emeritus der Exzellenz-Universität Bonn. Viele Jahre Leiter der Abteilung Begabtenförderung u. Kultur der Konrad Adenauer Stiftung. Im Verlagshaus Römerweg erschienen: Wir Negativen. Kurt Tucholsky und die Weimarer Republik, Theodor Fontane. Aufklärer – Kritiker – Schriftsteller, Theodor Fontane. Alles ist Zufall. Schriften eines Realisten und Heinrich Mann. Ein politischer Träumer / Biographie.
Günther Rüther Heinrich Mann MARIX
Der Untertan - bei Fischer neue Sonderausgabe!
„Vergesst nicht, das Buch von Mann zu beschnüffeln; es lohnt sich.“ Diese Empfehlung gab Albert Einstein am 22. April 1016 seinem Freund Michele Besso. Er meinte damit den Roman „Der Untertan“ von
Heinrich Mann. Das Buch war einen Monat vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges fertiggeworden und in mehreren Folgen in „Zeit im Bild“ vorabgedruckt, aber als Buch kriegsbedingt noch gar nicht
herausgekommen. Das war erst nach Aufhebung der Zensur nach dem Ende des Krieges möglich und erreichte bald eine Auflage von über 100 000.
Es wurde und blieb bis heute das Meisterwerk der klassischen Moderne oder – mit Bertolt Brecht – „der erste große satirische politische Roman der deutschen Literatur“. Seine zweite Renaissance erlebte er nach dem nächsten Weltkrieg. Zunächst brachte ihn der Aufbau Verlag in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone, wiederum in hohen, allenfalls durch die Papierknappheit begrenzten Auflagen.
Der DEFA Film von Wolfgang Staudte (1951) brachte ihn die Kinos, zunächst nur in der DDR. In der Bundesrepublik fiel er der Zensur zum Opfer und wurde erst mehr als 20 Jahre später gezeigt. Jetzt,
mehr als hundert Jahre nach der ersten Auflage im Winter 1918, gibt der S. Fischer Verlag eine großformatige, kostbar gestaltete Sonderausgabe heraus. Sie enthält ein Nachwort von Ariana Martin und
einen großen, von ihr besorgten Bild- und Materialanhang von nahezu 200 Seiten. Anlass ist der 150. Geburtstag Heinrich Manns am 27. März.
Wer den Roman nicht nur „beschnüffeln“ will, wie von Einstein empfohlen, wird bei der Lektüre vielleicht selbstkritisch in einen Spiegel blicken, sicher aber einen vortrefflichen Einblick in die
deutschen Verhältnisse unter Wilhelm II. gewinnen. Die Satire ist unterhaltsam, entlarvend und visionär. Sie weist auf den unmittelbar nach Abschluss des Manuskripts ausbrechenden Ersten Weltkrieg,
auf die teilweise fortbestehende Untertänigkeit nach dessen Ende und auf den Nationalsozialismus und den vielen in seinem Namen mordenden Tätern als Entschuldigung dienenden „Befehlsnotstand“
hin.
„Der Untertan“ ist ein literarisch anspruchsvoller, zeitloser politischer Roman, er hat einen bissigen Humor und liest sich unterhaltsam bei allem Ernst, mit dem er die wilhelminische Gesellschaft anprangert. Sein feiger Protagonist Diederich Heßling wuchs in einer Familie heran, in der die Eltern trotz ihrer fehlenden pädagogischen Sensibilität „von Gemüt überfließende Dämmerstunden“ hatten: „Aus den Festen preßten sie gemeinsam, vermittelst Gesang, Klavierspiel und Märchenerzählen, den letzten Tropfen Stimmung heraus.“
Solche Gefühlsseligkeit stellte sich im Erwachsenenalter des Heßling gelegentlich, etwa beim Anhören des „Lohengrin“ wieder ein. Kennzeichnend waren aber seine deutsch-nationalistische, überheblich-rassistische und die Arbeiter seiner Papierfabrik schikanierende Ausbeutung und seine kriecherische Haltung gegenüber der wilhelminischen Obrigkeit.
„Der Untertan“ machte in der Weimarer Zeit durchaus Eindruck, verhindern konnte er das, was folgte, nicht. Zwei Weltkriege nach seiner Fertigstellung konnte der Stiernacken des Heßling in Staudtes
großartiger Verfilmung die Grenzen des Kalten Krieges nicht von Babelsberg nach Bonn überwinden. Die in dem großen Bild- und Materialienanhang der hier anzuzeigenden Sonderausgabe enthaltene
Rezeptionsgeschichte reicht bis in die junge Bundesrepublik und die DDR. Sie ist ein fortgeführtes deutsches Geschichtspanorama. Es ist im Roman selbst visionär vorausgesehen und in einigen der
Erscheinungen der Gegenwart keineswegs nur Vergangenheit. „Der Untertan“ gehört also in jeden Bücherschrank und sein Geist aus jedem Kopf verbannt.
Harald Loch
Heinrich Mann: Der Untertan (Sonderausgabe)
Mit einem Nachwort und Materialanhang von Ariana Martin
S. Fischer, Frankfurt am Main 2021 638 Seiten 48 Euro
Biden oder Trump?
Wer ist Joe Biden, und wenn ja, wie viele? Joe sagt gern etwas. Und wenn, dann sehr viel! Seine Reden sind lang. Aber wenn Biden aufgefordert wird, sich kurz zu fassen, „nicht übermäßig viel zu reden“, ist er auch in der Lage, mit einem knappen „Ja“ zu antworten und dann zu schweigen: Joe Biden hat also mindestens zwei Seiten. Eine Kurz- und eine Langfassung.
Kennen wir Joe Biden? Im United States Senate Committee on Foreign Relations war er zuletzt Vorsitzender und damit Jahre lang einer der profiliertesten Außenpolitiker des amerikanischen Kongresses. Daher kennt Biden Gott und die Welt, in allen möglichen und unmöglichen Ländern, völlig gleich, ob es Konservative sind oder Sozialdemokraten, Demokraten oder Diktatoren. Aber kennen wir ihn? Noch nicht sehr gut. Der US-Journalist Evan Osnos, Redakteur beim Magazin THE NEW YORKER, stellt ihn uns vor.
Osnos beschreibt Obama als Technokraten und Biden dagegen als cleveren Instinktpolitiker, der menschliche Nähe sucht und es zuweilen mit liebevollen Berührungen übertreibt, ohne jedoch tiefer in die gefährliche Mee-too-Debatte zu geraten.
Bidens Vizepräsidentschaft unter Obama beschreibt der Autor als reine Vernunftehe. Während Obama die Verehrung gegenüber seiner Person relativ gleichgültig ist, sucht Biden „nach jeder Hand, jeder Schulter, jedem Kopf“.
Den Teleprompter mag er nicht, denn das bloße Vorlesen fällt ihm schwer. Biden hatte als Stotterer Sprachprobleme. So formuliert er gerne frei. Lässt Redemanuskripte links liegen und erlaubt sich in Wahlreden verbale Schnitzer, die in Wahlkampfstäben als „Joe-Bomben“ tituliert werden.
So übt Obama sich in Vorsicht: “Ich will ihren Standpunkt hören, Joe. Nur will ich ihn in zehnminütigen Ausführungen hören, nicht in sechzigminütigen.“
Biden hat ein Feeling für gesellschaftliche Veränderungen, liebt Ray-Ban-Pilotenbrillen, hat lockere Sprüche drauf, ist Liebling des Establishments, genießt das Bad in der Menge. John Kerry bescheinigt ihm: „Er ist ein Politiker, der ständig Tuchfühlung sucht, und es ist alles echt. Nichts davon ist aufgesetzt.“
So kann es aber auch sein, dass manche Biden als schlicht blöd oder kauzig ansehen. Und auch Frauen ihm ungebetene Zuneigungsbekundungen unterstellen. Biden versprach nach öffentlichen Angriffen, künftig die „persönliche Distanzzone zu respektieren.“
Putin gegenüber soll er nach eigenen Aussagen allerdings Auge in Auge gesagt haben, “Herr Ministerpräsident, ich schaue Ihnen in die Augen, und ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben.“
Osnos schildert Bidens außenpolitisches Handwerkszeug, deutet seine politischen Positionen, interpretiert seine Gespräche, begründet mit Zitaten, liefert auch das Hinter-den-Kulissen-Geraune, hat viele intensive Gespräche mit Biden und Obama geführt, aus denen er seine Details der Schilderung schöpft.
Während Bidens Konkurrentin Hillary Clinton die Truppenaufstockung in Afghanistan, einen Einsatz zum Sturz Gaddafis und das Kommandounternehmen gegen bin Laden unterstützte, sprach Biden sich gegen alle drei Vorhaben aus.
Wird Biden auf sein Alter angesprochen, entgegnet er: „Schaut mich an. Entscheidet selbst.“ Dass er früh Frau und Kind bei einem Autounfall verlor und später sein Sohn im Alter von 46 Jahren an einem bösartigen Hirntumor verstarb, bewältigte er mit Selbstfindungssprüchen: „Wir Bidens haben eine starke Persönlichkeit, und wir leben eng beieinander.“
So ist auch zu erklären, dass mehrere Wahlkampagnen, persönliche Schicksalsschläge, Angriffe wegen seines damals drogenabhängigen Sohnes, der Tatsache, der ewige Zweite zu sein, ihn nicht davon abhielten, als demokratischer Kandidat nach dem Verzicht von Bernie Sanders energisch in sein vorerst letztes Präsidentschaftsrennen zu gehen.
Er tat das unter den schwierigsten Corona-Bedingungen des „social distancing“ und gegen einen ständig spaltend-polternden Zwitscher-Präsidenten Donald Trump. Biden dagegen vermeidet jegliches Lagerdenken und will auch nicht den neusten „Twitterkrieg“ gewinnen. Die Vereinigten Staaten könnten „ohne Konsens nicht funktionieren.“
Im Falle des Wahlsieges sieht der Autor die generellen Themen China, Klimawandel, künstliche Intelligenz auf den möglichen Präsidenten Biden zukommen. Er führt das aber nicht näher und detaillierter aus.
In dem ersten deutschsprachigen Buch über den Herausforderer Donald Trump vermeidet Osnos in seinem farbigen, opulent zitatgefütterten Personenporträt mögliche Zukunftsszenarien und deren Deutungsmuster über die zerrissene Nation der USA.
Osnos personalisiert und psychologisiert in seiner Personenstudie über die zwei divergenten Stränge in Bidens Biographie: Einerseits die Mythen, auf denen die Politik seiner Verantwortung fußt und auf Bidens persönlichen Erfahrungen mit den Unglücken und tragischen Geschehnissen in seiner Familie.
Biden rechnet also immer mit dem Schlimmsten, zum Beispiel dass Trump sich nach der Wahl einfach im Lincoln-Schlafzimmer ans Bett ketten lässt, wie Mitarbeiter verlauten lassen, und sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen. Na, man wird sehen, wer dort künftig liegen wird.
Evan Osnos Joe Biden Ein Porträt SUHRKAMP
Meister der Dämmerung: Peter Handke
Handke und die Metamorphosen – Handke als Wanderer auf dem Weg – Handke als ständiger Wort-Verwandlungskünstler. Viele verschiedene AN-Sichten von und über Nobelpreisträger Peter Handke in diesem biographischen Buch von Malte Herwig:
Malte Herwig Meister der Dämmerung. Peter Handke. Eine Biographie. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe PANTHEON
Handke über sich selbst: Würde er seine Autobiographie schreiben, hieße sie: Betrachtungen meiner Irrtümer. Und was sind Handkes Irrtümer? Ach, drehen wir doch erst einmal den Spieß um. Die
Öffentlichkeit ist es, die etwas verwechselt. Handkes Worte – etwa zu Jugoslawien - sind seiner Auffassung nach keine politischen Statements, er begreift sie als Literatur. Und das versteht die
Öffentlichkeit wiederum nicht. Es ist halt auch so: Wer Publikum beschimpft, muss mit seiner „Rückhand“ rechnen.
Wenn Handke dichtet, schreibt, steigt er ins Bergwerk der Bilder und Sätze.
Was bewegt ihn, setzt ihn in Bewegung? Die Themen: Krieg, Nationalsozialismus, Slowenien, mit der Mutter gegen die Väter – ein leiblicher und ein anderer, genannt Stiefvater, mit dem er brieflich auf
die Entfernung kommuniziert. Das Vater-Sohn-Verhältnis für Handke „…eine Grundfrage der menschlichen Existenz“. Das alles beeinflusst sein Erzählen und noch vieles mehr.
Die Wirklichkeit wird durch sein Schreiben neu erschaffen. Sich findend, durch Erzählung und durch Wege, die zu gehen sind. „Eine glückliche Kindheit verbringe ich erst in der Erinnerung“. Er
fragt: „Mama, was ist ein Buchstabe?“
Handke hängt an Deutschland – sein Vater war Deutscher. Er liebt Slowenien und dessen Sprache. Dort ist er aufgewachsen. Österreich beansprucht ihn und will ihn aus Frankreich heimholen. Handke
empfindet das eher als Heimsuchung.
Handke liebt das Abseits, er liebt Schwellenorte, Peripherie, Randzonen der Großstädte. Deshalb lebt er im Vorort Chaville bei Paris.
Von Meinungen hält er nicht viel, sie haben für ihn eine tödliche Mechanik, denn Handke hat ein Ziel. Er stellt sich außerhalb des Bewusstseins, der Meinungen, der Vorstellung der anderen. Dort ist
der Ort, wo er leben will. Wenn er sich selbst beim Meinen ertappt, beginnt er den Kampf gegen sich selbst.
Handke ist Musterschüler, was sonst? Der Lehrer bescheinigt ihm, ein kluger Fragensteller zu sein und stellt ihm in Aussicht, mit 50 ein Nobelpreisträger zu sein. Na bitte, etwas später hat es ja
geklappt.
Das Schreiben ist für ihn nicht nur Begabung oder Intuition, sondern auch eine Sache des beharrlichen Willens.
Im Internat ist er vernichtet worden. Seine Erzieher sind die Autoren, die Bücher, schreibt Malte Herwig.
Die Menschenscheu wird er nie ganz verlieren. Die Lebensbeschreibung des Nobelpreisträgers geht so nach den Worten seines Biographen: Die Schriftstellerrolle macht es Handke möglich zu balancieren:
zwischen Einsamkeit und gesellig sein, zwischen Fanatismus und Gelassenheit, zwischen Kunst und Leben und ich würde hinzufügen zwischen Wirklichkeit und Literatur.
Handke hält es mit Kafka, denn dieser schreibt, um zu sein.
Schreiben ist Kampf mit sich selbst, die entscheidenden Ereignisse finden in der Innenwelt statt.
Der Beat der Zeit löst Handke die Zunge. Als Gymnasiast besucht er Bälle, geht leidenschaftlich gerne – auch später noch – ins Kino, wird zum „lonesome Cowboy“, sein Notizbuch dabei der Colt. Er
lernt italienisch sprechen und Klavier spielen.
Freunde bescheinigen Handke auf der einen Seite Schüchternheit, auf die andere „aggressive Verschmitztheit (Alfred Kolleritsch). Handke neigt zu Panikattacken und überreizten Nerven, notiert sein
Biograph. Schon das Rascheln von Zigarettenpapier kann ihn kribbelig machen.
Herwig lässt die Lebensstationen farbig und detailgenau Revue passieren, indem er nicht seine eigene Vorstellungskraft strapaziert, sondern seine Handke-Darstellung entlockt Erkenntnisse aus dem
Werk, aus der Literatur, aus den Sätzen, den Gedanken, den Geistesblitzen, aus den Gesprächen mit ihm und auch mit den Zeitzeugen und Freunden. Sein vertrautes Verhältnis zu seinem „Gegenstand“
strapaziert er nicht allzu oft. Sehr klug und überzeugend.
Handke bescheinigt bei dem berühmten Treffen der Gruppe 47 den dort versammelten Poeten „Beschreibungsimpotenz“, feiert mit „Publikumsbeschimpfung“ Theatertriumphe (Beschimpfen ist kein Spiel, es ist
die Wirklichkeit), wird in die Heldengalerie der Suhrkamp-Autoren aufgenommen. Der Pop-Poet liebt Beatles-Songs und Canned Head, besucht ein Rolling-Stones-Konzert, steht am Flipperautomaten und
bekommt als jüngster Preisträger den Büchner-Preis. Später gibt er ihn protesthalber zurück.
„Auf der Straße ging ich wie ausgesetzt.“
Angst ist sein Antrieb, die Panikattacken versetzen ihn in einen rauschhaften Zustand, seine Wahrnehmungsfähigkeit wird gesteigert. Er kann dann aber auch jähzornig, aufbrausend sein. Er braucht die
Einsamkeit und leidet zugleich an ihr. „Gehe Autor, und auch deine Geschichte geht weiter.“ Schreiben gleicht einem Luftholen. „Sitzt du an einem Buch?“, fragt sich der Tagebuchschreiber Handke.
„Nein, ich gehe.“
„Was ich zu sagen habe, steht in meinen Büchern“, schnauzt er journalistische Fragesteller an. „Von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen
hat.“
Journalisten „halt Gesindel“.
Handke lebt nach seinem Gesetz des Schreibens, das er über alle persönlichen Beziehungen und auch Konventionen der Gesellschaft stellt.
Der ehemalige Hanser-Verleger und langjährige Handke-Freund Michael Krüger diagnostiziert ein Lebensproblem: Handke möchte alleine sein, um seine Arbeit zu tun, braucht aber auch andere
Leute.
„Tausend Seiten Einsamkeit“, notiert Herwig.
Zugleich kann Handke Schriftstellerkollegen verbal vernichten, wenn er vollkommen ausrastet: „Hätte ich nicht meinen Fanatismus der Sprache, ich wäre auch ein Amokläufer geworden.“ Einen
FAZ-Journalisten verprügelt Handke.
Da holt sich nach Handke der eine Autor Details am Computer zusammen, um zu schreiben, der nächste formuliert „Scheißhausliteratur“, eine Nobelpreisträgerin ist „kunstgewerblich unterwegs“,
Geschwafel, Zeitungssätze, Handke kritisiert seine Kollegen durchaus mit Vernichtungswillen.
In seinem Haus in Chaville, südwestlich vor Paris gelegen, flickt er seine Hemden, sammelt er Pilze, wandert er im Wald, knackt Nüsse und kocht sich und anderen eine Pilzsuppe.
Die Texte zum Jugoslawienkrieg, seine Rede am Grab Slobodan Miloševićs, den Besuch bei Karadžić und die umfangreiche Diskussion dazu, auch wieder anlässlich der Verleihung des Nobelpreises lässt
Herwig nicht aus, Handke bedauert am Ende seine Interview-Äußerungen zu Srebrenica.
Handke befreit sich am „Pfahl des eigenen Ichs“ von quälender Unsicherheit, Reizbarkeit und Nervosität. Es ist wie eine Überlebensstrategie. Sein Schreiben ist kein Ausdruck von Persönlichkeit,
sondern Ausflucht von Persönlichkeit.
Malte Herwig gelingt auch mit den aktuellen Ergänzungen das intensive, tiefgehende, auch psychologische Porträt eines einzigartigen Literaten. Die familienhistorischen Hintergründe, die jungen
Entwicklungen eines Ausnahmeschülers, die rasante Karriere eines Pop-Poeten, die umstrittenen politischen Wirkungen des Autors, die Entwicklung zum Nobelpreisträger, das alles ergibt ein breites,
gelungenes, farbiges und tiefschürfendes Personen-Panorama. Das dramatische Werk Handkes kommt allerdings zu kurz. Dafür entschädigt die Schreibkunst des Biographen, der dem schwierigen Handke
emphatisch auf die Pelle rückt.
Der Anhang des Buches hat eine Zeittafel, eine Auswahlbibliographie ausführliche Bildnachweise, auch ist es reich mit privaten Schwarzweiß-Fotos illustriert. Leider fehlt ein Werkverzeichnis
Handkes.
„Der Kampf gegen mich selber ist der große Kampf“. Peter Handke
Malte Herwig, geboren 1972 in Kassel, studierte Literatur, Geschichte und Politik in Mainz, Harvard und Oxford, wo er 2002 mit einer Arbeit über Thomas Mann promovierte. Für sein Buch über Thomas Mann, Bildungsbürger auf Abwegen, erhielt er 2004 den erstmals gestifteten Thomas-Mann-Förderpreis. 2010 erschien Meister der Dämmerung, eine Biographie Peter Handkes. 2013 folgte Die Flakhelfer: Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden und 2015 Die Frau, die Nein sagt: Rebellin, Muse, Malerin - Françoise Gilot über ihr Leben mit und ohne Picasso. Malte Herwig lebt als Autor und Journalist in Hamburg.
Malte Herwig Meister der Dämmerung Peter Handke Eine
Biographie
(Aktualisierte und erweiterte Ausgabe PANTHEON 2020)
Pressestimmen
„Herwig weiß, den gewaltigen Stoff spannend zu bündeln, und formuliert glänzend“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
„In der nun vorliegenden aktualisierten Ausgabe seiner Handke-Biographie „Meister der Dämmerung“ zeichnet Malte Herwig erneut ein differenziertes Bild des Nobelpreisträgers, das weder ketzerisch ist, noch bloße Ehrerbietung. Es ist ein kluges Spiel der Fragen, zurückhaltend und von adäquater Sensibilität.“ (Welt kompakt)
ZITAT aus der Biographie
„When I think of all the good times that I’ve wasted having good times“ Eric Burdon
Hörfunkinterview Peter Handke hr 2 Doppelkopf
Kissinger - Wächter des Imperiums
Soll man ihn als politisches Genie einstufen, als genialen Karrieristen, als Weltenlenker, Visionär, Stratege, als Medien-Superman, der „Türöffner“ nach China war, Friedensstifter in Vietnam und Berater zahlreicher amerikanischer Präsidenten? Seine Markenzeichen Virtuosität, Brillianz und Kreativität, Charme, Witz und Zugewandtheit, „Henry, the Kraut“, the Womanizer und Partyboy, („Je größer die Krise, desto lang-beiniger die Frauen an Kissingers Seite“), der aus dem Hut zauberte, was jeweils gefragt war.
Oder soll man ihn unnahbar, kleinmütig, misstrauisch, unsicher, hinterhältig, ehr- und habsüchtig, als Chamäleon, Kriecher, schleimigen Höfling und Mann bezeichnen, „der lügt, wie andere Leute
atmen“? All diese Bezeichnungen zählt Biograph Greiner auf, und im Laufe des Buches wird immer deutlicher, was für ein Mann dieser Kissinger ist, einfach ein Machtmensch, und der - wie so oft bei
kleinen Männern - die Größe buchstäblich suchte.
Kissinger war ein US-Außenminister, der die Klaviatur der Machtausübung, der geheimen Diplomatie und des Kleinbeigebens bravourös beherrschte. Auf der einen Seite in der Politik, zu drohen, zu
erpressen, zu bombardieren, auf der anderen Seite den klugen berechnenden Diplomaten spielen, der auf internationalem Parkett die Konflikte aus der Welt schafft und zugleich attraktiver Partymensch
in der Damenwelt sein konnte.
Skrupellosigkeit war wohl eine seiner dominierenden Charaktereigenschaften. „Ein Irrer mit einer Handgranate in der Hand hat eine deutlich überlegene Verhandlungsposition.“ So war es nicht
verwunderlich, dass Kissinger begrenzte Atomkriege mittels taktischer Atomwaffen als Option in seinem theoretischen politischen Waffenarsenal für nötig und möglich hielt.
Kissinger, in Fürth geboren, emigrierte in die Vereinigten Staaten, Hitlers Naziterror hatte 30 Menschen aus Kissingers Verwandtschaft in den Tod geschickt.
Greiner schildert uns auch den Menschen Henry sehr facettenreich, der gerne in historischen Büchern schmökerte, in Harvard mit Ausdauer, Konzentration und Disziplin studierte, um in die Elitezirkel
aufzusteigen. Sein Motto: „Aber ein Anführer muss so handeln, als wären seine Ansprüche bereits Realität.“
Sein politisches Credo lebenslang: Die USA müssen wirtschaftlich und militärisch eine Übermacht darstellen, nur so bleibt die Welt im Gleichgewicht, Kriegsrisiken sind einzugehen, sonst werden die
Großen in der Welt zu aggressiv, Diplomatie dient nur dazu, die politischen Gewaltmittel wie politische oder militärische Erpressung feinzujustieren.
Entspannungspolitiker wie Brandt oder Bahr waren für den Weltdiplomaten politische Weicheier. „Wir müssen das [ein Berlin-Abkommen] vermasseln.“
„Mut zum Krieg ist nicht alles, aber ohne den Mut zum Krieg ist alles nichts.“ Auf Deutschland bezogen lautete dann sein Petitum: Totaler Krieg für Berlin? „Ja - als letztes Mittel, wenn die Freiheit
Berlins nicht anders zu verteidigen ist.“
Kennedy hielt Kissinger fern vom Oval Office, bei Nixon saß er auf dessen Schoß. Kissinger beherrschte die Kunst, die vielseitigen Angriffe gegen ihn erfolgreich abzuwehren, und zwar besonders dann,
wenn sie sehr berechtigt waren. Als Redenschreiber zu akademisch, als Berater auch die Seiten wechselnd, „Tricky Kissinger“ gab sich geschmeidig um der Karriere willen, er strebte skrupellos nach
Ämtern, wo es nur ging.
Er drangsalierte seine Miterbeiter, Brüllerei, Türen und Gegenstände schmeißen waren gang und gäbe, aber er lockte sie auch mit Theaterkarten, Blumensträußen und Überraschungen. Er wollte Ja-Sager um
sich herumhaben. Kontrahenten wurden ins Abseits gestellt: Sein Motto, andere erniedrigen, um sich selbst größer zu machen. Wie bei Trump verließen viele ihren Arbeitsplatz.
Der Vietnamkrieg, war das alles beherrschende Thema. Für Nixon wie Kissinger war klar: „…wir werden Nordvietnam wegputzen. […] Ich sag’ es noch einmal: Wir können den Krieg nicht verlieren ...Wir
werden den gottverdammten Norden bombardieren, wie er noch nie bombardiert worden ist. […] Lasst dieses Land in Flammen aufgehen. […] Es gibt keine Obergrenzen – abgesehen von Atomwaffen. […] Es gibt
keine Obergrenzen, das gibt es nicht mehr.“
In den 1970er Jahren besuchte Kissinger seine Geburtsstadt Fürth, ich hielt ihm als junger Reporter im Besucherkonvoi frech das Mikrofon vor die Nase und fragte nach dem Ausgang des Vietnamkrieges,
keine Antwort, eine Antwort auf die Frage, ob sein Lieblingsverein Spielvereinigung Fürth das letzte Spiel verloren hat, blieb er mir nicht schuldig. Zusatzfragen waren nicht möglich, seine
Sicherheitsleute rempelten mich außer Sichtweite und drängten mich ins Abseits. Eine gelbe Karte wäre es wert gewesen.
Die Vietnam-Diplomatie, die Nixon-Tonbänder, die kriminelle Einbruchspolitik „Watergate“, das alles ist nachzulesen in dem sehr genauen biographischen Opus Magnum von Bernd Greiner, dass sich trotz
des Volumens sehr spannend lesen lässt und viele Originalquellen zitiert.
Besonders spannend die deutschlandpolitischen Bezüge der Kissinger-Biographie, der Bahr für eine „hinterhältige Echse“ und Brandt für einen versoffenen „Trottel“ hielt.
Vor allem das Nixon-Kissinger-Verhältnis ist einfühlsam und belegstark interpretiert. Die Hintergründe des Watergate-Skandals werden minutiös ausgeleuchtet. Auch das „Leben danach“ von Henry
Kissinger findet eine ausreichende Würdigung. Der Memoirenschreiber, der Überall-Berater, der Pressekontakter, der Geldeintreiber und Witze- und Wortemacher, der Kontrollfreak, der
Bratwurstliebhaber, Fußballfan, Redenhalter. Das alles war Kissinger in einer Person.
Eine sehr faktenreiche, überzeugende, schonungslose Biographie, die man in zwei Zitaten aus dem Buch zusammenfassen kann, der private Mensch Kissinger war so: “Er könnte bei einer Dinner-Party direkt
am Notausgang sitzen“, so eine Journalistin, „und stünde dennoch im Mittelpunkt.“
Und der Politische: „Für die einen war er deshalb unwiderstehlich, für andere unausstehlich und für alle unvermeidlich.“
Bernd Greiner ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter des „Berliner Kollegs Kalter Krieg“. Er lehrte Außereuropäische Geschichte an der Universität Hamburg und leitete bis 2014 den Arbeitsbereich „Geschichte und Theorie der Gewalt“ am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Pressestimmen
"Es ist viel mehr als eine exzellente Biografie, es bietet eine Darstellung der Grundzüge und Idiotien amerikanischer Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, sinnfällig gemacht anhand des Gespanns
Nixon und Kissinger.“ Süddeutsche Zeitung, Franziska Augstein
Greiner, Bernd Henry Kissinger Wächter des Imperiums C.H. Beck
Ein neuer Blick auf Hitler
Brendan Simms, geboren 1967, ist Professor für die Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Europas und die Geschichte Deutschlands im europäischen Kontext. Daneben publiziert er in Zeitschriften und Zeitungen zu aktuellen europapolitischen Themen.
Anne Weber: „Annette, ein Heldenepos“
Gewiss, sie ist eine Heldin. Anne Beaumanoir hat ihr Leben in der Résistance aufs Spiel gesetzt. Sie hat während der deutschen Besetzung versteckten Juden Unterschlupf gewährt. Ihr Heldenmut ist in Yad Vashem beglaubigt. Später hat sie, die als Französin gegen die ihr Land besetzenden Deutschen gekämpft hat, nicht akzeptieren wollen, dass ihr eigenes Land Algerien besetzt und unterdrückt. Sie hat dem FLN in Frankreich verbotene, geheime Dienste geleistet.
Sie ist in Abwesenheit in ihrer Heimat dafür zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem unabhängig gewordenen, jungen Staat Algerien hat sie – inzwischen Neurobiologin und Ärztin – im noch nicht funktionierenden Gesundheitsministerium unschätzbare Leistungen erbracht. Ihr wurde von Ben Bella persönlich die algerische Staatsangehörigkeit übertragen, die sie neben ihrer französischen bis heute behält, obwohl sie nach Ben Bellas Sturz aus dem Land fliehen musste. Sie war Kommunistin. An der Richtigkeit von allem, was sie tat, hat sie gezweifelt, sich aber immer für die Seite entschieden, die ihr gerechter erschien. Sie lebt heute – sechsundneunzigjährig – in Südfrankreich. Dort ist ihr Anne Weber begegnet.
Die ist 1964 in Offenbach geboren und lebt seit vielen Jahren in Paris. Sie schreibt auf Deutsch und auf Französisch, war in Klagenfurt erfolgreich, übersetzt und hat wichtige Preise gewonnen. Aus
der Begegnung mit der greisen Heldin und Widerständlerin qua Natur hat sie ein bemerkenswertes Buch verfasst: „Annette, ein Heldinnen-Epos“. Der Lauf des immer gefährdeten, mutig sich keine
Bewährungsprobe entziehenden Lebens, wäre Stoff genug für einen dickleibigen Roman. Anne Weber hat ein besseres Format gewählt: Sie hat ein knappes Epos geschrieben, ein „Heldinnen-Epos“ eben – was
sonst. Das Epos, eine in erzählenden Versen verdichtete Biographie, ist genau die richtige Form der Hommage an eine Frau, die sich konsequent für das ihr richtig erscheinende entschieden hat. Die
Autorin nimmt sich – bei aller Empathie für ihre Annette Beaumanoir – zurück. Sie mischt sich nur gelegentlich in den Gang der Lebensgeschichte ein. Ganz wie in den antiken Epen. Sie relativiert dann
die Entscheidungen ihrer Heldin behutsam als „Allwissende“ und ex post ohnehin Schlauere. Aber sie lässt Annette ihre eigenen Zweifel, die sie ehren.
Für alles das gebietet Anne Weber über eine Sprache und über Stilmittel, die bezaubern, überzeugen und der Heldin dieses modernen Epos so gerecht werden, wie es Worte überhaupt können. Der ausnehmend
schöne Text steht in angemessenem Flattersatz, der die angedeutete Versstruktur des Ganzen unterstreicht, die immer mitschwingende Poesie einer ernsten und oft mörderischen Erzählung. Natürlich
ist das alles spannend, oft hochdramatisch, immer lebensgefährlich. Aber es ist nicht die langweilige Spannung sogenannter Spannungsliteratur, sondern die poetische Fassung eines ganz
außergewöhnlichen, heldenhaften und irgendwie auch beispielhaften Lebens.
Harald Loch
Anne Weber: „Annette, ein Heldenepos“
Matthes & Seitz, Berlin 2020 208 Seiten 22 Euro
Ein Freund, ein guter Freund
Der Deutsche tut sich schwer mit dem Leichten. Er liebt auch insgeheim den Schlager, doch im abendlichen Partygespräch sind es die Herren Mozart, Vivaldi, Beethoven, die als Lieblingskomponisten ungefragt herhalten müssen. Wer sein Leben dem Seichten und Leichten gewidmet hat, der wird gerne ganz schnell vergessen und in Deutschland mitnichten geschätzt.
„Ein Freund, ein guter Freund“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Das ist die Liebe der Matrosen“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“ oder „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ aus dem Musical May Fair Lady, das sind seine Erfolgslieder, und Gilberts Texte avancieren zu viel gesungenen Gassenhauern. Sein Melodientalent schafft es sogar bis zur regelmäßigen Erkennungsmelodie in die regionale Berliner Abendschau.
Heute ist das Operetten- und Schlagertalent völlig vergessen, doch Dank dem Verleger des CH. Links Verlags Christoph Links hat Christian Walther das vergessene Schicksal des erfolgreichen Lieddichters zwischen Schlager und Welt-Revolution wieder ans Tageslicht befördert.
Er verfasste engagierte politische Lyrik, und seine Arbeiterkampflieder werden zu sozialistischen Klassikern. Auch an der äußerst erfolgreichen Operette „Im weißen Rössl“ ist Gilbert beteiligt.
Vor den Nazis muss er flüchten, in den USA kennt ihn jedoch keiner, und seine deutsche musikalische Karriere interessiert dort wirklich niemanden. Als genauer Beobachter der Zeitläufte macht er in den frühen Fünfzigern in Deutschland mit Erich Kästner Kabarett. Die ZEIT nennt ihn so: „Ein sarkastischer Poet von scharfem politischen Wortwitz.“
In den frühen Jahren bewegt er sich in den jüdischen Künstlerkreisen der Berliner Künstlerkolonie.
„Mir ist innerlich, mir ist äußerlich heut so millionär zu Mut“, lautet ein Satz von ihm. Er war also ein Wortzauberer, dem die Substantive „… unter der federleichten Hand zu Adverben“ werden, wie der Autor schreibt, und der aber als Jude zum Judentum einen gewissen Abstand hielt.
Der SPIEGEL adelte ihn nach seinem Tode zum Klassiker der „Übersetzungskunst“. Für 40 Operetten und Revuen hat er Texte zugesteuert, Verse für 60 Tonfilme gedichtet, im Nachkriegsdeutschland avancierte er zum viel beschäftigten Musical-Übersetzer. Neben „My Fair Lady“ hat er auch „Hello Dolly“, „Oklahoma“ und „Cabaret“ nicht nur übersetzt, sondern nachgedichtet.
Das Buch druckt im Fließtext natürlich die Liedreime des Künstlers im Originaltext ab und es ist auch illustriert, schwarzweiß bebildert.
Robert Gilbert ein witziger, ein satirischer ein kritischer Mensch, dem wir Sätze verdanken wie: „Ein Freund bleibt immer ein Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt“.
Das Buch ist eine Lebens-Revue, farbig geschildert, gar nicht dissertationsartig verschleimt, es handelt sich nämlich ursprünglich um einen Promotionstext, ein farbiges Zeitenpanorama also, so frech und im Takt so temporeich wie ein Charleston.
Christian Walther Ein Freund, ein guter Freund. Robert Gilbert – Lieddichter zwischen schlager und Weltrevolution CH.Links Verlag
Beethoven - der Musik-Titan
Da, da, da, daaaa…Schicksals-Symphonie Nr. 5 c-Moll – Komponist Ludwig van Beethoven, von Christine Eichel in ihrem Buch DER EMPFINDSAME TITAN im SPIEGEL SEINER WICHTIGSTEN WERKE porträtiert, hat sich mit diesem musikalischen Motiv auf den Festplatten unserer musikalischen Hirne tief abgespeichert.
Die Welt als Wille und Musik, diese vom Philosophen Schopenhauers abgeleitete Überschrift ordnet den Komponisten und sein Werk pointiert ein mit dem Satz: „Es ist ein Überfall im Fortissimo. Vier Töne, eine große Terz, mehr braucht Beethoven nicht, um den markantesten Aufschlag der abendländischen Symphonik hinzulegen, Fanfarengleich, binnen weniger Sekunden erzeugt dieses knappe Motiv gespannteste Aufmerksamkeit.“
In diesem einzigen Satz ist die Kunstfertigkeit der Autorin gesetzt und bewiesen. Philosophie, Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft hat sie studiert, über Adorno promoviert, die Kultur-Ressorts von Cicero und Focus geleitet, erfolgreiche Sachbücher geschrieben, und dennoch hindern diese Karriere-Etappen sie nicht daran, treffend, packend, demonstrierend, illustrierend, erläuternd, wortverführerisch zu schreiben, dass man der Musik und Person Beethovens immer näherkommt, und noch näher.
Mit dem Wort Überfall wird klar, es handelt sich um gewalttätige Charakterzüge des polternden Komponisten. Sie beschreibt die musikalische Setzung mit Tönen und Terz als sportlichen Tennisaufschlag, als Auftakt, als gigantischer Beginn einer Symphonie. Fanfarengleich bringt uns in eine gespannte Startposition, da ist etwas zu erwarten. Die Zeitdimension kommt hinzu, das Motiv ist knapp, und sie verbindet damit sofort auch schon die Reaktion des Zuhörers am Schlusspunkt des Satzes. Wir geraten durch dieses Motiv in gespannteste Aufmerksamkeit.
Diese Vorgehensweise, dieses Beschreibungstalent fasziniert den Leser von der ersten bis zur letzten Seite, denn dieses Buch, zum Auftakt des Beethoven-Jahres bei Blessing im Verlagshaus RANDOMHOUSE erschienen, bringt Mensch und Werk dermaßen plastisch zueinander, so hierarchiefrei, als hätte Adorno diktiert: Liebe Autorin, schreibe musikdemokratisch, will heißen vergiss das Elitäre.
Schon im Prolog schildert Christine Eichel uns einen Klavierwettbewerb. Während in Paris die Revolution gefeiert wird, feiert der Wiener Hochadel mit Prunk und geziertem Gehabe sich selbst, wer braunes Bier konsumiert und Würstel hat, braucht nicht zu revoltieren, brummelt Beethoven, der Freiheitsliebende. Er geht beim Klavierwettbewerb als Sieger vom Platz, seine Gegner loben den am Klavier fantasierenden Beethoven: „In dem jungen Menschen steckt der Satan. Nie habe ich so spielen gehört! Er fantasiert auf ein von mir gegebenes Thema, wie ich selbst Mozart nie fantasieren gehört habe.“
Eichels Sätze treffen punktgenau, wenn sie Beethoven beschreibt: Schwierige Kindheit, rebellisches Künstlertum, provokatives Auftreten, Enfant terrible der Musikgeschichte, arbeitsbesessen, selbstzerstörerisch, eruptives Wesen, Launen, grob, unbeherrscht, die Tugend der Höflichkeit bleibt ihm fremd. Eichel fasst zusammen: „Heute fasziniert gerade das Unangepasste dieser Künstlerexistenz.“
Die NEUNTE, das Schlusskapitel im Buch, gespielt bei Stalins Ankündigung der Verfassung, am Ende des Sechstagekrieges in Tel Aviv, als Europahymne vielfach intoniert, bei der Wiedervereinigung aufgeführt, bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Japan weltweit inszeniert, ist eine musikalische Erfolgsstory. Die Ode des Schlusssatzes verheißt „… neben Freude und Freiheit vor allem das große Wir“. Die Autorin nennt die NEUNTE „die eigentliche Schicksalssymphonie der Deutschen“.
Ihr Buch, mit erzählerischer Lust am Schreiben komponiert, ist eine sehr gut gelungene symhonische Dichtung zum Auftakt des Beethoven-Jahres, so erregend melodiös und rhythmisch und gewaltig wie Beethovens Musik selbst.
Christine Eichel Der empfindsame Titan. Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke. (Blessing)
Interview
Homepage der Autorin
Radio
Kritik
»Ein Meisterwerk. [...] Sprachlich hinreißend, historisch spannend und bei aller Faktendichte dennoch höchst unterhaltsam, ist „Der empfindsame Titan“ ein gelungener literarischer Auftakt des Beethovenjahres.« ARD
Die Leonardo-Biographie bei CHBECK
Es wird immer seltener, „das schöne Buch“ in Händen zu halten. Kartonummantelte Schnell-Seller überschwemmen den Markt, Wegwerfbücher, die nicht den Weg ins ewige Bücherregal finden, haben sich beim Leser durchgesetzt, sie brauchen keinen Platz. Die electronic-Ware ist sowieso auf dem Vormarsch. Von den CLOUD-Büchern gar nicht erst zu reden. Da kommt vom CH-Beck-Verlag die Biographie von Volker Reinhardt über LEONARDO DA VINCI DAS AUGE DER WELT auf den Rezensenten-Tisch.
Was für ein Buch, was für ein haptisches Erlebnis, das Cover fokussiert auf einem da Vinci Porträt das Auge der „Dame mit dem Hermelin“. Die Goldlettern der Überschrift faszinieren. Der goldende
Umschlagkarton adelt den beschriebenen Allroundkünstler des letzten Jahrtausends. Die Bebilderung ist drucktechnisch grandios, gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.
Die technischen Zeichnungen Leonardo da Vincis sind groß genug abgedruckt, um die Einzelheiten mit dem Auge des Betrachters nachzuvollziehen.
Ein wirkliches Lese- und Blättervergnügen dieses Buches.
Zehntausende von Zeichnungen zeigen, was die Welt im Innersten zusammenhält und was menschliche Vorstellungskraft an Visionen hervorrufen kann, seien es nun Helikopter oder Unterseeboote, die
Innenseite der menschlichen Körper oder die Außenseite der Natur.
Apropos: Leonardo da Vinci war Außen-SEITER, der sah mit seinem Auge alles von einer anderen Seite als seine Zeitgenossen, auch als Anatom.
Er galt schon zu Lebzeiten und bei alten Biographen als Außenseiter, als Verächter aller Werte, Normen und Regeln. Auch seine Malerei brach radikal mit Traditionen und Konventionen seiner Zeit. Mit
neuen Maltechniken und Farben revolutionierte er die Malerei, kam jedoch zuweilen zeitlich mit der Lieferung verabredeter Werke ins Hintertreffen, wenn seine Schaffenskraft ihn selbst
überrundete.
Der Autor der Biographie verzichtet bewusst auf Hypothesen, Anekdoten und Stereotypen in der da-Vinci-biographischen Geschichtsschreibung. Volker Reinhardt zieht Textanalysen heran und finanzielle
Hintergründe, um auf eine Art archäologische Wahrheitsfindung der Ausnahmeperson Leonardo da Vinci näher zu kommen.
Ob Herkunft, Familie, frühe Prägungen, seine Zeit in Mailand, die späten Wanderjahre, die Schaffenszeit in Rom, die Suche Leonardos nach den Kräften der Natur, alle diese Buchkapitel ergeben ein
immer klareres Bild des Rätsels da Vinci.
Der üppige Buchanhang ist ausgezeichnet erarbeitet und fundiert mit einem gründlichen Verzeichnis der wichtigsten Gemälde versehen, eine Zeittafel und geographische Karte ist mit dabei, mit
umfangreichen Anmerkungen und Literaturangaben versehen, mit Nachweis der Bildzitate und einem ausführlichen Personenregister ergänzt.
Der Historiker zieht im Schlusskapitel ein wichtiges Fazit über die Abwertung der Wortkultur: Sprache als Ausdruck von Individualität und moralischer Qualität werde heutzutage abgewertet, ja sogar
der Lügenhaftigkeit verdächtigt.
Es zählt in diesen Zeiten mehr, was technisch machbar ist, trotzdem bleibt Leonardo da Vinci als Realität und Mysterium eine Quelle für Inspiration. Und dieses Buch wirkt durch Information ohne
Manipulation.
Das ganze Buch ist Buchstabe für Buchstabe, Bild für Bild, Zeichnung für Zeichnung ein Beweis dafür und zugleich Quelle für weitere Inspirationen.
Jana Revedin: „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“ Das Leben der Ise Frank
Hundert Jahre Bauhaus – Gelegenheit, an Ise Frank zu erinnern, die Frau des Bauhaus-Gründers Walter Gropius. In einem biografischen Roman setzt Jana Revedin ihr jetzt das Denkmal, das ihr in der Männerwelt der Architektur bisher verwehrt wurde. Die 1965 in Konstanz geborene Autorin ist selbst Architektin und hat sich auf die Reformarchitektur der Moderne in ihren theoretischen Werken spezialisiert.
Nachdem sie international studiert und schließlich an der Universität Venedig promoviert und habilitiert hat, ist sie heute ordentliche Professoren an Architekturhochschulen in Paris und Lyon. Entstanden ist ein im Wesentlichen auf das Bauhaus konzentriertes Lebensbild der ersten Frau, die die revolutionären Thesen des großen Reformarchitekten Bruno Taut in dem von ihr und ihrem Ehemann Walter Gropius konzipierten, leider nicht erhaltenen „Direktorenhauses“ in Dessau umsetzte.
Dabei gelingt es Jana Revedin, eine atmosphärische Geschichte des Bauhauses ihrem Publikum zu vermitteln, das die großen Namen zwar noch kennt, das Moderne, das interdisziplinär Neue der Ausbildungsstätte Bauhaus und auch seine Verstrickung mit der Geschichte der Weimarer Republik nicht mehr parat hat.
Ise Frank entstammte einer großbürgerlichen jüdischen Familie, zu der ein über mehrere Länder verzweigtes Netz von Banken gehörte. Sie war in einer Münchner Verlagsbuchhandlung und als
Literaturrezensentin tätig, als sie auf einer Veranstaltung in Hannover Walter Gropius kennenlernte, der bald um sie mit den Worten „Ich brauche Sie, Ise“ warb und den sie kurz danach heiratete. Sie
folgte ihm nach Weimar, wo bald die „Völkischen“ die Macht übernahmen und einen Umzug erforderlich machten. Inzwischen hatte Ise Frank die Geschicke des Bauhauses mit ihrem eigenen Leben so
verknüpft, dass sie bei ihrer Schulfreundin Gussi in Köln um eine Übersiedlung des für Weimar zu „linken“ Bauhauses an den Rhein anklopfte.
Gussi war die Ehefrau des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, der großzügige Bedingungen in Aussicht stellte. Aus Köln schrieb sie ihrem Walter Gropius: „Jeder nennt mich hier Frau Bauhaus“. Das Zitat hat den Titel des Buches ergeben. Aber das Bauhaus zog schließlich von Weimar nach Dessau um, wo Ise Frank die Öffentlichkeitsarbeit übernahm und das zentrale Kraftwerk der Einrichtung übernahm. Die Großen Künstler dieser Zeit machten alle am Bauhaus Halt und arbeiteten dort jahrelang: Paul Klee, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, László Mololy Nagy, Lyonel Feininger, Bruno Taut, Oskar Schlemmer oder Ludwig Mies van der Rohe. Mit ihnen lebte Ise Frank zwar nicht unter einem Dach, bewohnte mit ihnen aber doch eine geistig-künstlerische Ideengemeinschaft der demokratischen Moderne. Eng arbeitete sie mit ihrer Freundin, der Fotografin Irene Hecht, einer ungarischen Jüdin zusammen.
Die Autorin beschreibt Gebautes und auch steckengebliebene Projekte, wie das mit Erwin Piscator zur Panorama-Aufführung von Brechts „Trommeln in der Nacht“. Sie verschweigt auch heikle,
höchstpersönliche Situationen nicht, die in einer sich freiheitlich verstehenden Umgebung mit starken, eigensinnigen Persönlichkeiten nicht ausbleiben. Empathisch erzählt sie von der tot geborenen
Tochter Paula, bei deren Geburt auch die Mutter Ise Frank in Lebensgefahr geriet. Ihr Buch hat die Autorin ihrer ebenfalls tot geborenen eigenen Schwester Tanja gewidmet. Die objektiven Vorgänge
schildert sie historisch genau, die Dialoge, Gedanken und auch die inneren Monologe erfindet sie zwar dem Wortlaut nach – aber so oder so ähnlich wird wohl gesprochen und gedacht worden sein.
Dafür steht die umfassende Fachkenntnis der Autorin und ihr Einfühlungsvermögen in die Persönlichkeiten. Wunderbar, wie die sonst Fachpublikationen zur Architekturtheorie verfassende Autorin das belletristische Fach beherrscht. Sie schenkt ihrem Publikum ein Buch, das an eine fast vergessene, bedeutende Frau erinnert und in dem sie das prickelnde Flair des Bauhauses als Hoffnungsträger der modernen Architektur überzeugend literarisch einfängt.
Harald Loch
Jana Revedin: „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“
Das Leben der Ise Frank
DuMont, Köln 2018 Abbildungen 304 Seiten 22 Seiten
Alexander Kluy: George Grosz. König ohne Land
„Ein kleines Ja und ein großes Nein“ – immerhin! Dergestalt und gekonnt ambivalent überschreibt George Grosz „sein Leben von ihm selbst erzählt“ - der Untertitel deutet Distanz an. Das Buch ist unter seinem englischen Titel 1946 zuerst in den USA erschienen. Dorthin ist Grosz, seiner Verfolgung durch die Nazis zuvorkommend, schon 1933 ausgewandert. Eigentlich nur zum Sterben kehrt er 1959 in seine Heimatstadt Berlin zurück. Diesem herausragenden Künstler einer eigenen Moderne, von dem Kurt Tucholsky schrieb „Niemand hat das moderne Gesicht des Machthabenden so bis zum letzten Rotweinäderchen erfasst wie George Grosz“.
Über diesen schonungslosen Realisten hat Alexander Kluy eine detailreiche, einfühlsame und glänzend geschriebene Biografie verfasst. Sie erzählt das Leben dieses widerständigen Künstlers entlang seiner äußeren Stationen: Berlin, Hinterpommern, Dresden, Berlin, immer wieder Paris und auf der Flucht, dann ein Vierteljahrhundert Amerika. Im Detail entwickelt sich die Lebensgeschichte unter der Feder des schon durch seine Biografie über Joachim Ringelnatz ausgewiesenen Kulturpublizisten Kluy aber in erster Linie anhand des überreichen Werks des Künstlers. Der Verlag hat dem Buch einen schönen kleinen Bildteil spendiert, der allerdings nicht annähernd das Gesamtwerk von Zeichnungen, Skizzen, Gemälden und Collagen repräsentiert.
Schon als Kind kommt Georg Ehrenfried Groß, als der er 1893 mitten in Berlin geboren wird, mit dem preußischen Militär in Berührung. Als sein Vater – Georg ist gerade sieben Jahre alt – plötzlich
stirbt, nimmt seine Mutter eine Stellung als Köchin im Offizierskasino der Blücher-Husaren im pommerschen Stolp an. Zackige Hochnäsigkeit der Monokelträger, verlogene Vornehmheit der Uniformträger,
Herrenmenschentum und Machtanspruch dieser, das wilhelminische Preußen beherrschenden Gesellschaftsklasse prägen sich ihm tief ein. Er erkennt sie wieder, als der Erste Weltkrieg verloren ist, die
Novemberrevolution verspielt wird und Weimar keinen neuen Anfang findet. Er wird ein Linker, findet in der Kunstakademie in Dresden eine konventionelle Ausbildung, danach verständnisvollere Lehrer in
Berlin.
Er fängt an, seine zunächst in der gerade gegründeten KPD geschärfte politische Überzeugung künstlerisch umzusetzen, geißelt die Wirklichkeit, die er täglich als ein Seh-Mensch wahrnimmt, zu skizzieren, zu zeichnen. Er will diese Wirklichkeit verändern helfen. Seine Bilder sind schonungslos, finden zunehmend Anerkennung im linksliberalen Bürgertum, werden zur politischen Gegenpropaganda gegen den wiedererstarkten militaristischen Geist eingesetzt. Vom organisierten Kommunismus verabschiedet sich der sich nun George Grosz nennende Künstler, wird aber kein „Renegat“, will aber seine Unabhängigkeit, seine geschärfte Individualität als Künstler behalten, bleibt ein Linker.
Kluy verfolgt seine künstlerische Entwicklung über seine maßgebliche Beteiligung an DADA zu gezielten politischen Entwürfen, über Buchillustrationen und vor allem anhand der sich täglich füllenden
Skizzenblöcke, Steinbrüche für spätere ausführlichere Zeichnungen, zunehmend auch für Gemälde. Grosz wird bekannt, beliebt bei einem kleinen Teil, verhasst bei den Herrschenden. Er wird in Prozesse
verstrickt, in denen die Freiheit der Kunst in allen Instanzen zu verteidigen. Sein Biograf kann anhand der erhaltenen Tagebücher und Briefwechsel, aus denen er gut ausgewählt zitiert, die
Begegnungen mit den linken und halblinken Größen seiner Zeit nachvollziehen. Das zahllose Namen enthaltende, Grosz gewogene Who is Who der Weimarer Zeit beweist andererseits, wie dünn die Schicht
demokratischer Kreise der immer gefährdeten Republik eigentlich ist. Die Vernetzung ist auch zur Sicherung des Lebensunterhalts erforderlich. Der wird eigentlich immer prekär bleiben. In seiner
Ehefrau findet er eine solidarische Partnerin, die mit und an ihm leidet.
In den USA muss Grosz sich als Lehrer an einer privaten Kunstakademie verdingen, ehe er als Immigrant und Flüchtling vor den Nazis Anerkennung, Preise erringt und auch Verkäufe erzielt. Seine Inhalte
werden weniger politisch, sein realistischer Stil wird in einer vom abstrakten Expressionismus zunehmend beherrschten Kunstwelt nicht mehr gefragt. Zeitlebens hat kein Verständnis für die Arbeiten
eines Picass entwickelt. Er sieht bald nach dem Zweiten Weltkrieg keine künstlerische Zukunft mehr in Amerika und kommt 1959 in das Westberlin des Kalten Krieges zurück, wo er wenige Wochen später
auf wenig würdige Weise stirbt. Nicht weit von Ringelnatz entfernt wird er auf dem schönen Landschaftsfriedhof an der Heerstraße (!) beerdigt.
Harald Loch
Alexander Kluy: George Grosz. König ohne Land
DVA, München 2017 476 Seiten, farb. Bildteil 25 Euro
David Ben Gurion
Der 1945 in Jerusalem geborene israelische Historiker Tom Segev hat über David Ben Gurion eine materialreiche und kritische Biographie geschrieben, die von Ruth Achlama aus dem Hebräischen
übersetzt wurde. Das Buch leistet eine Annäherung an die schwierige Persönlichkeit Ben Gurions. Es ist eine immer interessante Erzählung der Vorgeschichte der Staatsgründung und der Entwicklung
Israels in den ersten Jahrzehnten seiner seither gefährdeten Existenz. Die Biographie führt in den Zionismus ein, den gedanklichen Motor für das Streben nach einem Staat Israel. Das Hauptverdienst
dieser Biographie liegt in der Darstellung der streitbaren Auseinandersetzung innerhalb des israelischen Führungskreises um den richtigen Weg, ein vernünftiges Maß, den Wunsch nach beidem:
militärischer Stärke und Frieden, um den Ausgleich zwischen religiösen und weltlichen Argumenten. Israel und seine führenden Politiker haben es sich nicht leicht gemacht hätten!
Tom Segev hält mit seiner gut begründeten kritischen Haltung zu Ben Gurion nicht zurück. Der war 1886 im seinerzeit zu Russland gehörenden polnischen Städtchen Płońsk geboren, lernte früh die Ideen
des Zionismus kennen und wanderte 1906 in dem Osmanischen Reich angehörende Palästina aus. Er entwickelte dort eine intensive Tätigkeit, um den Traum von einem Staat zu verwirklichen, in dem die
Juden nicht wie überall sonst in der Minderheit und von Verfolgungen bedroht wären. Er unternahm Reisen nach Saloniki und Istanbul, begann dort ein Jurastudium und gelangte während des Ersten
Weltkriegs in die USA, wo er seine Frau Paula kennenlernte, mit der er nach Kriegsende nach Palästina zurückkehrte. Das stand nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches unter einer vom Völkerbund
vergebenen britischen Mandatsverwaltung, mit der es ständig um Einwanderungsquoten für Juden aus Europa ging und die auch die Rechte der arabischen Bewohner Palästinas zu berücksichtigen hatte. Es
ging schon damals immer um Land und Leute und um Grenzen.
Während des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust erreichten Ben Gurion in Israel Nachrichten über ein angebliches Nazi-Angebot, viele Juden aus dem deutschen Machtbereich gegen hohe Zahlungen
freizulassen. Tom Segev wiederholt seine schon früher aufgestellte These, dass damals die Rettung eines Teils der europäischen Juden versäumt wurde. Wie realistisch diese Möglichkeit war, bleibt
offen. Jedenfalls scheiterten Geheimverhandlungen mit deutschen Stellen an der britischen Weigerung, hinter dem Rücken der Sowjetunion Separatgespräche mit dem gemeinsamen Feind zu führen. Das Gefühl
der Hilflosigkeit angesichts der Ermordung der europäischen Juden durch die Nazis belastete später auch die Annäherung zwischen der jungen Bundesrepublik und Israel, bei der es dann um erhebliche
Zahlungen Bonns an den Staat und um das ging, was man „Wiedergutmachung“ nannte.
Tom Segev erzählt anhand des Lebenslaufs von Ben Gurion von den vielen Einwanderungswellen nach Palästina und später nach Israel. Er berichtet über die Kriege, die Israel gegen seine Nachbarn führte,
über die Auseinandersetzungen innerhalb der Führung, wenn es zu israelischen Übergriffen gegen Palästinenser kam. Er erzählt von den Aktivitäten Ben Gurions auf der internationalen Bühne, von den
Wahlkämpfen in Israel, von Intrigen und Anfeindungen innerhalb der Regierung und der Knesseth, von den Bemühungen um Geldbeschaffung bis zu der Entwicklung des israelischen Atomprogramms, das als
Lebensversicherung für Israel angesehen wurde.
Die Biographie ist eine bestens dokumentierte, glänzend geschriebene große Erzählung über die Gründung Israels und seine ersten Jahrzehnte. In ihr begegnet der Leser den wichtigsten Namen der
israelischen Politik von Chaim Weizmann über Begin, Moshe Dayan, Golda Meir zu Schimon Peres. Wichtige internationalen Staatsmänner, hatte Ben Gurion persönlich kennengelernt: De Gaulle, Kennedy und
Adenauer. In jungen Jahren hat er Lenin in Moskau erlebt, später Churchill kurz vor dessen Tod. Beide hat er bewundert. Mit allen und vielen in Israel kreuzte Ben Gurion die Klingen, fand nicht nur
vorteilhafte Kompromisse, musste seine Mehrheiten in Israel immer wieder mit Rücktrittsdrohungen erzwingen und war später am Ende seiner lebenslang für den Staat Israel verausgabten Kräfte. Wenn es
ein Biograph schafft, neben der politischen Seite eines Mannes wie Ben Gurion auch seine nicht immer im vorteilhaften Licht erscheinende persönlich Seite dem Leser nahezubringen, ist das Kunststück
perfekt: Ein bleibendes Geschenk an das Publikum zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel.
Harald Loch
Tom Segev: David Ben Gurion. Ein Staat um jeden Preis
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Siedler, München 2018 800 Seiten 27 s/w Abb. 35 Euro
Beethoven - Der Schöpfer und sein Universum
Titel Martin Geck BEETHOVEN Der Schöpfer und sein Universum SIEDLER
Autor Martin Geck ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seine Bücher zur Musikgeschichte und seine Biographien großer Komponisten (u. a.
über Mozart und Schumann) wurden von der Kritik hoch gelobt und in ein Dutzend Sprachen übersetzt; für sein Buch über Johann Sebastian Bach wurde er mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Bei
Siedler erschienen zuletzt seine Biographien über Matthias Claudius und Richard Wagner.
Gestaltung 510 Seiten, Vorwort, 12 Kapitel, Epilog, Anmerkungen, Bibliographie, Werkregister, Personenregister und Bildnachweis. Den Kapiteln sind erläuternde
Bild-Konstellationen und Zitate vorangestellt, im Textteil auch erläuternde Noten-Beispiele
Cover Beethoven Kopf-Porträt mit grauer Wuschel-Mähne
Zitat „Bei aller Ausdehnung hat das Beethoven-Universum ein Zentrum, nämlich seine Werk“
Meinung Als ich vor Jahren das Beethoven-Museum in Bonn besucht habe und in keiner Ecke der Ausstellungsräume Musik des Genies ertönte, war ich verzweifelt ob der musealen Verantwortungslosigkeit. Das Museum zum Anfassen war längst auf der Welt, das Musik-Museum zum Mithören war noch nicht mal in den Geburtswehen. Als ich Martin Gecks einmalige Biographie über den „Schöpfer und sein Universum“ in die Hand nahm, erinnerte ich mich an die Begebenheit und es kam mir so vor, als wäre dieses detail- und kenntnisreiche Buch geradezu eine „Bastelanleitung“ für ein lebendiges tönendes Beethoven-Museum. Es hat nämlich eine Eigenart, wie biographische Bücher sonst ganz selten. Es hat eine eigene flüssige Handschrift, eine überzeugende Struktur und vor allem es gesellt sich zu der Person Beethovens eine Reihe von Zeitgenossen dazu, die Beethovens Werke quasi so nebenbei erläutern, illustrieren, klar machen.
Ja, Beethoven und Napoleon Bonaparte haben den „Titanismus“ gemeinsam wie auch Wilhelm Furtwängler. Diesen weiten Bogen schlägt der Autor im Beethoven-Universum, um seinem Werk ein unverwechselbares
Profil zu geben, „ …weil es um eine zutiefst menschliche Schöpfung geht – mit all ihren Höhenflügen und Verzagtheiten, Kampfesgesten und Friedensbotschaften.“
Napoleon ist für Beethoven die „Lichtgestalt“: „Im Bereich der Kunst will es Beethoven dem großen Bruder gleichtun.“ Furtwängler propagiert die “geistige Macht der deutschen Innerlichkeit“: „Durch
Niemanden wird Gewalt und Größe deutschen Empfindens und Wesens eindringlicher zum Ausdruck gebracht“.
Mit diesem biographischen Personen-Panorama kombiniert Geck Bach, Aldous Huxley und Glenn Gould, Rousseau, Bernstein und Tintoretto, Richard Wagner, Thomas Mann und Hans Eisler, er kontrastiert auch
die Komponisten, die im Schatten Beethovens komponieren: Schubert, Mendelssohn-Bartholdy und Franz Liszt. Fazit des Autors, der selbst ein geniales biographisches Konzept für dieses Buch
„komponierte“.
Zitat: “Die in seiner Zeit propagierte Selbstermächtigung des Menschen erlebte er nicht nur als wachsende Verfügungsgewalt des Komponisten über sein Material; vielmehr spiegeln seine Werke zum Ende
hin zunehmend den Prozess der Fragmentierung alles Gesellschaftlichen und das Sich-Fremd-Werden der Einzelnen. Doch das alles geschieht ohne Resignation. Leidenschaftlich und kämpferisch steht
Beethovens Musik für ein Glück ein, das es noch zu erringen gilt.“
Ein differenziertes, nicht immer leichtes aber erzählerisch fließend lesbares, großartiges Buch, eher für den Klassik- und Beethoven-Kenner als den Klassik-Zögling.
Leser Beethoven-Fans, Mozart-Fanatiker, Musik-Studierende, Dozenten und Biographie-Autoren
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/cluster/geck-beethoven-der-schoepfer-und-sein-universum/-/id=10748564/did=20472762/nid=10748564/z1vj81/index.html
PRESSE
»Martin Gecks neues Beethoven-Buch ist ein großer Wurf. (...) Womöglich ist das beste Buch zum anrollenden Beethoven-Jahr 2020 schon erschienen.« DIE ZEIT (23.11.2017)
»Dieses Buch [ist] ein "Must have" für jeden Beethoven-Interessierten und -Kenner.« BR Klassik (26.10.2017)
»Martin Gecks kluge neue Biografie nähert sich dem Komponisten abseits von Kult und Klischee.« Süddeutsche Zeitung, Beilage zur Frankfurter Buchmesse (10.10.2017)
»Auf jeden Fall ein absolut lesenswertes, spannendes, fundiertes und geistvolles Buch.« Deutschlandfunk Musikjournal (18.09.2017)
»Fantastisch geschrieben und für jedermann gut lesbar. (...) Ein großes Buch eines großen Musikwissenschaftlers.« SWR 2 Buchkritik (25.10.2017)
Briefwechsel Hannah Arendt
Hannah Arendt: Wie ich einmal ohne dich leben soll, mag ich mir nicht vorstellen - Briefwechsel mit fünf Freundinnen
Hannah Arendt war eine fleißige Korrespondentin. Ihre Briefwechsel mit ihrem Heidelberger Doktorvater Karl Jaspers, mit Martin Heidegger, ihrem Ehemann Heinrich Blücher, mit Walter Benjamin oder Uwe
Johnson sind längst veröffentlicht und von der Forschung intensiv rezipiert worden. Bislang war der Briefwechsel mit ihrer langjährigen Freundin Mary McCarthy als einziger mit einer weiblichen
Korrespondentin ediert5 worden. Die beiden Arendt Forscherinnen Ingeborg Nordemann und Ursula Ludz haben jetzt gleich fünf weitere Korrespondenzen mit Freundinnen herausgegeben und kenntnisreich
kommentiert. Für das gesamte umfassende Briefwerk der 1906 in Hannover geborenen, in Königsberg aufgewachsenen, vor den Nazis über Paris in die USA geflohenen und 1975 in Manhattan gestorbenen
Denkerin gilt, was die Herausgeberinnen in ihrem Vorwort schreiben: „Hannah Arendts hinterlassene Briefe mit Freunden und Freundinnen führen mitten in die Gedankenwelt der politischen Philosophin,
aber in ihrer unvoraussehbaren dialogischen Dynamik auch über sie hinaus.“ Wer waren die jetzt als Korrespondentinnen öffentlich herausgehobenen Frauen?
Anne Weil-Mendelsohn war Hannah Arendts „beste Freundin seit ich 14 Jahre alt bin“. Sie kannten sich als Schülerinnen aus Königsberg, studierten beide unabhängig voneinander Philosophie - Anne
Promovierte bei Ernst Cassirer – und näherten sich mit ihren Ehemännern in der Pariser Emigration wieder. Der Briefwechsel setzt wohl erst in den USA ein; erhalten sind nur die Briefe von Anne Weil.
Sie wurde nach dem Tod ihrer Freundin eine wichtige Quelle für die maßgebliche Arendt-Biografie von Young-Bruel. Leitmotiv der Freundschaft und der Korrespondenz blieb ein frühes Buchgeschenk Annes
an Hannah, ein Buch von und über Rahel Varnhagen.
Die Freundschaft mit der schon 1950 gestorbenen Hilde Fränkel dauerte nur wenige Jahre. Hannah Arendt sprach von einer „erotischen Genialität“ ihrer Freundin, von einer „Intimität“ und einem „Glück“,
das „umso größer ist, weil sie keine Intellektuelle“ sei. Die Korrespondenz führte oft über den Atlantik hinweg, wenn Hilde in New York blieb und Hannah auf Europareise war. Eine Postkarte aus einem
Heidelberger Gasthaus vom Dezember 1949 macht den Anfang. Im Februar 1950 schreibt Arendt an die Freundin: „Über Deutschland könnte man Bände schreiben…Die Nazis (genannt Mitläufer) ziehen gerade
jetzt wieder in alle ihre alten Stellen, gebärden sich dabei, als ob sie ein selbstverständliches Recht auf alle Stellen hätten. In Heidelberg sagte man mir gerade, dass man unter politisch
Verfolgten, für deren Rehabilitierung sich alle Welt einsetzt, nur noch Nazis versteht.“ Anlässlich eines Besuchs von Hannah bei Heidegger schreibt der ein kleines Gedicht „für die Freundin der
Freundin“…
Charlotte Beradt war die Dritte im Bunde einer nicht ganz aufgehenden „ménage trois“ zwischen ihr, Hannah Arendt und deren Ehemann Heinrich Blücher. Sie hatten sich Anfang der 1940er Jahre in New
York kennengelernt. Manche Irritation stellte sich im Laufe der Korrespondenz ein. Besonders drastisch, als sich Hannah Arendt bei ihrem Ehemann nach der Anrede „Liebster“ darüber beschwert, dass
er vergessen hatte, ihr in Genf zum Geburtstag zu gratulieren. „Dies habe ich die Absicht, Dir bis an unser seliges Ende unter die Nase zu reiben. Immerhin, falls Du es vergessen hast, ich bin
jetzt 50 Jahre.“ Und sie vergisst nicht, ihrem abgelenkten Ehemann nach New York zu schreiben, dass ihr „Jaspers, per Eilboten, damit es mich auch ja am Sonntag erreicht“, geschrieben hat.
Rose Feitelson war Freundin und Übersetzerin einiger Arbeiten von Hannah Arendt ins Englische. Sie war keine Emigrantin, sondern in New York geborene Jüdin, die erst durch die Bekanntschaft mit
Hannah Arendt in Kontakt zu einer außerjüdischen Lebenswelt kam. Ihr Briefwechsel zwischen 1952 und 1963 betrifft politische Inhalte, besonders zu Arendts Berichterstattung über den Jerusalemer
Eichmann-Prozess und deren Rezeption in den USA.
Schließlich Helene (Helen) Wolff, die überlebende Gattin des legendären Verlegers Kurt Wolff, dessen Werk sie nach dessen Tod fortsetzte. Hier geht es natürlich um verlegerische, editorische Fragen.
Die Korrespondenz wendet sich erst spät vom „Sie“ zum „Du“ und enthält aufschlussreiche Querverbindungen etwa zu Günter Grass oder Uwe Johnson. Es geht um die von Arendt aus einer freundschaftlichen
Distanz mitbetreute amerikanische Jaspers-Ausgabe sowie die englische Übersetzung wichtiger Texte Walter Benjamins. Ihrem Briefwechsel ist der Titel der gesamten Ausgabe dieser fünf Korrespondenzen
entnommen.
Für alle fünf Briefwechsel gilt das typische Arendt-Wort aus ihrem Denktagebuch: „Freundschaft ist eine eminent republikanische Tugend“!
Harald Loch
Hannah Arendt: Wie ich einmal ohne dich leben soll, mag ich mir nicht vorstellen - Briefwechsel mit den Freundinnen Charlotte Beradt, Rose Feitelson, Hilde Fränkel,
Anne Weil und Helen Wolff
Herausgegeben von Ingeborg Nordmann und Ursula Ludz
Piper, München 2017 678 Seiten 38 Euro
Patrice Gueniffey: Bonaparte 1769 – 1802
Bis zu seiner Heirat mit Josephine hieß er Buonaparte nach seinen italienischen Vorfahren auf Korsika. Danach schrieb er sich, inzwischen ganz Franzose geworden, Bonaparte. Als er 1804 zum Kaiser gekrönt wurde, nannte er sich Napoleon. Die Literatur über ihn ist unübersehbar. Jetzt gilt es eine neue Biografie anzuzeigen, die zwar nur bis zu seiner Ernennung und Wahl per Volksentscheid zum Ersten Konsul auf Lebenszeit im Jahre 1802 reicht. Sie beschreibt also die ganze Epoche der „grande armée“ bis zu Leipzig und Waterloo nicht mehr, erzählt aber den märchenhaften Aufstieg eines politischen und militärischen Genies in bisher nicht gelesener Deutlichkeit, Eleganz und ausgewogener Urteilskraft. Patrice Gueniffey hat sie verfasst.
Er ist Historiker an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales. Sein herausragendes Verdienst ist es, das spannungsreiche Verhältnis zwischen Bonaparte und den verschiedenen Etappen und Ausprägungen der Französischen Revolution in ein nachvollziehbares Urteil zu gießen. Mit dem von ihm angeführten Staatsstreich vom 18. Brumaire VIII des französischen Revolutionskalenders – also dem 9. November 1799 – endete die Französische Revolution, aber in den drei Jahren als Erster Konsul sicherte Bonaparte den Bestand ihrer „nachhaltigen“ Ergebnisse und überwand manche ihrer nicht haltbare Auswüchse. Er setzte den seine Macht erhaltenden Terror fort, veranlasste aber auch die zivilisatorische Großleistung des „code civil“ mit der Einführung von Zivilehe und Scheidung. Er blieb irgendwie den Grundideen der Revolution verbunden, war aber zugleich „postrevolutionär“. War er ein „aufgeklärter Despot“?
Der Weg dahin war dem in ein korsischen-nationalistisches Milieu Geborenen nicht in die Wiege gelegt. Er wurde auf französischen Militärschulen zum „Franzosen“ erzogen und legte mit seinen glänzenden
Feldzügen in Italien und – trotz seiner eigentlichen Niederlage – in Ägypten den Grundstein für seine Popularität und für seinen Machtanspruch in Paris. Sein Biograf erzählt die Geburt eines Genies,
oder auch die Entdeckung seines eigenen Genies durch Bonaparte in vielen interessanten Details.
Er verfügt über einen eleganten, stets im Dienste der Vermittlung von entscheidenden Tatsachen stehenden Stil. Das Übersetzerteam hat für die deutschen Leser hervorragende Arbeit geleistet. Die im Text immer wieder eingestreuten Zitate von Bonaparte selbst, von seinen Zeitgenossen aber auch von Historikern der Gegenwart vermitteln einen abwechslungsreichen Lesegenuss. Die vom Autor eingesetzte Urteilskraft entscheidet oft zu Gunsten des Bildes, das er von Bonaparte zeichnet. Seine Kritik setzt meist an dessen – seltenen – Fehlschlägen ein. Es ist eine eher machiavellistische Kritik, ohne dass Gueniffey den republikanisch-demokratischen Grundkonsens aufgibt.
Im persönlichen Bereich scheut der Biograf keine Details, obwohl sie nicht im Mittelpunkt stehen. Bonapartes Beziehung zu Frauen, vor allem zu seiner die Abwechslung liebenden Gattin Josephine
charakterisiert Gueniffey durchaus im Geiste der damals sehr freizügigen Zeit, nicht ohne den Anflug von Genuss. Aber er widmet sich viel stärker den politischen und auch den militärischen Details.
Seine genaue Beschreibung der einzelnen Etappen auf Bonapartes Aufstieg ist immer interessant. Sie zeugt von genauem Studium vor allem der umfangreichen Selbstzeugnisse des Aufsteigers und seiner
Umgebung und von einer Beobachtung der zeitgenössischen Presse. Ein Meisterstück ist das Kapitel über die kaum glaubliche, intensive Einflussnahme Bonapartes als Erster Konsul auf die Redaktion des
Code Civil, die er eigentlich einem auf Ausgleich gerichteten Monarchisten Portalis übertragen hatte, der die Vorleistungen des römischen Rechts einarbeitete.
Er selbst setzte dem epochalen Werk dann noch die „rote Mütze der Revolution“ auf. Das monumentale Werk von Patrice Gueniffey enthält viele solcher Glanzstücke, wird durch dekorative Bildtafeln, Landkartena und eine für weiterführende Studien hilfreiche, umfangreiche Bibliographie ergänzt. Das kostbare Buch ist mit großem Gewinn und noch dazu kurzweilig zu lesen.
Harald Loch
Patrice Gueniffey: Bonaparte 1769 – 1802
Aus dem Französischen von Barbara Heber-Schärer, Tobias
Marie NDiaye: Die Chefin. Roman einer Köchin
Auf die Perspektive kommt es an! Ein älter gewordener junger Mann erzählt von einer Künstlerin, von ihrer gelebten Philosophie der ehrlichen Einfachheit, von seiner ungewöhnlichen Liebe zu ihr, von seinen Enttäuschungen. Marie NDiaye wählt für ihren fabelhaften Roman „Die Chefin“ diese Perspektive. Der Erzähler ist befangen in seiner Subjektivität. Sein Bild von seiner Chefin ist verklärt und damit um so schöner. Nur er kann sie so ideal beschreiben, so literarisch beglaubigen, ihr Leben in und um Bordeaux so wirklich nacherleben lassen – der Einfall der Autorin ist genial. Die Chefin ist in einer einfachen und armen und kinderreichen Familie geboren. Ihre Eltern haben keine Ambitionen, wollen nicht aufsteigen, arbeiten hart und ermöglichen ihren Kindern, vor allem der späteren „Chefin“ einen glücklichen Anfang.
Als Sechzehnjährige geht sie in den Haushalt einer wohlhabenden Familie, in der sie in der Küche hilft und für die sie während eines Sommeraufenthalts in deren Ferienaus in den Landes am Atlantik plötzlich kochen soll und darf. Hier erwacht das Genie der Köchin, die sich später in Bordeaux selbständig machen, ein Restaurant eröffnen wird, das „La Bonne Heure“ und neben anderen einen jungen Koch einstellt, den Erzähler in diesem schönen Roman. „Die Chefin“ ist nicht „auf Plot“ geschrieben, fließt ohne aufgesetzte Spannung in einer eleganten Sprache dahin, die die kongeniale Übersetzung von Claudia Kalscheuer auch den deutschen Leser begeistern lässt. Das Werk ist klug, nie langweilig, es besticht durch eine dem Menschen zugewandte Poesie und ist von bewundernswerter Statik.
Der Erzähler lebt in der guten Mitte seines Lebens inzwischen in einem spanischen Rentnerparadies, in dem sich Wohlhabende zu gutem Essen und reichlichem Trinken bei nichtssagenden Gesprächen
treffen. Er erwartet hier den Besuch seiner Tochter, die er kaum kennt. Sie stammt aus einer längst aufgelösten Beziehung und hat bei ihrer Mutter in Kanada gelebt. Jetzt ist sie erwachsen. Wenn er
über sich selbst erzählt – die Passagen sind auch graphisch abgesetzt – schwingt ein gewisser Überdruss mit. Er erinnert sich an die Glanzzeiten des Restaurants „La Bonne Heure“ und eben an die
Chefin. Was er über sie weiß, hat er von ihr, was sie ihm in langen Gesprächen nach dem Abendservice in der Küche des Restaurants von sich erzählt hat. Den Rest hat er selbst recherchiert. Meist ohne
ihr Wissen. Aber was er den Lesern über sie erzählt, über ihr ungewöhnliches Wesen, ihre Einstellung zu den von ihr entwickelten Gerichten, zu den natürlichen Produkten, zu ihren Gästen, zu den
Menschen überhaupt, das weiß er aus eigenem Erleben. Er erzählt, wie er die doppelt so alte Chefin geliebt hat, von ihr allenfalls in einer Andeutung wahrgenommen. Er erzählt von ihrer Intelligenz,
die ihr kaum jemand zutraute, die ja nur mit Mühe lesen und schreiben konnte. Er erzählt von ihrer Würde von der nie in Frage gestellten Liebe zu ihrer Tochter, die sie mit dem Gärtner der ersten
Familie hatte, bei der sie kochen musste und durfte.
Diese Tochter wird dann der Chefin zum Verhängnis. Sie dominiert als junge Frau ihre Mutter und wirtschaftet mit nordamerikanischen Methoden das inzwischen mit einem vom Guide verliehenen Stern
ausgezeichnete Restaurant so weit herunter, dass es seine Gäste verliert und am Ende schließt. Das Verhältnis zwischen der Chefin und ihrer Tochter trübt das Glück des Lesers über das einfache, auch
philosophisch unterlegte Genie der Mutter. Der Erzähler wird kurz vor der Schließung des „La Bonne Heure“ entlassen und verliert seinen idealisierten Lebensinhalt. Wenn die Trauer des Erzählers und
auch des Lesers unerträglich wird, wendet sich das Blatt noch einmal zum Ende beglückend und überraschend. Nicht etwa ein wohlfeiles Happy End sondern ein schöner Schluss, unerwartet aber nach allem
Erzählten plausibel und richtig, beendet dieses Meisterwerk von Marie NDiaye. Ihren im Jahre 2009 mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman „Drei starke Frauen“ setzt sie mit „Die Chefin“
eindrucksvoll fort - große französische Literatur der seit einem Jahrzehnt auch in Berlin lebenden Autorin.
Harald Loch
Marie NDiaye: Die Chefin. Roman einer Köchin
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Suhrkamp, Berlin 2017 333 Seiten 22 Euro
LENIN - Ein Leben
Vor hundert Jahren veränderte er die Welt, teilte sie in zwei Entwürfe, stellte den halben Erdball auf den Kopf und „lebt“ bis heute – einbalsamiert in einem Mausoleum. Er wird verehrt von einem Volk, dessen heutiger Machthaber der Enkel des Kochs dieses asketischen Revolutionärs war. Wladimir Iljitsch Uljanow, der sich später Lenin nannte, ist als Politiker oft beschrieben worden. Er wusste mit seiner Schrift „Was tun?“, was notwendig war, er setzte sich gegen alle Widerstände durch und hatte keine Skrupel, die Theorie von Marx und Engels den praktischen Notwendigkeiten anzupassen. Er war ein Marxist des Sachzwangs und ein in der Praxis erfolgreicher Theoretiker der Revolution. Als solcher galt er der halben Welt als Vorbild. Sein Bekenntnis zum Terror als notwendiges Instrument zum Machterwerb und -erhalt forderte zahllose Opfer. Der von ihm als „zu grob“ nicht empfohlene, acht Jahre jüngere Nachfolger Stalin vervielfältigte diesen Terror. Nachahmer in weiten Teilen der Welt begingen millionenfache Verbrechen auch im angebeteten Namen Lenins. Was für ein Mansch war er und was hat er für ein Leben geführt?
Der 1956 in Budapest geborene britische Historiker Victor Sebestyen hat soeben eine Lebensbeschreibung vorgelegt, die einen persönlicheren Blick auf Lenin wirft als seine Bewunderer und seine
Richter. Der Gewinn dieser Perspektive ist durchaus ein historischer. Einerseits entsteht ein scharfes, keineswegs immer unsympathisches Porträt eines hochintelligenten Menschen, der bescheiden lebte
und einer eigenen sozialistischen Moral folgte, die von vielen seiner korrupten Mitstreiter und Nachfolger verraten wurde. Dieses Bild von Lenin wächst aus einem Panorama der Epoche hervor, das die
Zustände im zaristischen Russland, die beginnende Internationalisierung der sozialistischen Arbeiterbewegung und die revolutionären Zustände im Jahre 1917 bis zu Lenins Tod am 21. Dezember 1924
abbildet. Diese Fakten sind erforscht und vielfach beschrieben. Sie mit dem persönlichen Leben Lenins abzugleichen, sie aus zeitgenössischen Quellen authentisch zu zitieren, ist das Verdienst des
Autors.
Er hält sich mit eigenen Urteilen nicht zurück, die den Menschen Lenin nicht aus dem Blick verlieren. Er ist 1870 in der bürgerlichen Kleinstadt Simbirsk geboren wie sein späterer Widersacher Kerenski auch, der als Ministerpräsident der provisorischen Regierung von der Revolution gestürzt werden sollte. Der junge Wladimir war ein hervorragender Schüler, immer der beste, unauffällig in seinem Verhalten. Erst als sein älterer Bruder Alexander 1887 an seinem 21. Geburtstag wegen der Vorbereitung eines Attentats auf Zar Alexander III. gehängt wurde, politisierte sich Waldimir und radikalisierte sich im universitären Untergrund, so dass er bald verbannt wurde.
Dort, in Sibirien heiratete er Nadeshda Krupskaja, die sein Leben fortan als sozialistische Revolutionärin teilte. Als Externer schloss Wladimir als Jahrgangsbester das Jurastudium an der Petersburger Universität ab und war kurze Zeit als Rechtsanwalt tätig, musste aber bald und wiederholt ins Exil gehen. In den folgenden Jahren war in der Schweiz, in Paris, mehrmals auch Berlin, wo er 1895 im Deutschen Theater die zunächst von der Polizei verbotene Aufführung von Gerhart Hauptmanns „Die Weber“ sah, in Italien bei Maxim Gorki, mit dem ihm zeitlebens Freundschaft und politische Meinungsverschiedenheiten verbanden. Ein besonderes Kapitel widmet Sebestyen der legendären Fahrt im versiegelten Eisenbahnwaggon durch das Deutsche Reich nach Schweden. Mit höchster Billigung der Deutschen sollte Lenin nach Russland geschmuggelt werden, damit er dort die Revolution entfesseln sollte und danach einen Separatfrieden mit Deutschland schließen würde, das auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges dringend Entlastung von dem Zweifrontenkrieg suchte.
Überall lebte Lenin bescheiden, nahe am Prekariat. Er war menschlich zuverlässig, in politischen Fragen unnachgiebig und seiner Theorie folgend, dass nur absolut sichere Genossen die Gewähr für eine
erfolgreiche Revolution bilden könnten. Deshalb betrieb er in allen Vorläufer-Organisationen immer wieder Spaltungen, um die „reine Lehre“ – das wurde zunehmend ausschließlich seine Lehre –
durchzusetzen. Vor 100 Jahren, im Oktober 1917 hatte er damit Erfolg. Dieses Kapitel steht im Zentrum und auch am Anfang des im Übrigen chronologisch aufgebauten Buches. In ihm wird den in früheren
Veröffentlichungen oftmals im Schatten Lenins stehenden Frauen eine historische Aufwertung zuteil: Seiner Frau, der Krupskaja, die eine zuverlässige und unentbehrliche Mitarbeiterin war, seiner
Geliebten Inessa Armand, die auch zur Freundin seiner Frau wurde und die ihn auf einem wichtigen Kongress in Brüssel vertrat, seiner Mutter Maria Alexandrowna, die ihn immer wieder im Exil mit Geld
unterstützte. Die Feministin Alexandra Kollontai wurde unter ihm die erste Ministerin der Welt, später auch die erste Frau, die einen Botschafterposten bekleidete. Affären hatte er nicht. Die ménage
à trois mit der Krupskaja und Inessa hatte nichts Anstößiges an sich. Ganz anders als sein mörderischer Terror gegen die Kulaken, die Kronstadt-Matrosen und die orthodoxe Kirche nach der
erfolgreichen Revolution.
Das von Satz zu Satz spannend zu lesende Buch enthält einen informativen Anmerkungsapparat, eine internationale Bibliografie und zur Erleichterung des Lesers einen Anhang „Dramatis Personae“ mit
Kurzangaben zu den darin aufgeführten Personen. Die Prominentesten sind Stalin und Trotzki, der Geheimdienstgründer Felix Dscherschinski und Maxim Gorki.
Harald Loch
Victor Sebestyen: Lenin. Ein Leben
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz, Karin Schuler und Henning Thies
Rowohlt Berlin, 2017 704 Seiten 29,95 Euro
Albert Speer - eine deutsche Karriere
Die Richter in Nürnberg hätten es wissen können – sie ließen sich von einem vorgetäuschten Einverständnis mit dem umstrittenen Tribunal einwickeln. Eine Generation von Nachkriegshistorikern hätte es wissen können – wenn sie in die Quellen gesehen hätten. Die ganze, durchaus an dieser Personalie interessierte Welt ist von Albert Speer an der Nase herumgeführt worden, als hätte es den von ihm gespielten „Guten Nazi“ geben können. Er habe nichts gewusst von den Verbrechen der Nazis, er staune selbst darüber, dass er nichts gewusst habe, obwohl er es doch hätte wissen müssen. Über Jahrzehnte hielt sich dieses Bild des genialen Architekten und Rüstungsorganisators, der zum engsten Führungs- und Insiderkreis um Hitler gehörte. Am Ende habe er sogar die befohlene Selbstzerstörung der verbliebenen Rest-Industrie des niedergerungenen Nazireiches verhindert. Ein ich sich nicht einmal schlüssiges Lügengewebe hat gegenüber der seriösen „wissenschaftlichen“ Geschichtsschreibung und auch dem investigativen Journalismus über viele Jahre gehalten. Dabei hätte kein Staatsanwalt ihm sein unplausibles Märchen abgenommen.
Am Ende, eigentlich erst nach Speers Tod kam alles langsam heraus. Der 1964 geborene Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und Münchner Professor entlarvt
jetzt mit einem groß angelegten Werk die Lügengeschichten und prangert das Versagen von Wissenschaft und Journalismus in scharfen Tönen an. „Eine deutsche Karriere“ lautet der Untertitel des auf
intensivem Quellenstudium und zeitgeschichtlicher Forschung basierenden Buches.
Seine „Hauptangeklagten“ neben Speer selbst sind der Mitautor seiner Bücher und Speer-Biograf Joachim Fest und sein Verleger Wolf Jobst Siedler. Vor und nach ihnen plapperten alle den von Speer selbst vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal vorgegebenen Tenor nach. Das hatte Speer zu damals „milden“ 20 Jahren Freiheitsstrafe im Spandauer Kriegsverbrecher-Gefängnis verurteilt, die er bis auf den letzten Tag verbüßt hat. Begnadigungsinitiativen von deutschen Politikern von Globke bis Willy Brandt scheiterten sämtlich am Widerstand der Veto-berechtigten Sowjetunion. Aus dem Gefängnis heraus bereitete Speer sein Leben in Freiheit mit herausgeschmuggelten Kassibern vor, ließ bei namhaften Unterstützern mehrere Hunderttausend D-Mark auf einem sogenannten Schulgeldkonto für seine Frau und die sechs Kinder einsammeln und verpflichtete vor allem seinen ehemaligen leitenden Mitarbeiter Rudolf Wolters zu Stillschweigen.
Brechtken teilt sein stilistisch hervorragend durch das Leben Speers und die Zeitgeschichte führendes Buch in zwei Teile: Im ersten beschreibt er Speers Leben und Wirken bis 1945, im zweiten seine
Legenden und Lügen danach und die – unfreiwilligen – Helfer bei deren Verbreitung. Die wesentlichen Abweichungen von der Wirklichkeit sind so gravierend, dass ihm in Nürnberg wahrscheinlich auch die
Todesstrafe gedroht hätte.
Von der Verfolgung der Juden habe er nichts gewusst, hatte der auch als Nachfolger Hitlers gehandelte Speer wie ein Mantra wiederholt. Tatsache ist, dass er Tausende von „Judenwohnungen“ in Berlin „freimachen“ ließ, um Bombengeschädigte und auch Funktionäre, denen er sich verpflichtet fühlte, unterzubringen. Die entmieteten Juden kamen ausnahmslos in Konzentrationslager.
Bei der Erweiterung von Auschwitz arbeitete Speer intensiv mit Himmler zusammen – nicht nur beim Ausbau des Barackenlagers sondern auch bei dem Aufbau der umliegenden Betriebe, in denen die KZ-Häftlinge arbeiteten. Die unsägliche Posener Rede Himmlers hat er als Vorredner mit angehört und den verbrecherischen Aufruf zum Judenmord mitbekommen. Die in einem Stollen im Harz untergebrachte V2-Fabrik Dora Mittelbau hat er initiiert und besichtigt.
Andere Lügen erscheinen eher als „lässliche“ Sünden – so die frisierten Rüstungszahlen bis ins Jahr 1945 und die Mär von dem Aufbau der Neuen Reichskanzlei für Hitler in nur einem Jahr. Hitler hatte
aus Propagandazwecken diese „einmalige“ Leistung deutscher Ingenieure und Bauarbeiter erfunden und Speer hat sie zeitleben beibehalten. Diese Lüge diente Speer dazu, ihn als genialen Architekten und
Organisator darzustellen, der gar keinen Sinn für die politischen Zusammenhänge hatte. Und das alles ließen ihm, der seine oft in seinem Heidelberger Haus empfangenen Gesprächspartner ebenso wie die
Nürnberger Richter einzuwickeln vermochte, Wissenschaft und Öffentlichkeit über Jahrzehnte durchgehen. Zu den Getäuschten zählten auch in Opferkreisen anerkannte Persönlichkeiten wie Simon Wiesenthal
und Robert Kempner, die ihm gleichsam „Persilscheine“ ausstellten.
So nannte man die oft gefälligen Leumundszeugnisse in den Entnazifizierungsverfahren nach dem Kriege. Einem solchen musste sich Speer nie stellen, weil der Eröffnungsbeschluss ihm im Spandauer Gefängnis nie zugestellt wurde. So konnte auch sein Vermögen nicht in einem Sühneverfahren eingezogen werden, das er bis 1945 angehäuft hatte.
Nach seiner Freilassung kamen dann Honorare in Millionenhöhe für seine Buchveröffentlichungen und Nebenrechte in aller Welt hinzu. Jedenfalls ist Speer nie entnazifiziert worden. Brechtkens unendlich verdienstvolles Buch zeigt, dass Speer einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen der Nazis und die unsinnige Verlängerung des Krieges war und gibt ihm – endlich – keinen Pardon.
Harald Loch
Magnus Brechtken: Albert Speer. Eine deutsche Karriere
Siedler, München 2017 910 Seiten 40 Euro
Benjamin - der Unvollendete
Das Neue und das Immergleiche! Der 1892 in Berlin geborene Walter Benjamin interessierte sich zeitlebens für das Verhältnis zwischen beiden geschichtlichen Wundern. Es ist nicht die gleiche Differenz wie die zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen sondern die Grundspannung der geschichtlichen Zeit. In ihr lebte der deutsch-jüdische Philosoph, Schriftsteller und Kritiker nur bis zum 26.9.1940, als er sein Leben auf der Flucht in den Pyrenäen selbst beendete. Lorenz Jäger hat diesem „Leben eines Unvollendeten“, wie der Untertitel lautet, jetzt eine Biografie gewidmet, die auch andere Spannungen thematisiert: Benjamin wurde in eine assimilierte jüdische bürgerliche Familie geboren zu einer Zeit, da Assimilation und auch Bürgerlichkeit für ihn nicht mehr zur Debatte standen.
Mit Gershom Scholem früh befreundet, dem er – betrachtet man Benjamins Ende – leider nicht nach Israel folgte, diskutierte er Judentum ganz anders. Mit metaphysischen Ansätzen begann seine eher
„bürgerliche“ Philosophie, aus der er bald einen „Materialismus der Dinge“ entwickelte. Seinen Marxismus schulte er – dann schon im Pariser Exil – in Gesprächen mit Brecht. Die ihm eigentlich gemäße
politische Haltung eines Antistalinisten, ohne, wie Manès Sperber oder Arthur Koestler zum Häretiker zu werden, konnte er für sein Leben nicht mehr ausformulieren, weil er dazu keine Zeit mehr
hatte.
Wer die sehr konservativ-kritische Adorno-Biografie Jägers kennt, ist gespannt, wie er es mit Benjamin hält. Die Erwartungen werden nicht enttäuscht.
Benjamins marxistische Grundfärbung kann seinem Biografen nicht gefallen – er nennt ihn wiederholt einen Bolschewisten. Den politischen Irritationen eines von den Nazis verfolgten deutschen Juden, der im Sozialismus und in der damals in Moskau vorherrschenden Macht dieser Todfeinde des Faschismus Rettung sah, dann aber nach dem Hitler-Stalin-Pakt und an der Schwäche des Westens verzweifeln musste, kann Jäger nur in der Attitude des – ex post - allwissenden Antikommunisten begegnen. Andererseits schätzt er die literarische Dimension in Benjamins Arbeiten: „Wenn Adornos Idiom unverkennbar manieriert anmutet, wofür die leichte Parodierbarkeit ein Beweis ist, so schrieb Benjamin in seinen besten Momenten ein klassisches Deutsch eigener Prägung, das oft geradezu klingt, als habe er diese vollendete Diktion allererst erfunden“. Jäger bewundert das „absolute Gehör für Prosa“, das Benjamin herausbildete.
„Das Leben eines Unvollendeten“, ist keine klassische Biografie. Sie ist zwar im Großen und Ganzen chronologisch. Trifft Jäger aber beim Nachzeichnen des Lebenslaufs auf Personen, die für Benjamin
wichtig werden, flicht er kleine biografische Essays über sie ein. Das zeugt von Bildung und erzeugt Übersicht. Auf diese Weise begegnet der Leser Hannah Arendt, die in erster Ehe mit Benjamins
Cousin Günther Stern, später Günther Anders verheiratet war, Adorno und Kracauer, Brecht und Scholem, Franz Hessel, mit dem er Proust übersetzte und Hofmannsthal, seiner Cousine Gertrud Colmar und
der Frau seines Bruders, Hilde Benjamin. Hauptsächlich aber folgt die Struktur des Buches den Werken Benjamins. Jäger liest sie aus seiner entgegengesetzten Perspektive manchmal ohne rechtes Bemühen
um Verständnis. Oft aber ist gerade dieser kritische Blick notwendig und gewinnbringend. Sehr hübsch und spektakulär verschränkt Jäger Benjamins Auseinandersetzung mit Goethes „Wahlverwandtschaften“
mit dessen persönlichen Erlebnis der – wie man es in der Welt der Konzerne nennen würde - „Überkreuzverflechtung“ zweier Paare. An Widersprüchen ist das Leben Walter Benjamins reich genug, um seinem
routinierten Biografen Stoff für überraschende Momentaufnahmen zu bieten: Der letzte erhaltene Briefwechsel Benjamins, der nicht besonders ansehnlich war, aber auf Frauen anziehend wirken konnte,
dieser letzte Briefwechsel erfolgte mit einer Prostituierten. Und als er aus dem Leben geschieden war, fanden die spanischen Behörden bei ihm einen Brief an einen Dominikanermönch. Folglich wurde
dieser deutsche Jude mit einem katholischen Requiem ins Paradies verabschiedet. Insgesamt entsteht so ein wenn auch nicht liebevoll-empathisches aber doch voller Respekt und manchmal auch Bewunderung
gezeichnetes, sehr lebendiges und inhaltsreiches Porträt dieses immer wieder neu zu entdeckenden deutsch-jüdischen Denkers.
Harald Loch
Lorenz Jäger:
Walter Benjamin. Das Leben eines Unvollendeten
Rowohlt Berlin, 2017 398 Seiten, zahlr. Abb. 23,99 Euro
Der ROSEN-Kanzler aus dem Rheintal
Was gibt es Neues zu Konrad Adenauer? Es kommt darauf an, für wen. Die Älteren werden in der aktuellen Biografie des im vergangenen Jahr verstorbenen Publizisten und Filmemachers Werner Biermann den Aufstieg der jungen Bundesrepublik und ihre frühen Sünden nachlesen. Die Jüngeren werden staunen und versucht sein, Parallelen zu heute zu ziehen. In keiner der früheren Biografien stand etwas über das den Weltfrieden wahrende informelle agreement zwischen Kennedy und Chruschtschow über die amerikanische Duldung des Baus der Berliner Mauer. Der in filmischer Schnitttechnik geübte Biograf geht bis zu den Großeltern zurück, um die einfache Herkunft, Armut und Sparsamkeit und die nicht selbstverständliche Mischung aus katholischem Christentum und preußischem Pflichtbewusstsein gegenüber dem Staat schon aus den rheinischen Wurzeln zu erklären.
Manch strenge Seite in Adenauers Persönlichkeit wird dadurch verständlicher. Der Biograf versucht – manchmal fast zu auffällig – Licht und Schatten dieser Persönlichkeit und ihrer Politik ausgewogen darzustellen, als müsste sein Text das Nadelöhr des öffentlich-rechtlichen Rundfunks passieren. Trotzdem liest sich seine Biografie dank des eindrucksvollen Laufs des langen Lebens Adenauers und wegen des Verzichts auf publizistische Extravaganzen als ein Beispiel zeitgeschichtlicher Spannungsliteratur. Ein großer Bilderteil illustriert Leben und Politik und lässt den Leser an der wachsenden Familie Adenauers teilhaben. Er hatte mit seinen beiden früh verstorbenen Ehefrauen insgesamt sieben Kinder und eine wachsende Schar von Enkeln.
Die rheinische Kindheit und Jugend, Studium der Rechte, die Zeit des Referendariats und als Assessor sind durch Strenge und Sparsamkeit geprägt. Erst seine erste Ehe führt Adenauer in den Kreis der Wohlhabenden und Mächtigen Kölns ein. Damit beginnt sein bis dahin eher unwahrscheinlicher Aufstieg zum Oberbürgermeister von Köln. Seine persönlichen Beziehungen ermöglichten diese Karriere erst, der er sich dann aber vor allem in der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erstaunlich gewachsen zeigte. Schon als Beigeordneter erwarb er sich einen guten Ruf, erhielt Angebote auf das Bürgermeisteramt in Aachen, setzte aber auf Köln, der Stadt, der er mit personalpolitischer Strenge aber auch stadtplanerischer Weitsicht bleibende Impulse verlieh. Bemerkenswert war sein Erfolg auch beim damals noch möglichen Aushandeln der Beamtenbezüge, der ihn an die Spitze der Skala brachte.
In der Weimarer Zeit leitete er den Preußischen Staatsrat in Berlin, in dem die Regionen des riesigen Bundesstaates Preußen vertreten waren. Eine Reihe von Skandalen, auch wirtschaftliche Fehlspekulationen während der Weltwirtschaftskrise brachte er mit Hilfe wohlhabender Freunde nahezu unbemerkt hinter sich. 1932 eröffnete er die auf seine Initiative gebaute erste deutsche Autobahn zwischen Köln und Bonn, die kurz darauf von den Nazis „zurückgestuft“ wurde, um den Mythos von „Hitlers Autobahnen“ zu begründen. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Machthaber war die Absetzung Adenauers als Oberbürgermeister von Köln.
Während der Nazizeit versteckte sich Hitler zeitweilig in einem Kloster in der Eifel, weil ihm Gefahr drohte. Gegen Ende des Krieges wurde verhaftet, auf abenteuerliche Weise „befreit“ und in seinem neuerlichen Versteck dann verraten und fast bis zum Eintreffen der Alliierten erneut eingesperrt. Ein Kommunist rettete ihm damals das Leben. Am Widerstand gegen Hitler hat er sich nicht beteiligt, aber immer mit Verachtung auf das Regime geblickt. Als tatsächlich „Unbelasteter“ vertrauten ihm die Alliierten und bald war er wieder Oberbürgermeister. Die englische Besatzungsmacht setzte ihn dann zum zweiten Mal ab. Seine Nähe zu französischen Besatzungsstellen war den Briten wohl nicht genehm. Adenauer hatte aber ohnehin einen weiteren Horizont im Blick als den vom Kölner Dom aus.
Er wurde schnell wichtiger Funktionsträger in der neugegründeten CDU, zunächst im Rheinland, dann in der britischen Zone und alles lief nach der Gründung der Bundesrepublik auf ihn zu, der dann auch ihr erster Bundeskanzler wurde. Auf dem Wege dahin musste Adenauer innerparteiliche Konkurrenten ausstechen, wie den Ministerpräsidenten von NRW Arnold, dem er vorwarf, ein zu „sozialistisches“ Programm zu vertreten. Im Ahlener Programm der CDU von 1947 standen noch entsprechende Passagen. Kurt Schumacher, der ebenso antikommunistische Rivale von der SPD, unterlag.
Dann erzählt Biermann die Geschichte der jungen Bundesrepublik am roten Faden der Biografie Adenauers. Am Anfang das Wirtschaftswunder, das mit dem Namen Ludwig Erhards verbunden wird, den der spätere Adenauer nicht als Nachfolger verhindern konnte („Die CDU ist doch keine Wirtschaftspartei“), die Westbindung, das Zurückstellen der Frage der Wiedervereinigung, die Wiederbewaffnung und die Dynamisierung der Altersrenten, der Kalte Krieg mit Adenauers unverwüstlichem Antikommunismus, die Wiedererlangung der Souveränität, die diversen Berlin-Krisen, die Spiegel-Affäre, Mauer - das sind nur einige der Stichworte, die in dieser Biografie plastisch zu Leben erweckt werden. Auch der „Muff“: kurz nach dem Krieg war sich Adenauer sicher, dass kein ehemaliges NSDAP-Mitglied wieder in den Staatsdienst aufgenommen werden dürfte.
Ein paar Jahre später ging es offenbar nicht ohne, nicht einmal mehr ohne ehemalige SS-Angehörige. Aber auch der Versuch, durch „Wiedergutmachung“ die Verantwortung für die Verbrechen am jüdischen Volk wenigstens auf diese zu übernehmen.
Die Aussöhnung mit Frankreich war eine Herzensangelegenheit und die wiederholten Begegnungen mit De Gaulle nehmen einen vornehmen Platz in der Darstellung ein. Die deutsch-französische Freundschaft ist eines der bleibenden Elemente von Adenauers Politik und scheint sogar als „nationalistische Achse“ zwischen Marine le Pen und Frauke Petry auf der antieuropäischen Ebene eine unbeabsichtigte Fortsetzung gefunden zu haben. De Gaulles und Adenauers Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA und Großbritanniens erleben gerade eine Neuauflage. Als seriöser Biograf überlässt Biermann solche Gedanken aber dem auch nach über 600 Seiten „Adenauer“ keineswegs ermüdeten Leser.
Harald Loch
Werner Biermann:
Konrad Adenauer – Ein Jahrhundertleben
Rowohlt Berlin, 2017 656 Seiten zahlr. Fotos 29,95 Euro
Fallada - was nun?
André Uzulis: Fallada - Biografie
Zwischen allen Stühlen, zwischen Unterhaltung und Kunst, zwischen Vergessen und Neuentdeckung – Hans Fallada (1893 – 1947) ist die umfassende Biografie des Historikers und Journalisten André Uzulis gewidmet. Der Erfolgsautor des 1932 erschienenen Romans „Kleiner Mann – was nun?“ blieb auch mit seinen späteren Erfolgen „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ (1934) und „Wolf unter Wölfen“ (1937) auf der Überholspur in Zeiten, in denen andere Zeitgenossen das Land verlassen mussten.
Früher als andere hat er dann mit seinem erst vor wenigen Jahren in New York wieder aus der Vergessenheit gerissenen „Jeder stirbt für sich allein“ (1947) einen ersten antifaschistischen Roman in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geschrieben. Dazwischen gab es viel literarischen Leerlauf, Belangloses, Durchschnittliches. Das Leben dieses als Rudolf Ditzen in Greifswald geborenen Sohnes eines Reichsgerichtsrates verlief alles andere als geradlinig. Schon in seiner Jugend machte er mit einem inszenierten, halb gescheiterten, halb „erfolgreichen“ Doppelselbstmord eine traumatische Erfahrung. Sein „Nicht-zurechnungsfähig“ rette ihn vor dem Gefängnis und später auch vor dem Wehrdienst, bekam aber bald eine eigene Bedeutung: Alkohol und dann auch Morphium zerstörte ganze Lebensphasen des Rudolf Ditzen, der sich seit seinen ersten Veröffentlichungen Hans Fallada nannte.
Seine Familie hatte ihn beschworen, den Namen Ditzen nicht mit enthüllenden Geschichten zu beschädigen.
Die Biografie von Uzulis bildet das von Höhen und Abgründen gekennzeichnete Leben Falladas in einer gut recherchierten Offenheit ab. Sie ist weniger eine literaturgeschichtliche Werk- als eine leidensgeschichtliche Lebensbeschreibung des Autors, der seine besten Werke in rauschhafter Schreibekstase in kürzester Zeit niederschrieb und nach Fertigstellung eines Werks regelmäßig zusammenbrach. Er unterzog sich dann in Krankenhäusern und Sanatorien immer wieder Entzugsbehandlungen, die er unkritisch sich selbst gegenüber meist eigenverantwortlich abbrach. Oft war es Geldnot, die ihn wieder an den Schreibtisch zwang. Immer aber waren es die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, aus denen er seine Sujets und die Einzelheiten seiner Erzählung gewann. Der „kleine Mann“ war sein typischer Protagonist und den hatte er immer wieder kennengelernt.
In seinen Werken entstand ein Realismus dieses Milieus, das seine Leser wiedererkannten. Sie fühlten sich verstanden von ihm. „Kleiner Mann – was nun?“ liest sich wie eine Quelle über die Befindlichkeit weiter Bevölkerungskreise in den letzten Jahren der Weimarer Republik und „Jeder stirbt für sich allein“ als einmaliges Dokument des Alltagslebens von einfachen Leuten, die Gegner der Nazis waren.
Uzulis verschweigt das Lavieren Falladas während der Nazizeit nicht. Er war ein unpolitischer Autor, kein Intellektueller sondern ein mit allen menschlichen Schwächen gezeichneter, halbangepasster Zeitgenosse, kein Sympathisant der Nazis aber auch keiner, „der ihnen die Stirn“ bot, ängstlich, innerlich zerrüttet und seinen Sternstunden in der Lage große Werke zu schaffen. Die private Seite seines Lebens, seine beiden Ehen, von „Seitensprüngen“ überschattet, das Verhältnis zu der Familie, der er entstammte wie zu der, die er gründete, seine Gefängnisaufenthalte wie seine Freundschaften zu Ernst Rowohlt oder zu Johannes R. Becher, sein im Mecklenburgischen Carwitz entwickelter Gefallen an der Bienenzucht und seine hilflose, ihn völlig überfordernde Rolle als von der Sowjetischen Militäradministration eingesetzter Bürgermeister – alles erzählt sein Biograf spannend und mit kritischer Empathie.
Harald Loch
André Uzulis: Fallada - Biografie
Steffen Verlag, Berlin 2017 437 Seiten 26,95 Euro
Die "ausverkaufte" TRUMP-Show
Titel Michael D’Antonio Die Wahrheit über Donald Trump ECON
Autor Michael D'Antonio hat als Journalist u.a. für Newsday und das New York Times Magazine gearbeitet und wurde dafür mit dem Pulitzer-Peis ausgezeichnet.
Inhalt Ein Psycho-Porträt des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump
Gestaltung Sachbuch, Vorwort und Einleitung, 15 Kapitel, Nachwort, Danksagung, Anmerkungen, Bibliographie, 544 Seiten
Cover Einband Trump-Porträt, Hardcover in der Farbe GOLD
Zitat „Wenn jemand etwas gegen mich unternimmt, ist er für mich gestorben.“
Meinung Am 8. November wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Trumps Kampagne, von der einige meinen, sie sei schon zu Ende, beschreibt der Autor als ein Spektakel der Verfälschungen, bruchstückhaften Wortfetzen, emotional aufgeheizt, sie trotze der üblichen politischen Analyse.
Wie sagten Geheimdienstler dieser Tage: der kann es nicht und der darf es nicht werden. Sogar der lammfrohe deutsche Außenminister Frank Walter Steinmeier packt inzwischen die transatlantische Streitaxt aus.
Wie zeigt ihn der Autor? Trump ist ein Ängsteschürer, weckt Ängste vor den Terroristen, vor Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Globalisierung. Journalisten sind für ihn Abschaum, dem Autor verspricht er zwar sieben Interviews, nach fünf Meetings verweigert er aber die folgenden. („der totale Abschaum“ – Trump über Reporter) Der Autor lässt konsequenterweise kein Gegenlesen des Pressesprechers zu. Sehr ehrenhaft!
Trump kenne keine Ideale und nur den eigenen Machtwillen. Trump – ein Name für Erfolg, definiert durch Wohlstand und Luxus.
Schon Tocqueville, französischer Publizist, der als Gründer der vergleichenden Politikwissenschaft gilt und der 1835/ 1840 die Systemanalyse De la démocratie en Amérique schrieb, wusste, der Hintergedanke beim Amerikaner ist das Geld. In der 100 Millionen teuren Dienst-Boeing Trumps klicken vergoldete Sitzgurte zusammen.
Michael D’Antonio sieht in Trump eine Mischung aus Vulgarität, Reichtum und herzerfrischendem Hedonismus. Trump reklamiert Anerkennung, die ihm zustehe, aber, die man ihm nicht zolle.
Mit Immobilien-Geschäften und Glücksspiel-Casinos scheffelte er seine Millionen. Popstars und Hollywood-Größen kauften ihm die Luxus-Lounges ab.
Seine politische Rhetorik polarisiert. Der Begriff er wählt „deutliche Worte“ beschreibt diese Handlungsweise nur extrem verharmlosend.
Die Show – so Trump über Trump - heiße Trump und sei überall ausverkauft. Aber Konkurse von Firmen lastet er sich nicht selbst an und seine finanziellen Hintergründe will er nicht erhellen.
Trump schreibt erfolgreiche Erfolgsbücher über Erfolg. Seine Business-Universität entpuppt sich jedoch als besseres Coaching-Seminar. Kursgebühr 34 995 Dollar. Er setzt mit einem Rolling Stones-Konzert dennoch in seinem Casino 800 000 US-Dollar in den Wüstensand.
Trumps Haarpracht legendär. Eine „Leuchtreklame“! „Zuckerbäckerwerk auf seinem Haupt“. Er spielt die Rolle: jugendlich. Ein frauenfeindlicher Moneten-Macho, der gerne twittert, Verbalschläge austeilt, Menschen gegen sich aufbringt, aufmerksamkeitsversessen.
Das Buch-Fazit: Narzissmus als „Erfolgsstrategie“ in einer Gesellschaft, die Eigenwerbung wirklich nicht mehr schamhaft betrachtet.
Leser Alle Wähler in den USA und in Europa
Kissinger - Idealist oder Realist?
Der umstrittene Friedensnobelpreisträger war und ist Fan der Spielvereinigung Fürth. Henry zuvor also Heinz spielte selbst Halbrechts und Mittelfeld in dem Verein, der zweifacher deutscher Meister und viermal süddeutscher Pokalsieger wurde. Als Jugendlicher liebte Kissinger Ballspiele, Fahrradfahren und die Freizeit mit Freundinnen verbringen. Und später bekennt er in den USA zwar englische Sprachdefizite, doch er verfüge über ein großartiges Fußball-Vokabular. Die Ausgrenzung der Juden führte jedoch dazu, dass Heinz nicht mehr Fan und Spieler der Spielvereinigung sein durfte, Stadionbesuche waren für den Juden verboten. Kissinger versteht sich jedoch eher als Jude in ethnischer denn in religiöser Hinsicht. Die politische Verfolgung der jüdischen Familien während seiner Kindheit beherrschte – wie er sagt - nicht sein Leben.
1975 wird Kissinger in Fürth mit der Bürgermedaille geehrt. Als Reporter des Bayerischen Rundfunks bin ich dabei, das Mikrofon in meiner Hand streckt sich dem amerikanischen Außenminister entgegen, während er in großer Gruppe an mir vorbeirennt, vier bis fünf CIA-Bewacher laufen an der Seite Kissingers mit, ich rufe ihm zu, um ein Statement über Vietnam zu bekommen, als Ablenkungsfrage zuerst: „Mr.Kissinger, wo steht denn die Spielvereinigung Fürth in der Tabelle, er wusste es, als ich die Vietnamfrage stelle, rempeln mir die athletisch wirkenden Bodycops ihre Ellbogen in meinen Körper, ich gebe mich buchstäblich geschlagen und Kissinger wendet sich ab.
Henry Kissinger wurde im mittelfränkischen Fürth in der Mathildenstraße 23 geboren. Henry liest mit Vergnügen Dostojewski, doch seine mangelnden Fremdsprachenkenntnisse machen ihn schüchtern, der mitteleuropäische Akzent in den USA sogar verlegen, seine mathematischen Kenntnisse könnten ihn auf den Weg des Buchhalters bringen. Doch es kommt anders. Kollegen und Lehrer schreiben ihm analytische Präzision und psychologischen Scharfsinn zu. Im Zeugnis steht eine ZWEI in Geschichte. Kissinger verschlingt Bücher, er will begreifen, sich seiner selbst bewusst werden.
Schon Ende 1944 steht er wieder als Soldat auf deutschem Boden. Als CIC-Sergeant hat er die Aufgabe, ehemalige Wehrmachtsangehörige zu registrieren und führende Nazis zu verhaften Er kehrt zurück ins „Land der Ruinen und der Leichen“. 5,2 Millionen deutsche Soldaten und 2,4 Millionen deutsche Zivilisten wurden im II. Weltkrieg getötet.
Seine Handlungsdevise als Soldat im Nachkriegsdeutschland: „Sei gerecht in deiner Entscheidung, aber rücksichtslos bei ihrer Ausführung. Lass keine Gelegenheit aus, um in Wort und Tat die Kraft unserer Ideale zu beweisen.“ In einem Brief an seinen Vater, der ihn aufgefordert hatte, hart zu sein schreibt er diese Zeilen. Während sein Großvater an ihn appellierte “empfinde keine Hass auf alle Deutschen“.
Kissinger muss zwischen Tätern und passiven Zuschauern im Nazideutschland unterscheiden. Er übernimmt eine erste Lehrtätigkeit an der Geheimdienstschule in Oberammergau. Kissinger will seinen Teil zur politischen Umerziehung der Deutschen leisten. „Als ich zur Armee ging, war ich ein Flüchtling, und als ich sie verließ war ich ein Einwanderer.“
An der Harvard-University, an der er als ehemaliger Soldat das Freiticket fürs Studium bekommt, fällt Kissinger durch seine Abschlussarbeit auf - die zu allen Zeiten je textlängste in Harvard – so dass künftig Studenten angehalten werden, kürzer zu texten. Ferguson fällt gar auf, dass Kissinger Sartre falsch mit dem Namen Satre versieht. Sehr, sehr genau genommen…erwähnenswert in einer solchen Biographie? Müssen wir es so genau wissen? Beobachter sagen über den Harvardianer: er isst gerne und diskutiert, sie loben seinen unterhaltsamen Vortragsstil.
Drehen wir aber das Rad der Geschichte in die Nachkriegszeit. Im Frühjahr 1946 warnt der Karrierediplomat George F. Kennan vor dem internationalen Kommunismus als bösartigem Parasiten, der das erkrankte Gewebe befällt, Churchill warnt vor dem „eisernen Vorhang“ und Orwell schreibt im Observer vom KALTEN KRIEG gegen das britische Empire. Der KALTE KRIEG war ein KRIEG, schreibt Ferguson. Als Nicht-Militärfachmann sondern als Experte für Diplomatie-Geschichte hält Kissinger lokale, begrenzte Kriege für möglich und nötig, auch atomar geführt. Ostinitiativen, wie die Politik Brandts, waren für ihn ein Schreckgespenst.
Wer kein Risiko eingehen will, stellt den Sowjets einen Blankoscheck aus. Kissinger kritisiert die amerikanische außenpolitische Strategie, weil er Krieg wieder als verwendbares Instrument der Politik konzeptionell einführt: “Wenn uns die sowjetische Aggression einen Krieg aufzwingt, und wir dann nicht bereit sind, uns zu wehren, wird dies das Ende unserer Freiheit bedeuten.“
Ferguson stellt Kissinger als Wertkonservativen dar, der sich jedoch an Kant und nicht an Machiavelli orientiert. Er will westliche Werte durch das TUN herausstellen.
Verhandeln heißt für ihn die begrenzte Macht anzuerkennen und zu wissen, dass „Gewalt das letzte Mittel ist“. Man muss bei Verhandlungen das Drohende im Ungewissen lassen. Staatsmänner müssen das für richtig gehaltene am Möglichen messen. Seine Schlüsselerkenntnis: psychologische Faktoren sind wichtiger als militärische Kapazitäten. Konservativ sein, heißt nicht Revolutionen zu besiegen, sondern ihnen vorzubeugen.
Aber die politische Öffentlichkeit, kritische Journalisten, Alt68er und amerikanische Buchautoren werfen dem "Idealisten" Kissinger vor, sich in Militärputsche und menschenrechtsverletzende Diktaturen eingemischt, Invasionen gestartet und die Bombardierung des neutralen Kambodschas im Vietnamkrieg in Kauf genommen zu haben.
Die umfassende reich bebilderte Monumental-Biographie setzt dort einen Schlusspunkt, wo Kissinger 1968 als Nationaler Sicherheitsberater in die Regierung Nixon berufen wird.
Zehn Jahre hat Ferguson gebraucht, um den ersten Teil der Biographie zu schreiben. Kissinger selbst hat den Auftrag für sie an Ferguson gegeben, der zunächst zögerte, aber als Kissinger das private Archiv großzügig öffnete, war Ferguson „eingefangen“, er hat fleißig und mühsam, jedoch lohnend, das Material aus 111 Archiven gesichtet und sich unterschreiben lassen, dass Kissinger nachträglich keine Korrekturen anbringen darf.
Der voluminöse Umfang schreckt ab, fordert hartnäckiges Lesen, nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Buch. Ausführliche Zitate erhellen die Zusammenhänge zwar, bremsen jedoch an manchen Stellen den Lesefluss, wenngleich das Buch gut geschrieben und gut lesbar ist. Wir erleben die Lebens- und Frauen-Geschichten Kissingers mit, sein Da-und-dort-Zögern, seinen wissenschaftlichen und beraterpolitischen Aufstieg, sein konzeptionelles Denken, sein diplomatisches Geschick und auch Scheitern, kurzum den ganzen Kissinger, mit dem Ferguson lange Gespräche führte, der Kissinger zugeneigt ist, dennoch kritisch bleibt.
Wir lernen die Handelnden der amerikanischen Politik und ihre Berater aufs Intimste kennen - Kennedy kritisiert er, weil er zu viele Meinungen hat – wir lesen ein breites Geschichtspanorama, Koreakrieg, Berlin-Krise, Kuba-Krise, Vietnam, mit der einzigen Frage verbunden, wie man einen nicht zu gewinnenden Krieg beenden kann.
Für Ferguson ist die Geschichte Kissingers die Geschichte eines Bildungsprozesses durch Erfahrung: Die Erfahrungshorizonte sind die deutsche Tyrannei, der philosophische Idealismus, die Geschichte der Diplomatie, die politische Realität, das Machbare eben zu erkennen und die eigene Fehlbarkeit einzuschätzen. In jedem seiner Lehrjahre erkennt Kissinger etwas Neues über das Wesen der Außenpolitik.
Im Grunde geht es in der Politik wie Politikwissenschaft um die Kernfragen: Was ist Macht? Wie geht man mit ihr um? Wo liegen ihre Grenzen, und wann weiß man, dass sie überschritten sind?
Fergusons Fazit: „Am Ende kam die Macht zu Kissinger“.
Niall Ferguson Kissinger 1923-1068 Propyläen
Kracauer - eine Biographie
„Die Idee der klassenlosen Gesellschaft war in seinen Augen nur eine radikale Variante des Liberalismus“ – so interpretiert Jörg Später in seiner Biographie Siegfried Kracauers dessen Position. Was für ein linker Gegenentwurf zum Historischen Materialismus! Was für eine Herausforderung für einen Liberalismus, der die Klassengegensätze ins Unerträgliche verschärft! Entstanden ist diese Haltung Kracauers im Verlauf seines zunächst in Frankfurt, dann in Berlin blühenden intellektuellen Lebens, das 1933 durch Flucht, Exil und Auswanderung in die USA prekär unterbrochen und für eineinhalb Jahrzehnte von Hunger, Wohnungsnot und Beschäftigungslosigkeit unterbrochen und erst ab Mitte der 1950er Jahre zu neuer fruchtbarer Teilhabe als intellektuelle Instanz beiderseits des Atlantiks wahrgenommen wurde. Sein Biograf arbeitet als Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg.
Er organisiert sein materialreiches Buch entlang der Lebensbereiche Ökonomie, Psyche und Kommunikation. Er vollzieht die nicht immer schmerzfreien Erfahrungen Kracauers auf dem Markt von Wissenschaft, Publizistik und Kunst nach. Später widmet den lebensbedrohenden existenziellen Grenzerfahrungen auf der Flucht vor den Nazis, im französischen Exil und in den ihn aufnehmenden, aber ihn nicht nachhaltig beschäftigenden Vereinigten Staaten nach. Vor allem aber lässt Später seine Leser an der geradezu überbordenden intellektuellen Produktivität Kracauers teilnehmen, seine Entwicklung vom philosophierenden Soziologen, zum Theoretiker der Filmästhetik bis zu einem Historiker, der die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vergangenheit an den Erfahrungen der jeweiligen Gegenwart spiegelt. Das ist ein brillant geschriebenes intelligentes Vergnügen, so sehr die Empathie mit dem Lebenslauf Krakauers, seinem Leiden und der ihm durch die Verfolgung geraubten Schaffenszeit schmerzt.
Ein Glanzstück der Darstellung ist die Behandlung des „Philosophischen Quartetts“ in den späten 1920er Jahren. An dem Spieltisch hatten außer Kracauer noch der junge Theodor Wiesengrund, der sich später Adorno nennen sollte, Ernst Bloch und Walter Benjamin Platz genommen. Sie alle entwickelten auf je individuelle Weise doch eine sich ähnelnde Philosophie, in der es um die Wirklichkeit, also um eher soziologische Feststellungen ging. Kracauers Beitrag war sein aktuell gebliebenes Buch über „Die Angestellten“, in dem er die Anfälligkeit der Mittelklasse für gefährliche Ideologien erkannte und visionär beschrieb. Die vier bildeten so etwas wie eine „jüdische Peergroup“, in der das Jüdische so gute wie keine Rolle spielte, bis es sie zum Verlassen Deutschlands zwang. Im Jahr 1930 schickte die Frankfurter Zeitung den Feuilletonredakteur Kracauer nach Berlin. In der Reichshauptstadt tobten damals die politischen Kämpfe wie nirgendwo sonst, und er berichtete für die Zeitung von dem spannenden kulturellen Leben. Mit der Machtübernahme durch die Nazis war das alles vorbei und es schloss sich das prekäre Leben im Pariser Exil, später nervenaufreibenden Marseiller Wartestand, dann das Leben in New York an, wo die inzwischen verheirateten Kracauers von mildtätig vergebenen Projektaufträgen von der Hand in den Mund, praktisch ohne eigene Wohnung leben mussten.
Unter solchen Bedingungen, die sich erst allmählich besserten, entstand zunächst die psychologische Geschichte des deutschen Films „Von Caligari zu Hitler“. Später eine unpolitischere „Theorie des Films“. Das Spätwerk, in dem sich Kracauer zu dem Historiker entwickelte, der aus einer Zusammenschau der Mikro- und Makrogeschichte wie in der Filmästhetik zwischen Großaufnahme und der Totalen eine heute modern erscheinende Historiografie ableitete. Ihn interessierten als Historiker wie als Philosophen die Räume zwischen der Wirklichkeit und der Theorie, „die Dinge vor den letzten Dingen.“ Diese ganze Entwicklung eines der bedeutendsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts lässt sein Biograph in einer oft im Dialog mit den anderen „Leuchttüren“ der Zeit zu erlebenden Geistesgeschichte der Epoche lebendig entstehen. Als Kracauer am 26. November 1966 in New York starb, rief ihm Adorno seine Sicht dieser großen Persönlichkeit nach: „Ein wunderlicher Realist“.
Harald Loch
Jörg Später: Siegfried Kracauer. Eine Biographie
Suhrkamp, Berlin 2016 744 Seiten 39,95 Euro
Die "schwarze" Patricia
- eine Rezension in Leseschritten
Die talentierte Miss Highsmith
Diogenes
2 Schon auf Seite 14/25 die erste Überraschung: Patricia Highsmith wird von der Autorin ständig mit dem Vornamen PAT angesprochen, der Plot ihres Lebens soll aus ständigen Wiederholungen bestanden haben. Und die Biographie, die Joan Schenkar schreibt, geht nicht chronologisch vor, Pats Leben war keine geradlinige Strecke vielmehr ein exzentrisches „Auf und Ab“ und „Hin und Her“ und Patricia Highsmith trank nicht gerade wenig Alkohol – eine Überraschung nach der anderen.
3 Was ist der Antrieb dieser „dunklen Frau“? „Obsessionen sind das Einzige, was zählt“ ... „Am meisten interessiert mich die Perversion, sie ist die Dunkelheit, die mich leitet“. Das ist natürlich der Stoff, aus dem die Krimis sind. Aber wie passt dazu, dass die Highsmith jahrelang für Comicverlage schrieb? Ihr tägliches Schreibpensum waren acht Seiten Text, ihr „Verbrauchspensum“ an menschlichen Beziehungen schier unübersehbar. Pat liebte Frauen zuallererst und auch Männer, aber nur probehalber. Ihre lesbischen Beziehungen, sexuelle Kurzabenteuer oder auch einige längere Beziehungen verbarg sie so gut oder schlecht es eben ging vor der Öffentlichkeit, jedoch nicht in ihren Romanen.
4 Was ist die Intention der Autorin? Sie startet den Versuch, den „ständigen Wechsel der Identitäten zu fassen“. Diese Biographie folgt einem eigenen Muster: den Obsessionen und den Schaffensperioden der Highsmith, nicht der Lebens-Chronologie. Ihre Quellen, nahestehende Personen, werden zuweilen anonymisiert. Der Spannungsbogen, den die Highsmith in ihren Romanen wählt, die Story entweder langsam oder mit einem Bigbang zu beginnen, ist auch das Leitmotiv für die Biographin.
Die Vorgehensweise ist chirurgisch-präzise, also sehr genau, weil Tagebücher, Aufzeichnungen und „Cahiers“ (Hefte) der Patricia Highsmith zur Verfügung standen, und somit ihr Leben minutiös bis in die letzten Details und Verwinkelungen beschrieben werden kann. Das ist manchmal mühsam und sehr ausführlich, aber zugleich ebenso faszinierend, weil sozusagen ein genauer Röntgenblick entsteht, eine Situation für den Leser, als liege die Highsmith vor einem in der CT-Röhre. Wie sagt die Krimimeisterin über sich selbst: “Details über sein Privatleben preiszugeben ist für einen Schriftsteller, als würde er sich nackt in der Öffentlichkeit zeigen.“
5 Grimmige Individualität, sperrige-bizarre Originalität, eine Frau, die mit einer obsessiven Leidenschaft Listen erstellt, sie sammelt gehamstertes Briefpapier, hortet stapelweise Zettel, tippt ihre Romane, zweidreimal ab. Ständige Umzüge, vagabundieren zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, Alabasterhaut, Mandelaugen, Liebesaffären, Alkoholmissbrauch, Verführung verheirateter Frauen, und ein hohes literarisches Ziel, so kommt uns Patricia Highsmith auf den ersten Seiten der Biographie entgegen. ...“Stümper gibt es auf allen literarischen Gebieten euer Ziel muss sein, ein Genie zu sein.“
6 Wie sieht die Biographin das Werk – die Werke der Highsmith?
Sechs bis sieben Romane ein Dutzend Shortstories hält sie für mit nichts in Raum und Zeit vergleichbar, sie seien eigenartig, zwanghaft, originell, phantastisch, die Bücher seien
gattungsübergreifend, die Geschlechterrollen in Frage stellend, beschäftigten sich mit der Anatomie der Schuld, die Autorin habe zwar nicht selbst Kunst im Schreiben Kunst angestrebt, aber ihre Werke
seien durch Kunst inspiriert. Originalton Highsmith: „Ich finde, dass meine Bücher in Gefängnisbüchereien nichts zu suchen haben.“
7 Wer ist diese Frau, die auf Müllhalden ausgefallene Gegenstände für ihr Haus sucht, die an ihrem Busen ihre Lieblingshaustiere, nämlich Schnecken, verbotenerweise nach Frankreich importiert, die Juden, Schwarze, Latinos und Indianer nicht gerade liebt, die psychologisch zwischen Angezogen- und Abgestoßen sein, Selbsthass und Selbstüberhebung schwankt und die von sich selbst sagt: „Ich vergöttere Frauen ... “Auch wenn ich mir keine Dominanz ohne Liebe und keine Liebe ohne Dominanz vorstellen kann.“ Die Highsmith, eben Mrs. Mystery...
8 Was ist das charakteristische in Ihrem Werk? Erste Annäherungsschritte: Eine große Kälte steht im Zentrum ihrer Werke, in dem die „Anwesenheit der Abwesenheit von Schuld herrscht“. Verkleidung, Imitation, Verwandlung, Fälschung, Identitätsdiebstahl bestimmen die Verbrechensmotive, sie selbst versucht durch Rituale ihre Ängste zu bezwingen, leidet an einem Waschzwang, ersetzt im späten Leben ihre Gefühle durch Gegenstände, und betreibt einen Listen-Fetischismus, nummeriert ihre Wünsche und Begierden. Bei Sexszenen schaut sie weg, bei Gewaltszenen hin. Angst bestimmt ihr zweites Ich. Die Requisiten ihres unsteten Lebens, die sie ständig bei sich hat: ein Notizbuch, ein Füller, eine brennende Zigarette, eine Flasche (Martini, Whiskey, Bier) und jede Menge düstere Phantasien: „Ich kann mir für die Phantasie Nichts Stimulierenderes und Beflügelnderes vorstellen, als die Annahme, dass jeder, der einem auf dem Gehweg entgegenkommt, ein Sadist, ein Seriendieb oder sogar ein Mörder sein könnte.“
9
Die Grundlage für einen Roman ist die Verlorenheit eines Individuums in diesem Jahrhundert, das nicht in dieses Jahrhundert passt, schreibt die Biographin Joan Schenkar über die talentierte Mrs. Highsmith. Für sie hat das Leben keinen Sinn ohne ein Verbrechen. Ihr Schreibmotiv ist nicht die Verliebtheit in Worte, sondern das Tagträumen um Tagträumens willen. Sie schreibt nachts, denn dann erlahmen ihre nagenden Selbstzweifel. Alle wussten, dass sie Alkoholikerin war. Aber man sah sich verdammt vor, sie darauf anzusprechen, schreibt die Biographin. Pats selbsterklärende Argumente:“ Ein Künstler wird immer trinken.“
Sie liebt junge Mädchen und Lesbenbars, schläft ab und zu auch mit Männern, hat den Drang, ihre Gefühle in einer männlichen Figur zu verkörpern. Sie fühlt sich als lebendiges Beispiel für einen Jungen im Körper eines Mädchens. Sie ist, meint die Autorin, Expertin für sadomasochistische Beziehungen. („Shades of Pat“) Sie schwankt zwischen Alleinsein und Beziehungen, überlegt sich radikale Änderungen zum Männlichen oder Weiblichen hin. Sie lebt den Widerspruch und ist der Widerspruch: „Es gibt nichts, was ich nicht tun würde. Mord, Zerstörung, anstößige Sexpraktiken. Aber ich würde trotzdem meine Bibel lesen.“
10 Selbstreflexionen: Ihr Selbstbewusstsein hat eine Lebensdauer von nicht mehr als vierundzwanzig Stunden. In der Beat- und Pop-Ära scheint sie wie aus der Zeit gefallen. Die Highsmith, eine Frau der Absonderlichkeiten, sie sammelt 300 Schnecken in Glasterrarien, entwickelt erfinderische Ideen, zum Beispiel eine Galerie für schlechte Kunst, ein Schwitzthermometer, seltsame Lampenschirme und ein eigenartiges Mordwerkzeug, einen mit Strychnin versetzten Lippenstift. Sie schreib Liebesszenen zwischen sich paarenden Schnecken, lässt Journalisten und Gäste bei sich zuhause hungern statt sie gastlich zu bewirten. Bei den einen weckt sie Hass, bei den anderen tiefe Zuneigung.
Das Fazit der fleißigen Biographin Joan Schenkar, die Highsmith hatte Stalker-Neigungen, mit einem Drang zur Geheimniskrämerei. Dabei spielte sie mit falschen Identitäten. In den Verbrechen, die sie als Schriftstellerin begeht, geht es ihr um das „unbestrafte Davonkommen“.
Am Ende ihres Lebens stellen die Ärzte Karzinome in Lunge und Nebenniere fest. Dioe Highsmith denkt über ihre Grabinschrift nach und meint: “Hier ruht jemand, der seine Chance stets vergab.“
Fazit der Biographin, die ein unglaublich detailliertes, in viele Einzelheiten verzweigtes und manchmal auch sich wiederholendes Lebens-Panorama geschrieben hat: Patricia Highsmith schrieb fünf oder sechs der verstörendsten Romane des 20. Jahrhunderts. Die Frau mit der Schreibmaschine („Olympia“) philosophiert an einem Sylvestertag über das kommende Jahr, es klingt zugleich wie ihr Testament: Sie spricht einen Toast aus auf die Teufel, Lüste und Leidenschaften, auf die Gier, den Neid, die Liebe und den Hass, sie spricht über seltsame Begierden, reale und geisterhafte Feinde und sie toasted auf die „Armee der Erinnerungen“, mit denen sie kämpft und ihr Fazit lautet dann: Mögen all die genannten Domänen und Kräfte sie niemals ruhen lassen. Ja genauso geschah es...
Gesamturteil – Schluss der Fortsetzungsrezension
Die aus den Vereinigten Staaten stammende Schriftstellerin und Dramatikerin Joan Schenkar hat ein voluminöses, detailreiches, präzises und gemein fleißig wirkendes Gesamtwerk vorgelegt, für das sie acht Jahre gearbeitet hat. Auf den fast 900 Seiten beschreibt sie minutiös die verwirrenden Lebensentwicklungen der Patricia Highsmith und verbindet ihre Lebensentscheidungen und Lebensformen mit den Protagonisten ihrer Romane. Dier Biographie wirkt wie der sezierte Gen-Code der Bestseller-Autorin, die ihr Gesamtwerk dem DIOGNES-Verlag verschrieben hat. Ein umfangreicher dokumentarischer Anhang ergänzt die Biographie-Kapitel, die jedoch nicht chronologisch geordnet sind und insofern den Lesefluss erschweren, zumal die Kapitelüberschriften etwas willkürlich wenig aussagen. („Girls“ in Reihenfolge für die Liebesbeziehungen der Highsmith)
Es ist ein fulminantes, rechercheintensives Werk über Patricia Highsmith entstanden, die ständig auf Reisen ihren Lebensmittelpunkt und ihre Identität suchte, als Leser ihrer Werke gewinnt man außerordentlich viel Hintergrundverständnis für Patricia Highsmith, die das Morden als Lebensmotto lebte, auf Papier und in ihren Phantasien ausgetobt.
ENDE