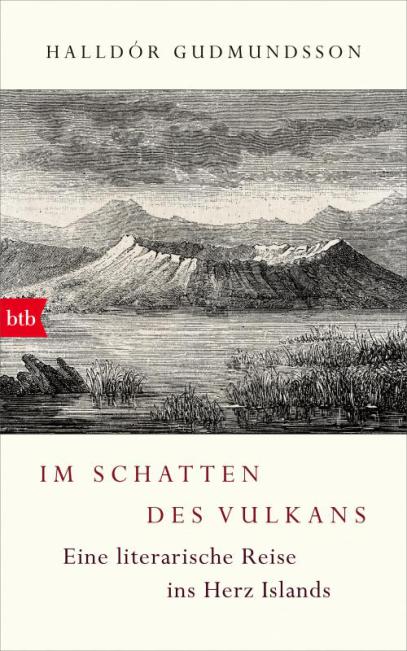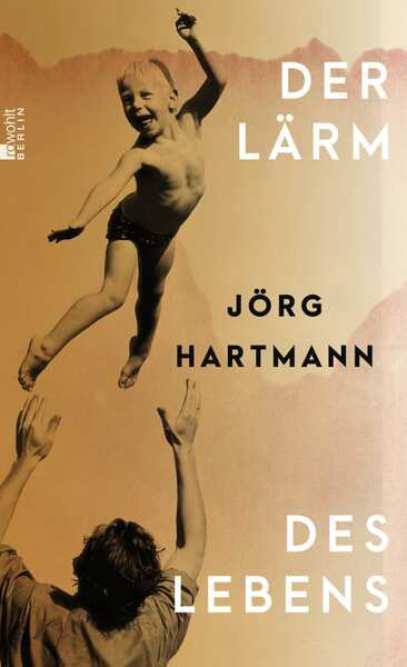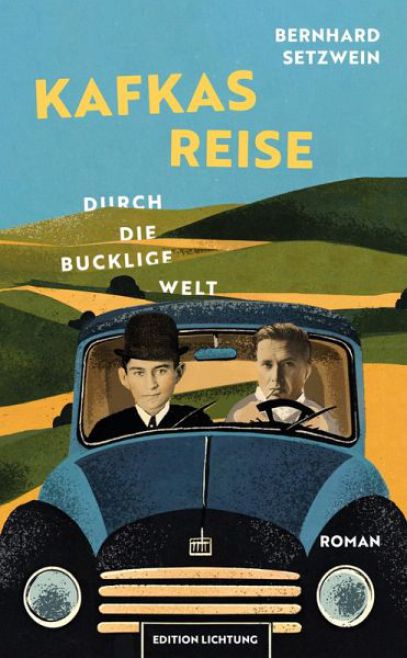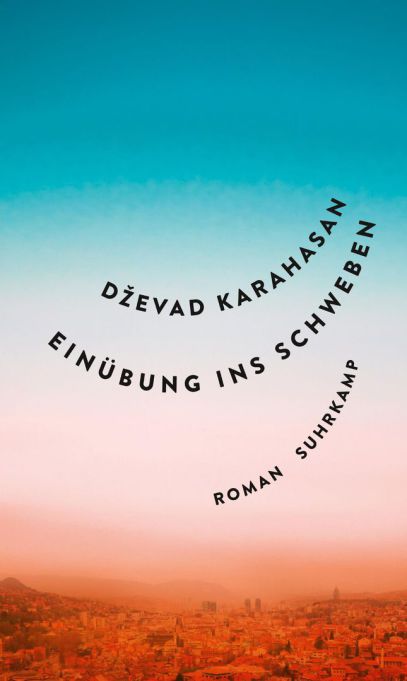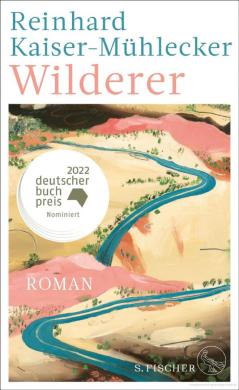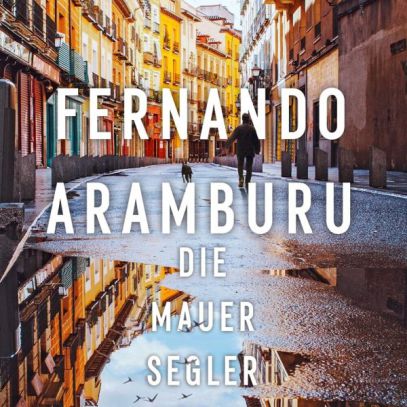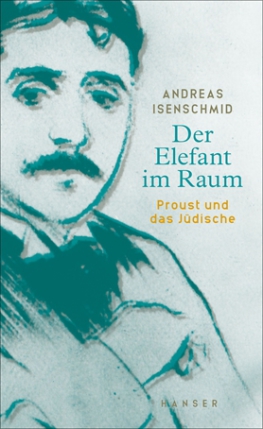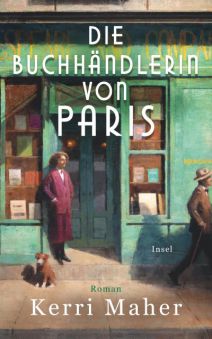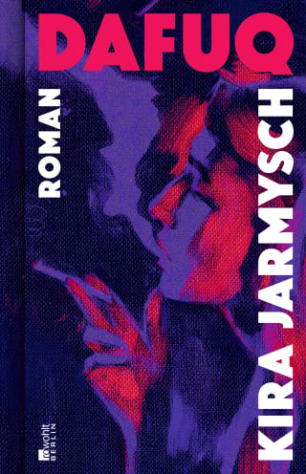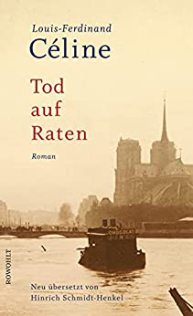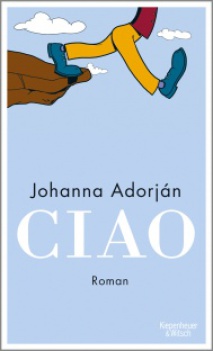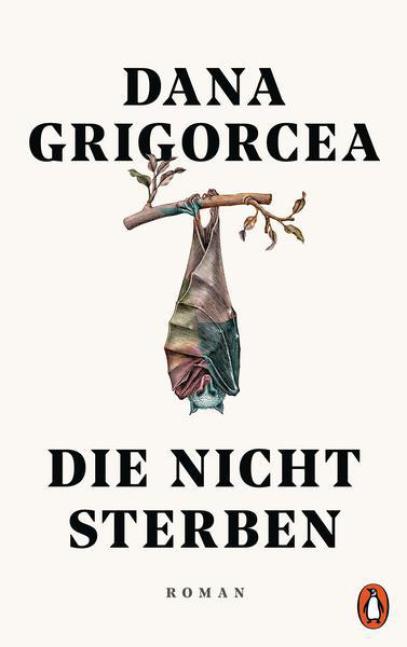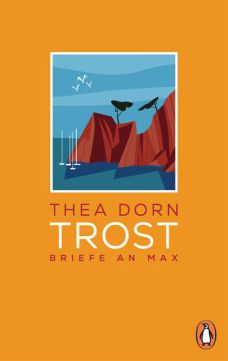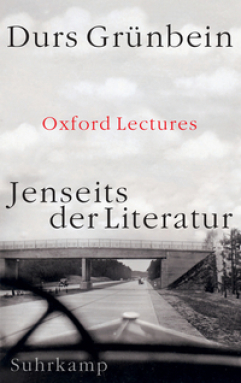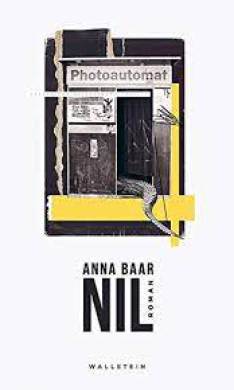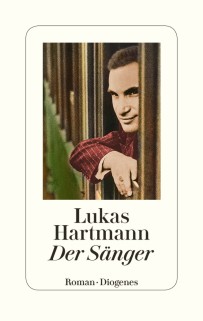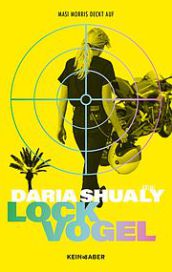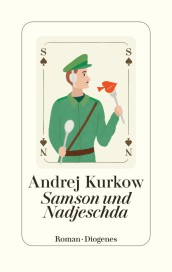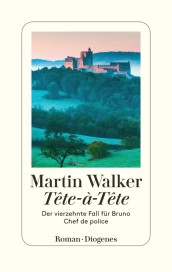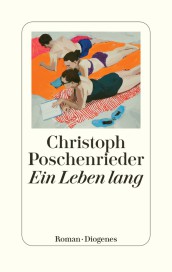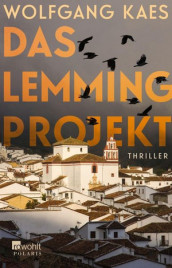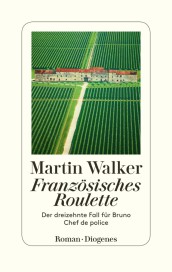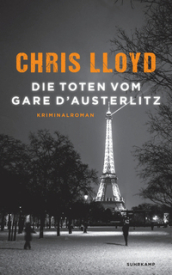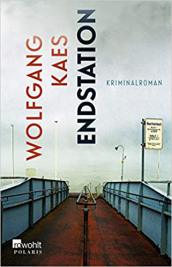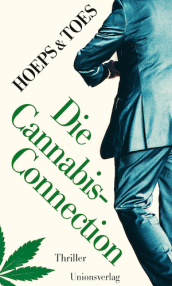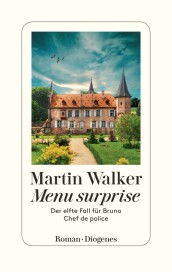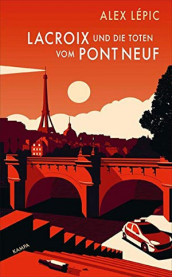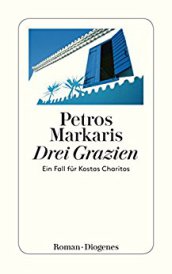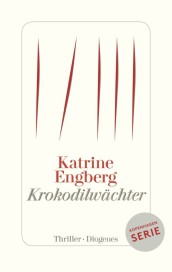Belletristik
Das Neueste in der Belletristik
Kafka als Textverarbeitungssystem
Mit einer literaturwissenschaftlich orientierten Ausbildung liest sich dieses hochinteressante Buch von Andreas Kircher leichter, die nicht immer so einfach zu verstehende Sprache verdeckt mit ihrer Wortwahl manchmal den direkten Zugang zu Erkenntnissen, die dieses Buch vermitteln will.
Pilcher stellt im Vorwort Fragen und Hypothesen auf und versucht nach wissenschaftlicher Art und Weise das Leben, das Lesen und Schreiben von Kafka zu analysieren. Anhand eines konkreten Textes von
Kafka, der kurzen Geschichte ODRADEK erläutert er seine Überlegungen. In den weiteren Kapiteln stellt er einen Zusammenhang her von Kafkas Literatur zu dem Unbewussten, also zur Psychoanalyse, zum
Marxismus, zum Zionismus und schließlich auch zu Spiritistischem, also zum damals grassierenden Okkultismus.
Am Ende benennt Pilcher die Axiome seiner Analyse über das Lesen und Schreiben von Kafka. Dabei ist dem Autor klar, dass sich in Kafkas Texten die Mehrdeutigkeiten, das Rätselhafte und auch die
Absurditäten mischen: Wie also kann man Kafkas Texte lesen?
In seinem Buch versucht er, einen neuen Ansatz zu verfolgen. Ausgangspunkt ist die konkrete materielle und praktische Seite von Kafka schriftstellerischer Arbeit, und genau darin liegt bereits der
Reiz des Buches. Er will keine weitere Biographie des Schriftstellers vorlegen, sondern er sieht Kafka förmlich als einen Textarbeiter, er sieht den Analyseprozess als Folge von Lesen und Schreiben
und Schreiben und Lesen, denn Kafka war ein höchst aufmerksamer und geradezu gieriger Leser.
«Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.» Franz Kafka
Kafka steht vor den Schaufenstern von Buchhandlungen und betrachtet die Auslagen, auf seinem Schreibtisch stapeln sich Bücher und Zeitschriften, er besucht Lesehallen, sitzt in Cafés, Zeitschriften wurden auch gegenseitig vorgelesen besonders gerne von Kafka selbst. Er bestellt sich bei Verlagen Bücher.
«Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses.» Franz Kafka
Geradezu klassisch geworden ist das berühmte Zitat über Bücher, die Axt und das gefrorene Meer in uns, das hier einmal ausführlich zitiert werden soll.
“Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? (...) wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, dass uns sehr schmerzt (...) ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.”
Die düsteren Schwarz-Weiß-Zeichnungen unterstreichen die Interpretationen des Literaturwissenschaftlers, der Kafkas Lesen und Schreiben als ein Textverarbeitungsverfahren interpretiert in einem
durchaus modernen Sinne. In Kafkas Werkstatt wird an und mit Sprache gearbeitet und an und mit Texten, es ist Schreibarbeit! Interessant, dass Kafka auch Veranstaltungen besuchte, in denen es um
Grammatik, Syntax, Rhetorik und Stilistik ging. Kafka übt sich in höheren Sprachfertigkeiten der Philologie und so entdeckt Kilchers Studie das vielgestaltige Unheimliche in Kafkas Moderne.
«Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich.» Franz Kafka
Andreas Kilcher Kafkas Werkstatt Der Schriftsteller bei der Arbeit CH Beck
Andreas Kilcher ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich. Er hatte Gastprofessuren an der Hebrew University in Jerusalem, der Tel Aviv
University, der Princeton und der Stan
Ein Requiem für zwei Richter gegen die Mafia
Als ich das Museum der Geschichte der Mafia in Corleone aufgesucht habe, um nach den Akten von Falcone und Borselino zu suchen, hatte ich mir vorher meterweise LEITZ-Ordner vorgestellt. Nein, so modern waren die Ermittlungsbehörden damals noch nicht, die Justizpapiere steckten in sepiafarbenen Kartons, bündelweise verschnürt. Und haufenweise gestapelt. Esaus wie ein papiernes Durcheinander. Aber den Richtern im großen Mafiaprozess war von vorneherein klar, im Verfahren geht es um die „formale Korrektheit der Anklagen und die Sammlung des belastenden Beweismaterials“, denn beides ist entscheidend. Wobei die Arbeitsteilung klar ist: „Die Mafia tötet keine Richter. Die Richter machen ihre Arbeit, und die Mafiosi die ihre. So war es schon immer.“
Doch bald kam es anders. Saviano fächert detailgenau die Sachverhalte der beiden Attentate und Justizmorde auf, wenngleich seine literarische Ader zuweilen etwas lyrisch pointiert zuspitzt. Zum
Beispiel so: „Der Tod, dumm und pedantisch, winkt ihm zum Abschied hinter dem Autofenster, um den letzten Schuss auf ihn abzufeuern, während die Sonne ein für alle Mal hinter den Wolken verschwindet.
Das genügt, damit der Regen anfängt zu prasseln.“
Sie heißen Gambino, Di Maggio, Inzerillo, Bontate, Mangano, haben italoamerikanische Namen wie John Egitto, Gerald Castaldo, Richard Cefalù und Spitznamen wie Franky Boy. Spatola ist zweifach mit
dem eines Bankiers verbunden. Michele Sindona… Familie Santa Maria di Gesù, Wenn man hier in Palermo etwas finden will, das funktioniert, muss man in eine Bank gehen, schreibt der Mafiaexeget
Saviano und zeigt auf, dass der Fluss und die Farbe des Geldes das Auffinden der Mafiaspuren erleichtert: „Nur das Geld bewegt sich. Und anscheinend bewegt es sich sehr gut...follow the money…, wenn
es darum geht, Verbrecher zu erwischen.“
Bei der Mafia geht das so: „… alle bewaffnet und alle bereit, eine Münze zu werfen, um auszulosen, wer schießen, abstechen oder erwürgen muss.“
Die Hinweise kommen öfter: „Sagt Giuliano, dass er bald sterben wird.“ Falcone und Borsellino ermitteln in „diesem Gewimmel aus Schecks,
Girokonten, Scheinfirmen, öffentlichen Aufträgen und Heroinhandel, wissend, dass die Angst eine alte Freundin ist.
Und die Waffen in diesem Krieg sind moderner geworden, „Schluss mit der abgesägten Schrotflinte der Bauern, her mit der Kalaschnikow.“
Und: „Die vier größten Bauunternehmen aus Catania arbeiten heute mit Zustimmung der palermitanischen Mafia in Palermo.“
In Palermo stehen die Raffinerien für den Heroinhandel, aber es geht längst nicht mehr nur darum: „Die Mafia sitzt mittlerweile in den größten Städten Italiens, wo sie umfangreiche Investitionen im
Baugewerbe, im Handel oder vielleicht in der Industrie getätigt hat.“
Mafia modern! Savianos furioses sachkundiges Werk mit literarischer Ambition zeigt minutiös, wer alles im Kampf gegen die Mafiabosse in den vergangenen Jahrzehnten verloren hat.
Als ich im Mafiamuseum auf die Reihen von Aktenbergen schaue, kenne ich den Savianosatz darüber noch nicht, und der lautet: „Die Papiere sehen aus wie ein wüstes Durcheinander, doch in Wirklichkeit gibt es eine präzise Ordnung. Für sich genommen, sagen diese Aktenbündel recht wenig. Nichts, was über seinen Inhalt hinausweisen würde. Sie sind die Steinchen eines Puzzles… „Beiden Ermittlern ist durchaus ständig bewusst: „Wer von ihnen wird zuerst sterben. Wie. In welcher Position. Mit welchem Gesichtsausdruck. Im Auto oder auf dem Asphalt.“ Saviano macht auch einen historischen Streifzug durch die Schlafmohn-Geschichte.
Als das Aspirin entwickelte wurde, entstand beim selben Verfahren mit Morphin das Heroin. Entwickelt von BAYER.
„Schlafmohn wird zu Opium, das Opium wird zu einer Paste, diese Paste kommt in den Raffinerien an, wird zu Heroin verarbeitet und steigt damit expotentiell im Wert. Alles klar? Es war ein Markt, der
auf einer ständig wachsenden Nachfrage beruhte. Je größer das Angebot wurde, desto größer wurde die Nachfrage.“
Saviano schildert auch sehr nah das verkorkste Alltagsleben eines Mafiaermittlers, ständig auf der Hut niedergemäht zu werden. Falcone geht gerne ins Kino: „Immer wenn er ankam, musste die Eskorte vier Reihen freimachen, um eine Sicherheitsschranke um ihn herum aufzubauen. Im Restaurant ist es nicht besser. Wenn Giovanni mit seinem Begleitschutz ankommt, ist es mittlerweile üblich, dass die Leute aufstehen und woanders essen gehen, zur großen Freude der Restaurantbesitzer, die sich dank des lästigen Richters um üppige Einkünfte betrogen sehen.“
Nach und nach entfaltet Saviano das Innenleben der Mafiafamilien um die Corleonesi, die Palermitaner, den Aufstieg von Riina, Provenzano, die Rolle von Liggio, die von Michele Greco, dem „PAPST“.
Als es dann zum großen Mafia-Prozess kommt, gibt es 475 Angeklagte – die Anklagen reichen von Mord über Drogenhandel und Schutzgelderpressung bis zur Bildung einer mafiaartigen, kriminellen
Vereinigung.
Saviano schont auch sein Heimatland nicht: „Italien ist voll krankhafter Lügner.“
Als hätte Saviano die Ermittlerlupe von Sir Conan Doyle und seinem Kommissar Sherlock Holmes dabei beschreibt Saviano die Festnahme des Mafiapapstes CRECO: „Die mit alten Holzmöbeln ausgestattete
Küche liegt gleich hinter dem Eingang. An den Knäufen der Hängeschränke baumeln Würste und ein Zopf feuerroter Peperoncini. Auf einem Schneidbrett mitten auf dem Tisch liegt ein Stück Brot vom
gestrigen Abend…. Er sitzt in zerknitterter Kleidung auf dem Bett und scheint nicht zu verstehen, was vor sich geht…»Greco Michele? Sie sind Greco Michele?“ Ein großer Fang, der Papst der
Mafiosi, so sein Spitzname festgenommen.
Und es folgt der Mafiaprozess ein Mammutverfahren: über 21 Monate Verhandlung, 349 Sitzungen, 307 1829 Stunden Dauer insgesamt, 475 Angeklagte, davon 208 in Haft, 102 auf freiem Fuß, 44 in
Hausarrest und 121 Flüchtige, Anhörung von über 900 Zeugen und Geschädigten. 1314 Vernehmungen, 635 Plädoyers der Verteidigung, 1265 Prozessakten…
Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo und Madonia Francesco: „lebenslänglich“. Der Kassierer der Cosa Nostra Pippo Calò wird zu dreiundzwanzig Jahren Haft verurteilt, der
Steuereintreiber Ignazio Salvo zu sechs Jahren. Luciano Liggio wird freigesprochen. Insgesamt betragen die Gefängnisstrafen 2665 Jahre, es gibt 114 Freisprüche. Lebenslängliche Haftstrafen gibt es
für 19, die schuldig gesprochen werden.
Und dann kommt die gnadenlose todbringende Abrechnung: „Um 17 Uhr, 56 Minuten und 48 Sekunden geht ein gewaltiger Riss durch die Autobahn Palermo–Mazara del Vallo, und ein Loch wie ein Mondkrater öffnet sich. Im über hundert Kilometer entfernten geophysikalischen Observatorium auf dem Monte Cammarata wird die Explosion registriert. Die Seismographen zeichnen Schwingungen wie bei einem Erdbeben, alle machen sich bereit, den Zivilschutz zu alarmieren….
Alles zerbirst. Die Fensterscheiben, das Metall, ihre Knochen. Ihre Körper. Die Wucht der Explosion erlaubt keine Erwiderungen. Nichts wird verschont in dieser Falle aus zerrissenem Blech.
Die Motorhaube des Autos öffnet sich wie eine Büchse; ein Gewirr aus Röhren, Metall und elektrischen Kabeln verschmilzt mit dem Asphalt. Der Himmel selbst verschmilzt mit der Erde. Der Sarg aus
weißem Metall stürzt so schnell wieder hinunter, wie er in die Höhe geschossen ist. Als er den Boden berührt, ist er schon unter einer Lawine aus Erde begraben.“
Saviano schreibt, als würde parallel die Filmkamera in Zeitlupe dazu laufen.
Zwei Attentate, zwei Richter, zwei Helden aber mehr als nur zwei Tote. Ein erschütterndes Stück Zeitgeschichte, mit Heldenmut aufgezeichnet, denn Saviano steht selbst unter ständigem Polizeischutz
und lebt in wechselnden Unterkünften. Neuerdings werden auch die Verbindungen der Mafia nach Deutschland nach und nach aufgedeckt, ich erinnere mich noch gut an ein Interview mit dem damaligen
Polizeipräsidenten Münchens Dr. Manfred Schreiber, der 1972 steif und fest behauptete, es gäbe keine italienische Mafia in Deutschland.
Weil nichts sein kann, was nicht sein darf, so ähnlich wie beim NSU. Falcone und Borsellino hätten anders ermittelt und geredet. Ihre Risikobereitschaft bezahlten sie mit ihrem Leben.
Der höchste Preis.
Roberto Saviano, 1979 in Neapel geboren, arbeitete nach dem Studium der Philosophie als Journalist. Gomorrha kam rasch nach Erscheinen auf die italienische Bestsellerliste und machte ihn schlagartig berühmt. Nach wiederholten Morddrohungen von Seiten der Camorra steht Saviano permanent unter Personenschutz und lebt seit vielen Jahren im Untergrund. Bei Hanser erschienen Gomorrha (Reise in das Reich der Camorra, 2007), Das Gegenteil von Tod (2009), Der Kampf geht weiter (Widerstand gegen Mafia und Korruption, 2012), ZeroZeroZero (Wie Kokain die Welt beherrscht, 2014), Super Santos (Hanser Box, 2014), Der Clan der Kinder (Roman, 2018) und Die Lebenshungrigen (Roman, 2019). 2009 erhielt Saviano den Geschwister-Scholl-Preis, 2012 den Olof-Palme-Preis für seinen publizistischen Einsatz gegen organisiertes Verbrechen und Korruption und 2016 den M100 Media Award. Er schrieb am Drehbuch zum Film "Paranza - Der Clan der Kinder" mit, das auf der Berlinale 2019 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.
Pressestimmen
"Ein mitreißendes Buch, das direkt ins Herz unserer politischen Gegenwart zielt." Denis Scheck, druckfrisch
"'Falcone' ist Verneigung, Zeitzeugnis und Appell gleichermaßen." Carolin Gasteiger, Süddeutsche Zeitung
"Die derzeit stärkste literarische Stimme Italiens." Birgit Schönau, Die Zeit
"Roberto Saviano hat einen akribisch recherchierten Roman über den Mafiajäger Giovanni Falcone geschrieben." Luzi Bernet, Neue Zürcher Zeitung
"Ein sehr lesenswertes Buch." Christiane Pöhlmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Ein echter Pageturner." Der Standard
"Dieser Roman ist mehr als eine atemraubende Lektüre." Susanna Bastaroli, Die Presse
"Ein großes Requiem, eine Würdigung all derjenigen, die obwohl sie wussten, dass sie höchstwahrscheinlich umgebracht werden, den Staffelstab von ihren toten Vorgängern im Kampf gegen die Mafia aufnahmen." Tomas Fitzel, Rundfunk Berlin-Brandenburg
LINKS
NDR
NZZ
Roberto Saviano schreibt einen Roman über den
Mafiajäger Giovanni Falcone (nzz.ch)
Roberto Saviano und Annette Kopetzki
Falcone
HANSER VERLAG
Amrum - eine Nachkriegskindheit
Als ich dieses Buch gelesen habe, kam es mir so vor, als würde der Autor Hark Bohm, der ja eigentlich ein Filmemacher ist, hinter einer Kamera stehen und immer wieder auf seinen Erzähl-Gegenstand zoomen, oder die Blende nachstellen, oder mit Helligkeit und Dunkelheit arbeiten, um genauestens festzuhalten, was er eigentlich in diesem Buch mit Worten beschreibt.
An manchen Stellen seiner Kindheitserinnerungen könnte man aber auch meinen, dass Hark Bohm eigentlich seinen Beruf komplett verfehlt hat. Denn in vielen Passagen kommen die Vögel und ihre
Meeresumwelt in den einzelnen Kapiteln des Buches vor, mit einer derart genauen Beschreibung verschiedener Vogelarten und ihrer Charakteristiken, so treffend beschrieben, das habe ich noch in keinem
anderen Roman so präzise gelesen. Also ist dieses Buch auch eine Riesenfreude für ornithologisch orientierte Leserinnen und Leser.
Amrum, diese heutige Ferieninsel, ein Naturparadies, eine Nordsee-Insel, die auch ich gerne einmal besucht habe, ist Bohms Heimatort. Dort treffen sich Himmel und Meer, dort erstreckt sich das
Wattengelände, wir entdecken die kleinen Halligen, der Rhythmus auf dieser Insel ist ein langsamer, dort kann man wirklich auch im Urlaub seine Ruhe finden. Aber der Roman handelt ureigentlich ja von
Unruhe in ruhigen Zeiten auf der Insel, denn man schreibt das Jahr 1945. Also ist Kriegsende und die Familien kämpfen auf dieser Insel ums Überleben, und auch ums Fortleben, trotz ihrer
Verstricktheit in das Naziregime. Die Verbundenheit zur Natur gibt dem Jungen mit Namen Nanning Halt. Er ist das Alter Ego von Bohm. Er schlägt sich so durch, auch für seine regime-treue,
hochschwangere Mutter, muss er irgendwie Essen auftreiben fürs Leben. Es ist der alltägliche Überlebenskampf, den uns Hark Bohm da schildert.
Amrum, Frühjahr 1945, Seehundjagd, Fischen bei Nacht, Malochen auf dem Feld, es ist schwer für den gerade erst 12-jährigen Nanning, um seiner Mutter zu helfen, die Familie zu ernähren. Aber die
politische Dimension der Nach- Hitler-Ära dringt immer wieder im Text an die Oberfläche, oder besser gesagt in den Vordergrund, allerdings nie aufdringlich, zuweilen beiläufig, und auch überraschend
spröde. Greifen wir eine Textstelle heraus: "Ja, aber da sind 15 Millionen. Musst dir mal vorstellen, 15 Millionen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern. 15 Millionen sind vorm Russen weg, alles
Deutsche. Und was der Russe noch zu fassen kriegt, haut er mit dem Gewehrkolben tot. Und die Frauen auch. Wenn er sie“, Boy Krüger sprach etwas leiser, „gehabt hat“.
Das sind Dialoge die auch in eine Filmszene passen würden. Und erst recht in die Realität heute wieder.
Der Russe steht 50 Kilometer vor Berlin, und Hitler steht kurz vor seinem Ende. Fragen über Fragen: Was ist Wehrkraftzersetzung, an welchen Träume soll man noch glauben, wie ist das Überleben zu
sichern, kommt Nannings Vater aus dem Krieg heil zurück, wie überlebt die schwangere Mutter? Das alles sind Schicksalsfragen, die sich der junge Nanning gemeinsam mit seinem Jugendfreund Hermann
stellen muss. Und die Fragen häufen sich weiter auf: Wie tötet man Robben, wann ist Lebensmittelbeschaffung illegal, wie klaut man Hühnerfutter, wie ist ein Bulle zu zähmen? Das alles sind konkrete
Lebensfragen, die tagtäglich gelöst werden müssen, egal ob der Wind von Nord, West, Ost oder Süd stürmt, es an einem düsteren Tag regnet, oder die Sonne romantisch im Wattenmeer versinkt.
Der Filmemacher Fatih Akin wird dieses Werk des Filmregisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm für die Leinwand bearbeiten. Das Buch macht so viel tiefenentspannende Lesefreude, dass man auch auf den Film-Spaß gespannt ist, auch wenn es kaum spaßig ist, was in diesem Buch erzählt wird.
Hark Bohm wurde 1939 in Hamburg geboren und verlebte seine Kindheit auf Amrum. Er ist einer der bekanntesten Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten Deutschlands. Zu seinen größten Erfolgen
gehörten „Nordsee ist Mordsee“, „Yasemin“ und „Aus dem Nichts“, für dessen Co-Autorenschaft er mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk wurde ihm zudem der Ehrenpreis des
deutschen Filmpreises verliehen. Amrum ist sein erster Roman, den er gemeinsam mit Philipp Winkler schrieb.
PRESSESTIMMEN
»Hark Bohm schreibt über die letzten Kriegstage aus Sicht eines Jungen auf Amrum – wie er sie selbst erlebte.« Berliner Morgenpost
"Amrum" ist ein Erinnerungsroman: wehmütig, bitter, insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, warm und vor allem eine Hommage an die Insel.« NDR Kultur
»Und von dieser Ahnung, dass da etwas nicht stimmt mit seiner Familie, dem Erwachen und Aufbrechen erzählt „Amrum“, der erste Roman des Regisseurs und Schauspielers Hark Bohm. Eine Legende des deutschen Autorenfilms. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Zitronen
So schön wie Valerie Fritsch in paradoxen Figuren erzählt, wird gute Literatur daraus. Ihr neuer Roman „Zitronen“ verwendet dieses Stilmittel, das Oxymoron, um ihre Protagonisten zu charakterisieren, um Situationen zu ver- oder zu entschärfen, um ihrem hohen Ton die erwünschte Fallhöhe von der Fiktion in eine zuweilen erschreckend reale Allgemeingültigkeit zu verschaffen. Den Aufprall dämpft die 1989 in Graz geborene Autorin mit einer den Roman bestimmenden Ironie, von der nie genau feststeht, ob sie nicht vielleicht doch ernst gemeint ist. Wovon erzählt sie?
Am Rande eines österreichischen Dorfes wohnt die Familie Drach in einem windschiefen alten Haus: „Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte
oder niemand niemanden, nicht einmal unter seinem eigenen Dach“. Lilly Drach – „der Apfelgarten war Liebe und Hass der Mutter“ – schützt ihren Sohn August nicht vor der brutalen Gewalt seines Vaters.
Dessen Fäuste hinterließen manche Blutergüsse, auch in Augusts Seele. Der Vater trödelt mit altem Kram, mit dem er das Haus vollstopft, um es dann auf Flohmärkten zu verhökern. Reich wird man dabei
nicht. Seine ganze Liebe galt seinen Hunden. Als er eines Tages ohne Abschied für immer verschwindet, gerät August unter die gefährliche Pflege seiner Mutter, die ihn für krank hält und ihn, obwohl
ihm nichts fehlt, als Kranken hält. Sie war früher Krankenschwester. Sie mischt August Medikamente und alles Mögliche unter sein Essen, stellt ihn dem Landarzt Otto Ziedrich vor, der keine Krankheit
diagnostiziert.
Lilly und Otto werden ein Paar, aber August wird weiter von seiner Mutter krankgepflegt. Erst als er von einem Blitz getroffen wird, ein Mal auf dem Rücken davon behält, kann er der Mutter entfliehen. Otto Ziedrich hat ihm ein Zimmer in der Stadt besorgt, in der er sich zunächst als Reinigungskraft im Leichenschauhaus durchschlägt. Valerie Fritsch nimmt die von ihr erdichtete Gelegenheit wahr und spinnt ganze Gewebe um die Schicksale der dort auf Identifizierung wartenden Opfer von Gewalt oder Unfällen.
Bald landet August als Barmann am Tresen einer Kneipe, wo er seiner Kundschaft Erlogenes über sein Leben erzählt, bis ihm eines Nachts Ava vor die Füße fällt, die er auffängt und die seine erste und einzige Liebe wird. Ava ist Künstlerin. Beide verbringen ihre zunächst unbeholfenen Nächte mal in Augusts winziger Wohnung, mal in ihrem Atelier. Auf einer Dachterrasse treffen sie mit sehr gemischten Leuten zusammen und beobachten gemeinsam die Passanten unten auf der Straße. Immer denken sie sich etwas über sie aus, was ja nicht offensichtlich ist. Fritsch entwickelt wie schon im Leichenschauhaus auch hier eine beeindruckende Fabulierlust. Ihre originellen Einfälle könnten Stoff für viele Geschichten sein. Kündigen sie vielleicht weitere Romane an?
Die Liebe zwischen August und Ava nutzt sich am Alltag ab, sie verlässt ihn spurlos und ohne tröstenden Abschied. Was fällt ihm anderes ein, als in seine Heimat, in das Dorf, in sein Geburtshaus
zurückzukehren. Dort trifft er seine Mutter Lilly in einem Rollstuhl an, von Krebs angefressen, mit einem neuen Hund auf dem Schoss, dem sie auch Tabletten unter sein Futter mischt. August nimmt noch
mit seiner Mutter an der Beerdigung eines schon seinerzeit verschwundenen Mädchens teil, dessen Leiche nach den ganzen Jahren gefunden wurde. Danach setzt August den Schlusspunkt unter einen
verstörenden, verwöhnenden, bewundernswerten Roman, in dem es so schön heißt: „Aber es gibt einen Moment, in dem das Falsche zu tun, sich richtiger anfühlt, als es zu lassen.“
Harald Loch
Valerie Fritsch: „Zitronen“ Roman
Suhrkamp, Berlin 2024 187 Seiten 24 Euro
George Saunders: Tag der Befreiung Stories
Sind Stories wirklich Prosa light? Ihre Kürze verleitet manchen, sie als zu leicht zu befinden. Aus der ganzen Weltliteratur gibt es längst Gegenbeweise. Und heute? Der 1958 in Texas geborene George Saunders schreibt mit seinen neun unterschiedlich langen Geschichten unter dem Titel „Tag der Befreiung“ ganz aktuell gegen das leichtfertige Vorurteil an. Die Inhalte dieser Stories haben es wirklich in sich. Sie drücken so etwas wie Verzweiflung an der Lebenswirklichkeit in den USA aus. Sie sind nicht parteiisch in den großen inneren Zerwürfnissen des Landes, ergreifen stattdessen Partei für die einfachen Menschen an der sozialen borderline. In dem „Liebesbrief“, den ein Großvater an seinen Enkel schreibt, kommt er der übernächsten Generation dem Vorwurf zuvor, er habe zu wenig getan, um das alles zu verhindern. Keine Einzelheiten – der Leser und die Leserin werden schon wissen, was hätte verhindert werden müssen. So schwer ist das nicht und muss deshalb auch nicht benannt werden. „Die Mom der kühnen Tat“ will sich für ihren Sohn rächen. Natürlich im Namen der Gerechtigkeit und zur Wiederherstellung geordneter Verhältnisse auf den Straßen Amerikas. Der Junge – er erweist sich als der einzige Vernünftige in der Familie – war von einem Herumstromernden in ein Gebüsch geschubst worden und hatte Kratzer im Gesicht davongetragen. Die Polizei ergreift einen Verdächtigen. Der war es aber nicht. Sie ergreift einen zweiten, der als Schubser in Frage kommt. Beide sind miteinander verwandt und Neffen des Besitzers eines Ladens für Haushaltswaren, bei dem Mom schon mal einen herabgesetzten Fernsehapparat gekauft hatte. Der zweite Verdächtige gibt die Tat zu. Der Junge sei hochnäsig die Straße entlanggelaufen. Der Ehemann der Mom sorgt selbst mit einem Baseballschläger für Ordnung und verletzt den ersten, unschuldigen Verdächtigten damit am Knie, so dass er ein Leben lang humpelt. Selbstjustiz der dümmsten Kategorie. Ein verständiger Cop ordnet Frieden an.
„Der Spatz“ handelt von einer unscheinbaren Verkäuferin. Sie arbeitet neben dem Sohn der Ladenbesitzerin, die den „Spatz“ für ungeeignet hält. In einer Frauenzeitschrift findet sie, die eigentlich
eine graue Maus ist, ein paar Tricks, um sich attraktiver zu machen. Und siehe da: Es funktioniert. Am Ende heiraten sie und der Sohn der Inhaberin, die fortan nur Lobeshymnen auf den „Spatz“ singen
wird. Eine echte Herausforderung ist die Titelgeschichte „Tag der Befreiung“. Ist es ein Puppenspiel oder hat in einer an Orwell erinnernden Fiction-Welt ein Impresario Gewalt über die Gehirne seiner
Schauspieler ergriffen? Sie erinnern sich nicht mehr an das „Davor“, werden an- und ausgeschaltet, in verschiedene Intensitäten gedimmt, spielen eine tatsächliche Schlacht aus dem 18. Jahrhundert
gegen Indios nach. Es gibt ein Massaker, das noch in die heutige Zeit hineinschwappt, als Menschenrechtler den Impresario zur Rede stellen und einige Protagonisten „zum Tode verurteilen“ und
vollstrecken. Rätselhaft entwickelt sich die fiction in dieser über80 Seiten laufenden Kurzgeschichte auch mit ihrem künstlichen Vokabular aus einer Scheinwelt. Der „Tag der Befreiung“ hinterlässt
eine verunsicherte Leserschaft, die, wenn sie mitmacht, staunt, was Literatur alles kann. Alle diese Geschichten sind stilistisch herausragend erzählt und bewundernswert von Frank Heibert übersetzt.
Der ganze Band lässt einen tieferen Blick auf eine Gesellschaft werfen, die in weiten Teilen nicht mehr „normal“ tickt, und er tröstet zugleich darüber hinweg, wie nur große Literatur es kann.
Harald Loch
George Saunders: Tag der Befreiung Stories
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Luchterhand, München 2024 320 Seiten 25 Euro
In einem Land der Vergewaltiger
Das Buch ist faszinierend und abschreckend zugleich. Es zeigt Grausamkeit und Gewalt, Machtausübung, Unterdrückung, Leibeigenschaft, Gefangenschaft, Folter. Es stößt ab, und dennoch kann man es aufgrund der poetischen, üppigen vereinnehmenden Sprache nicht mehr aus der Hand legen, wenn man es begonnen hat zu lesen, obwohl es dochFürchterliches und Grausames darstellt. Es beginnt ganz harmlos in einem Ausstellungsraum bei einer Vernissage und es endet, das wollen wir besser nicht verraten, denn wir empfehlen dieses Buch in die Hand zu nehmen und in einem Rutsch zu lesen, weil es ein beeindruckendes Zeugnis slowenischer Literatur ist. Offenbar werden in diesem Buch Vergewaltigungs-Erfahrungen verarbeitet. Wir befinden uns auf einer abgelegenen Insel, wahrscheinlich in der kroatischen Mittelmeerregion gelegen.
Als hätte Kafka die Feder geführt, befinden wir uns zwischen zwei separaten Kleinstädten. In der einen leben die Frauen, in der anderen die Männer, getrennt voneinander. Wir begegnen Terror,
Gefangenschaft, Folter, Tod und Reihen-Vergewaltigungen. Die gezeugten Kinder werden auf furchtbare Art und Weise abgetrieben. Es ist ein fortgesetzter Wahnsinn, ein Terrorsystem. Männer, die Macht
ausüben, Sadismus, pure Quälerei, Demütigung, sexuelle Ausnutzung. Mit Abscheu möchte man sich von dieser entsetzlichen Geschichte abwenden, die ständig in einer poetischen Sprache von täglichen
Gewalterfahrungen berichtet, zugleich aber auch zeigt wie sexuelle Lust mit Machtausübung und Gewalt verbunden sein kann. Da führen Männer mit Peitschen
das Regiment.
Das Buch steckt voller Symbolik.
„Ich bin in eine Welt der erlaubten Vergewaltigung als Kennzeichen der Macht eingetreten und geblieben. Ich habe keinen Widerstand geleistet. Und wahrscheinlich werde ich auch nicht von hier
weggehen … Der Schiffbruch und der Gebieter haben mich allein und verworfen in der Ecke zurückgelassen. … Er war der Herr und Gebieter und ich hatte nicht gewusst, dass ich so sehr auf ihn
wartete.“
Die Frauen leben in der Oberstadt die Männer in der Unterstadt. Das Leben spielt sich ab wie in einer Strafkolonie Kafkas.
Auch vor Klarheit und Brutalität schreckt die Autorin nicht zurück, wenn sie etwa schreibt, „dass sie einem das Kind herauskratzen, wenn man schwanger wird.“ Und wie gesagt Peitschen führen ein
schreckliches Regiment in diesem Buch und eine Hauptrolle. Ein faszinierendes, verstörendes Buch..
Berta Bojetu
Filio ist nicht daheim
Slowenische Bibiliothek Wieser Verlag
Berta Bojetu wurde 1946 in Maribor geboren. Studium der Slawistik und an der Akademie für Theater, Regie, Film und Fernsehen (AGRFT) in Ljubljana.
Eis-Vulkane-Erdbeben und Literatur: ISLAND
Als wir vor Jahrzehnten mit einem Unimog zu einer Rundreise auf Island unterwegs waren und gerade die Fähre verlassen hatten, passierten wir eine Brücke und die gesamten Vorräte fielen am ersten Urlaubstag in einen reißenden Fluss, so dass wir vier Wochen ohne eigene Nahrungsmittel waren. Wir ernährten uns von lauwarmen roten Hot-Dog-Würstchen (Rød pølse) an der Tankstelle und von selbst gesammelten Pilzen. So waren wir nah an der Natur in Island in den vier Wochen und halb-vegan.
Auch die Literatur in Island ist nah an der Natur. Das beweist die literarische Reise des Autors Halldór Gudmundsson die eine jhahrhundertlange ist. Sie führt zunächst vom wortlosen Land der Eddas
und Sagen-Geschichten über die Königssagas, die Isländer-Sagas bis zu den Romanen der Könige, über die Reformationsphase bis hin zum Humanismus. Dann gab es das endlose Jahrhundert der Dichtung, denn
man muss wissen, wenn die nordische Dunkelheit über Island kommt und die tiefen Winter die Melancholie allerorts verbreiten, dann wird in Island fast ein jeder automatisch zum Erzähler und dann zum
Dichter.
Dann tanzen überall auch Elfen über die Wiesen. Und viele glauben wirklich daran und lassen ein quadratisch Stück Rasen stehen, damit sie dort einparken können. Halldór Gudmundsson berichtet vom Mythos der kleinen Sprachen, von der Atomdichtung im Kalten Krieg, vom Einfluss der Dänen, Briten und dann der US-Amerikaner, von dem Eindringen der Moderne in die Literatur Islands, aber immer ist auf dieser Insel die Entwicklung etwa ein hundert Jahre zurück gegenüber vergleichbaren Ländern bis sie jeweils aufholen. Also zum Beispiel bei der verspäteten Entstehung des Romans. Typisch auch, dass Literatur, die durch Frauenhände und Hirne entsteht auch auf Island in der Minderheitenposition blieb. Aber die Menschen auf dieser Insel haben eine unbändige Lust zu formulieren, und das merkt man auch Halldór Gudmundsson selbst an. Es ist ein Opus Magnum, was er da vorlegt, eine Geschichte der Literatur von einem Land, in dem sich Feuer und Eis, freundschaftlich und feindlich begegnen, indem die Plattentektonik der Erde zu mancherlei Eruption führt, so dass die Bevölkerung an Erdbeben und Lava-Fontänen sowie Geysire gewöhnt ist, und die Geothermie gerne nutzt, auch wenn es sich auf Lavafeldern schlecht Auto fährt. Auf Island kann man mit Jules Verne buchstäblich eine Reise zum Mittelpunkt der Magma-Erde gedanklich und teilweise real wagen.
Es gelingt dem renommierten isländischen Autor, ein sehr breit gefächertes Bild der Literatur Islands an den Leser zu bringen, und der sitzt, wenn er das Buch liest, wie in einem Kinosessel, vor sich die Cinemascope- Leinwand, die ein farbiges und eben wirklich breites Bild der Literatur Islands anbietet. Ob schwarze Wikinger und Walrosse, Weltuntergang-Sagas, die Mythologie des Nordens, das dänische und germanische Erbe, die Literatur an Königshöfen, das Geschichtenerzählen in den Familien, die Weltliteratur, die keiner kennt, später dann doch zum Beispiel vom Nobelpreisträger Halldór Laxness, die nordischen Düster-Krimis, all das fängt Halldór Gudmundsson für uns so farbig beschrieben ein, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen will.
Guðmundsson erklärt die geschichtlichen und sozial-historischen Zusammenhänge immer hintergründig mit, betont die ländlichen Strukturen, den Alltag in den isländischen Dörfern oder Gehöften,
berichtet über die Naturgewalten, die Vulkane, die Berge, die Lava, das Meer die Menschen, beschreibt das Entstehen des Verlagswesens, erzählt immer mit, unter welchen Lebensumständen die
Schriftsteller arbeiten, nur selten reichen die Einnahmen fürs Schreiben zum Leben.
In Reykjavik beeinflusst die Rockmusik in jüngerer Zeit die literarischen Talente, am Fjord geschieht Mord und Totschlag, und da interessieren die Charaktere der Menschen und ihre Motive mehr als der
Plot.
Ob Fischexport oder Auslandsgeschäfte mit Energie mit der Wasserkraft, der Einfluss der Immigranten, die Zusammenhänge und Hintergründe werden in den Porträts über einzelne Literaten immer mit
erzählt.
Das Buch endet etwas abrupt, oh es ist ja schon das Ende, ist der Leser überrascht, man vermisst ein abschließendes Resümee-Kapitel, bei der üppigen Fülle des Materials vielleicht auch ein zu hoher Anspruch, aber in einem Zitat kommt ein Fazit doch auch zur Geltung: “Die Literatur half den Isländern im 20.Jahrhundert auch, sich in der Fremde, in der Moderne zurechtzufinden. Um dies zu erreichen, musste die Literatur ihr eigenen Grenzen überschreiten: Mehr Menschen mussten zu Wort kommen, und alle Aspekte der Gesellschaft mussten diskutiert werden”, bilanziert der Verleger, Schriftsteller und Kulturmanager, der den in diesem Zitat erhobenen Anspruch selbst mit diesem seinem Buch über isländische Literatur durch die Jahrhunderte bestens selbst erfüllt hat. Ein opulentes und faszinierendes, vollständiges Porträt einer Literaturinsel, die am besten charakterisiert wird mit einer Kapitelüberschrift aus dem Buch selbst: „Ein Land voller Worte“.
Noch ein persönliches Wort zum Abschluss, das ich sonst eher vermeide. Vor lauter Schrecken, dass alle Lebensmittel im Fluss dahinschwammen, verlor ich gedankenlos im Supermarkt meine Scheckkarte, ohne es gleich zu bemerken. Als ich vier Wochen später die erste europäische weibliche Staatspräsidentin Vigdis innbogadóttir in Reykjavík in ihrem Büro besucht habe, um sie zu interviewen, sagte Sie mir zur Begrüßung: ”Vermissen Sie etwas?” “Ja”, sagte ich, “Meine Scheckkarte.” “Hier ist sie.” Wir lachten beide herzlich und waren uns einig: So ist Island, einfach liebenswert.
Halldór Gudmundsson wurde 1956 in Reykjavík, Island, geboren, wuchs zum Teil in Deutschland auf und studierte in Dänemark. Bekannt ist er als Verleger, Schriftsteller und Kulturmanager.
Er war langjähriger Direktor von Mál og menning, damals Islands größtem Verlag, und später von Edda (1984-2003). Seit 2007 ist er Vorstandsmitglied von Forlagið und seit 2019 dessen Vorsitzender.
Gudmundsson hat mehrere Bücher verfasst, darunter eine Biografie über den isländischen Nobelpreisträger Halldór Laxness, für die er den Isländischen Literaturpreis erhielt und die in fünf Sprachen übersetzt wurde. Eine besondere Rolle spielte Gudmundsson als Projektleiter für die Ehrengastländer auf der Frankfurter Buchmesse: 2011 für Island und 2019 für Norwegen.
Darüber hinaus war er von 2012 bis 2017 Direktor von Harpa, dem international bekannten Konzerthaus und Konferenzzentrum in Reykjavík. Gudmundsson engagiert sich in verschiedenen kulturellen Gremien, unter anderem seit 1987 im Vorstand des Isländischen Literaturfestivals und seit 2022 im Vorstand von Snorrastofa, dem Kultur- und Mittelalterzentrum in Reykholt, sowie als Aufsichtsratsvorsitzender des Isländischen Nationaltheaters.
Er ist verheiratet mit Anna Vilborg Dyrset, die beiden haben fünf Kinder.
Halldór Gudmundsson
Im Schatten des Vulkans Eine literarische Reise ins Herz Islands btb
Currywurst,Pommes und der Lärm des Lebens
Ich mag diese depressiv angelegte Stinkstiefel-Rolle, die Jörg Hartmann im Dortmunder Tatort spielt. Oder sein Auftreten in der Serie “Weißensee” als bösartiger Stasi-Major. Sehr überzeugend, wenn Hartmann in solche Rollen schlüpft. Er kann spielen, aber kann er auch Schreiben? Ja! Drehbücher sowieso schon, und mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Das Motiv, dieses Buch zu schreiben, war der Tod seines Vaters, den Hartmann schreibend besser verkraften wollte.
In diesem Buch tritt er als Autor ganz anders auf, als wir ihn vom Fernsehen her kennen, nämlich als liebevoller Sohn seiner Eltern oder auch Enkel seiner Großeltern. Dieses Buch ist wirklich eine blanke Liebeserklärung an die Kraft seiner Familie einerseits und an die Region des Ruhrpotts auf der anderen Seite.
Im Klappentext zum Buch steht geschrieben, Hartmann würde die Balance zwischen Tragik und Komik halten. Das stimmt, aber auch die Balance zwischen familiären Situationen und öffentlichen
Entwicklungen, zwischen Problemen in der Familie und einfach dem auch egoistisch ersehnten Lebensgenuss, zwischen objektiven geschichtlichen Fakten und subjektiven Erlebnissen und Erkenntnissen.
Immer ist seine Sprache sehr nah dran am Ruhrpott-Leben.
Herrlich die Eingangsszene, wie Hartmann, um als Schauspieler an eine Rolle zu kommen, sich an die Theater-Giganten ranmacht, um mit seinem Schauspielerfreund endlich vorsprechen zu dürfen. Denn
Hartmann will an den berühmten Kammerspielen in München reüssieren oder aber in Berlin an einem renommierten Theater, am besten an der Berliner Schaubühne. Der Anspruch ist hoch, es bleibt bei einer
Ausbildung an der Schauspielschule in München, die er in einigen ersten Stadien erfolgreich absolviert, aber doch nicht bis zum Abschluss bringt. Es sind auch die Selbstzweifel, die den Künstler
plagen.
Hartmanns Buch ist voller Kraft, scharfkantig geschrieben, auf den Punkt genau, trotzdem witzig und sensibel und liest sich in einem Rutsch durch. Es macht einfach Spaß, seinen Gefühlen, seinen Beobachtungen, seinen Einschätzungen zu folgen. Dabei ist das Familiäre gar nicht so rasend spannend. Ja, es ist eben der LÄRM DES LEBENS.
Aber allein die Szenen, mit denen man sich selbst auch identifizieren kann, faszinieren, oder aber auch das karikierende in den Dialogen, zum Beispiel die Lebenswirklichkeiten am Theater. Hartmann kann Szenen schreiben, also vermutlich von seiner Theaterausbildung her geprägt, aber er kann auch knappe Dialoge glasklar formulieren. Immer wieder muss man als Leser schmunzeln oder gar lautstark lachen, wenn die direkte Sprache der „Ruhrpottler“ buchstäblich an unser Lese-Ohr dringt. Auch den Berliner Dialekt hat Hartmann drauf.
Hartmanns Vater erkrankt an Demenz, rührend wie der Sohn das beschreibt und dabei zugleich auch einen Blick in sein Innerstes zulässt, weil er sich eben mit schweren Vorwürfen gegen sich selbst
plagt, sich nicht genug um seine eigene Familie aber auch um die vorherige Generation ausreichend kümmern zu können, denn sein Schauspielerberuf verlangt ihm vieles, vor allem aber Zeit
ab.
Hartmann trifft immer den richtigen Ton, sein Text ist unterhaltsam und dennoch auch tiefgründig gelungen. Hartmann hat Beschreibungspotenz, deshalb wartet man gerne auf sein nächstes Buch.
Hoffentlich ist es bald da!
“Hömma! Es sind noch einige Döneken zu erzählen. Glückauf!”
Jörg Hartmann gehört zu den bedeutendsten deutschen Charakterdarstellern. 1969 geboren, wuchs er in Herdecke, im Ruhrpott, auf. Nach seiner Schauspielausbildung und verschiedenen Theaterengagements
wurde er 1999 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Fernsehproduktionen wie «Weissensee» oder der Dortmund-Tatort, in dem er Kommissar Faber spielt, machten ihn einem breiten Publikum bekannt; im
Kino war er etwa in «Wilde Maus» oder zuletzt in «Sonne und Beton» zu sehen. Jörg Hartmann wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera und dem Grimme-Preis.
Für den Tatort «Du bleibst hier» (2023) schrieb er das Drehbuch. Er hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Potsdam.
Kafka lebt - in Meran und arbeitet im Kino
Anspielungen, Überschreibungen, Umformungen, Bruchstücke, ich füge hinzu Annäherungen und Entfernungen, das alles “patchworkt” Setzwein, als sei sein Name ein Programm in ein „Setzwerk“, eine Art Mosaik, man könnte auch sagen ein Puzzle aus Kafkas Lebensfundus und aus des Autors eigenen Betrachtungen zusammen.
In den Nachbemerkungen offenbart der ostbayerische Autor, mit welchen Materialien er wie umgegangen ist. In einem Interview mit der Passauer Neuen Presse erwähnt Setzwein auch die Erzählung DIE VERWANDLUNG, das Werk DER PROCESS und IN DER STRAFKOLONIE, Werke Kafkas, die ihn von Jugend an geprägt und beeinflusst hätten.
Auch die dreiteilige Biographie über Kafka von Reiner Stach, erschienen bei S.Fischer, erwähnt der Autor als Materialsammlung.
Zum Buch selbst. Es ist ein zweites Leben nach Kafkas eigentlichem Tod 1924, der irgendwie für den Autor nicht wahr sein soll. Und darum gibt ihm Setzwein ein zweites Leben in Meran. Dort hat sich der scheue Schriftsteller hin zurückgezogen und arbeitet an diesem sonnigen Platz der Erde als Platzanweiser in einem Kino, im APOLLO.
An diesem dunklen Ort trifft Kafka täglich seine Leinwandhelden und das Kinopublikum auch. Kafka bleibt auch bei Setzwein ein Sonderling, in einem grotesken Buch, eine nicht ganz so traurige Figur wie im richtigen Leben.
Zum Beispiel: Wenn Kafka Nahrung zu sich nimmt, meist kein Fleisch, schon damals im Trend, beißt er exakt 32-mal auf den Bissen, um gesund zu bleiben.
Er tritt auch mutig ans Fenster, um dort gelenke Leibesübungen zu vollziehen, ein Kraftakt des Schwächlings Kafka, verbunden mit der Hoffnung, dass dies alles seinem geschwächten Körper auch guttut. Im Text lässt der Autor auch das eine oder andere Kafka-Zitat schon einfließen, zum Beispiel jenes über die Bücher, die wie eine gefrorene Axt in dem Meer in uns wirken sollten.
Auch der Briefwechsel Kafkas mit seiner Übersetzerin Milena Jesenská kommt in diesem Buch vor. Auch der nie abgesandte Abrechnungsbrief an seinen Terror-Papa, auch die Szene als Kafka von seinem
Vater durch die Tür auf den eiskalten Balkon gestoßen wird, dieser die Ausgangstür verschließt und den Buben in der Kälte zurücklässt.
Dieser Roman ist wie ein Road Movie, ein Hineinfahren in die “bucklige Welt” und ein mit Schwung wieder aus hier herausfahren, irgendwann, mit Besuchen in Wien, München und Graz. Eine Fahrzeit durchs
Leben, gemeinsam mit einem gewissen Marek. Ein Pole.
Der Herr Doktor, also Kafka, wird als notorischer Einzelgänger wahrgenommen, der seine Flucht ins Schreiben organisiert. Das Verlangen nach dem Schreiben bei Kafka wird von Setzwein besonders betont.
Dieser Trieb lässt sich zwar monatelang unterdrücken, aber irgendwann meldet er sich dann vehement zurück, dann braucht Kafka fürs Schreiben nur ein Zimmer, einen Schreibtisch, Papier, Tinte am
besten auf einer einsamen, unbewohnten Insel.
Die Bücher seines Freundes Max Brod könne er auf den Tod nicht ausstehen, wird Kafka in den Mund gelegt: Dieser Schwulst, diese Gefährlichkeit, dieser Prosa müsse man am besten das Etikett
Doppelrahmstufe anheften. Dies hatte Kafka gequält, es aber Max zu sagen, hatte er sich nie wirklich getraut. Kafka hatte, wenn die Rede darauf kam, einfach nur geschwiegen. Über Franz Werfel ist
Kafka ebenso fassungslos, wie man nur so derartig schlecht schreiben könne.
Ein Roadmovie das Ganze, nicht immer auf gerader Strecke unterwegs, manche Kurve wird genommen, zuweilen fehlt Tempo, wenn’s in die Landschaften geht. Nehmen wir fürs Fazit eine Metapher passend zu
Kafkas Essgewohnheiten: Setzweins Buch ist ein Appetizer für Kafkas Werke.
Bernhard Setzwein wurde 1960 in München geboren und studierte Germanistik. 1990 zog er in die Oberpfalz, er lebt heute in Waldmünchen und in München. Setzwein ist Autor von Lyrikbänden, Essays, Reisefeuilletons und Romanen. Außerdem hat er ein Dutzend Theaterstücke und zahlreiche Radio-Features verfasst. Oft befassen sich seine Werke mit dem mitteleuropäischen Kulturraum.
Bernhard Setzwein Kafkas Reise. Durch die Bucklige Welt Edition Lichtung.
Valerie Fritsch: „Zitronen“
Kindsein in Slowenien
Wenn man sich nicht mit den Kulturen anderer Länder beschäftigt, holen einen zuweilen wieder Kriege ein. Slowenien ist ein Erbfolgestaat der Auseinandersetzung um das jugoslawische Territorium, und auch darum gab es einen Krieg. So muss der Kärtner und zugleich Slowene, Lojze Wieser, immer wieder darauf hinweisen, dass es sich lohnt, die Literaturen der Länder an Rändern wahrzunehmen: “Im Angesicht des Krieges gilt umso mehr: Europa – und die Welt – kann nur erlesen werden. Buch um Buch, nicht Krieg um Krieg.”
Wissen wir um die Kultur der Ukraine oder Moldawiens?
Auf www.facesofbooks.de stellen wir die umfangreiche 33bändige slowenische Bibliothek künftig in loser Reihenfolge vor, damit wir mehr wissen über Wissen, Denken, Fühlen, Malen, Schreiben anderer Länder. Verleger Wieser sagt: “Noch vor gut vier Jahrzehnten gab es keine slowenische Literatur in deutschsprachigen Übersetzungen.Wir haben für diese Literaturen gekämpft, um die Schallmauern der Ignoranz zu durchbrechen.”
Heute also ein weiteres Werk aus der Slowenischen Bibliothek, über das Peter Handke sagt: “Was für ein Schatz wurde da für unsere Leser geborgen.” Und über den Autor sagt er auf dem Buchumschlag: “ (...) ein wunderbares Buch, einfach, dabei tief, voll Einsicht ins Weltgetriebe…”
Es ist ja ein ehernes Gesetz, je älter man wird, desto häufiger erinnert man sich an Kindheitstage. Nicht immer positiv, aber mitunter schon.
In seinem letzten Werk - PREŽIHOV VORANC Maiglöckchen. Erzählungen aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Nachwort von Karl-Markus Gauß - kurz vor seinem Tode auf die Welt gebracht, erinnert sich der Autor an die Kindheit in elf farbigen Erzählungen.
Es ist ein Wehmutsbuch: In der titelgebenden Erzählung “Maiglöckchen” heißt es “Ach, wie gern würde ich morgen ein paar Maiglöckchen mit in die Kirche nehmen, aber es gibt sie nirgends mehr.” Verlust und auch Angst prägen die Erzählungen.
Für mich ist die schönste über ein Stoppelfeld, die mir selbst Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis ruft: “Wenn der Heiden geschnitten wird und das Wetter schön und sonnig ist, ergießen sich übers Feld die schönsten Farben, die die herbstliche Natur vermag. Es stimmt, daß die Felder irgendwie melancholisch sind, denn der ganze Sommerwuchs ist bereits im Absterben, aber all die versonnene Melancholie, die Felder und Wälder, Bergland und tiefe Schluchten überzieht, ist so schön, daß das menschliche Herz unweigerlich seltsamen, fernen Gedanken nachhängt. In dieser Zeit fließen in der Atmosphäre unzählige wunderschöne Farben ineinander – die Farben von vergilbtem Laub, braunen Äckern, grünen Fichtenwäldern, rötlichen Lärchen- und Buchenhängen der näheren Berge, die Farben der düsteren Auen und Schluchten, die sich in jene wundersame, friedliche herbstliche Buntheit ergießen, die sich kaum beschreiben läßt.”
Doch, es ist ja von gerade beschrieben worden, in faszinierenden Worten, vom Schriftsteller Prežihov Voranc, dessen Spätwerk um 1900 erschienen ist. Lovro Kuhar, sein eigentlicher Autorenname, war Kleinbauernsohn und Vagabund, Berufsrevolutionär, politischer Häftling und Abgeordneter, wie der Autor Karl-Markus Gauß in seinem Nachwort schreibt.
Kindheit war in jenen Jahren ein unproduktiver Zeitabschnitt, die Bauern brauchten einfach Arbeitskräfte. Gauß schreibt, es seien ganz zarte und leise Geschichten von Kindern, in denen die Trauer
um das vorenthaltene Glück leuchtet und sinnlich die Freude ferner Tage aufblitzt - wehmütige und schöne Geschichten, die in Wehmut wie Schönheit gleichermaßen
unbeschwert sind von der Last der Ideologie. Und wie die Kinder
das Recht auf ihre Kindheit haben, so muß auch die Literatur, die
von diesem Menschenrecht kündet, von pädagogischen und ideologischen
Zwängen entbunden sein, frei von parteipolitischem Auftrag wie volksbildnerischer Verpflichtung.”
Die Erzählungen sind Betrachtungen über das “bejammernswerte Elend” aber auch zugleich ein “warmherziges Werk, das vom Abenteuer der ersten Wahrnehmung, vom Glück der sinnlichen Erfahrung,
von Reichtum und Fülle erzählt”, steht im Nachwort geschrieben.
So zeigen diese elf Erzählungen enge Parallelen zwischen Literatur und Kindheit, beide sind ungebunden, suchen neue Wege, sind nicht normiert, finden einfach oder auf kompliziertem Wege in die
Welt.
PREŽIHOV VORANC Maiglöckchen. Erzählungen aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Nachwort von Karl-Markus Gauß
Leben durch die Jahrhunderte
Man könnte dieses Buch einen „Schelmenroman“ nennen über einen Kriegshelden, der die Zeitläufte des 20.Jahrhunderts erlebt wie in einem farbigen Cinemascope-Breitwandfilm der 1950er Jahre, üppig, ein bisschen zu farbig, übertrieben, flunkernd geschrieben, also muss nicht alles der prüden historischen Wahrheit dienen, denn der Autor mischt Faction und Fiction und ist versierter Drehbuch- und tschechischer Erfolgsautor. Das lässt Freiheiten zu.
Gestapo und Hitler Gulag und Stalin, dieses Buch ist eine Chronik laufender historischer Ereignisse.
Stančík ist Lyriker und Dramatiker, hat Regie studierte, kann mit Worten umgehen, Dialoge schreiben und Szenen entwickeln. Sein Buch ist ein Mix aus Essay, Reportage und Sachbuch eine romanhafte
Tagebucherzählung, ein Abenteuerroman mit Rahmenhandlung. Das Buch passt so gar nicht in eine Genreschublade, und das ist gerade das reizvolle daran.
Pravomil, die Hauptfigur datiert die vom Verlag so genannte „Tagebucherzählung“ in einen Lebensabschnitt von 14 Jahren bis hin zum Tod. Ein Heldenepos über eine gesamte Lebensstrecke, die
augenzwinkernd dargestellt wird.
Nennen wir einige Inhaltsbeispiele.
Wir erfahren unter anderem, dass die Hauptstadt Berlin von Slawen gegründet wurde, „berl“ heißt nämlich im Slawischen „Sumpf“. Ach so!
Und auch allzu alltägliches wird aufgetischt, dass Lieben viel mehr mit dem Essen zu tun hat, als man jeh ahnte. Oder am Rande erwähnt, dass Dvoraks von Todesahnung geprägter Schlusssatz lautete:
„Mir dreht sich irgendwie der Kopf, ich gehe mich hinlegen.“
Auf Seite 83 lernen wir ausführlich die Methode Schnaps zu brennen. Und ein paar Seiten weiter heisst es wörtlich: „Kümmelschnaps ist für Weiber, Kognac für Millionäre. Ein Soldat trink Rum, weil es
sich danach gut mit dem Bajonett angreifen lässt.“
Auch außenpolitische Grundkenntnisse werden vermittelt: “Grossmächte sind egoistisch, und wenn es am schlimmsten ist, kümmert sich jeder nur um sich selbst.“
Auf Seite 191 findet sich eine köstliche Sexszene, die mehr als nur Schmunzeln lässt, da der Autor sie erst beendet, weil die Präservative ausgegangen sind bzw. die Holzhütte, in der alles geschah,
zwar aus Holz gebaut war, aber die beiden Sexpartner beim Ficken erlebten, dass kein Stein auf dem anderen blieb und sie die Hütte beim Rammeln bis an den Rand des Abgrunds verschoben hatten. Keine
Scheu, diese klarne Worte auch so hinzuschreiben ohne Scheu.
Der Autor entlarvt auch Hitlers Propagandasätze schmunzelnd und mitgeliefert wird dabei auch Klartext: „Deutschland und die Sowjetunion zerteilten Polen wie eine Stange polnischer Wurst.“
Wie das alles ausgeht am Ende, das Lebens- und Romanende wollen wir nicht verraten. Ein Geschichts- und Lebenspanorama voller Lebenserfahrung und Lebensgefühl und daher lesenswert.
Petr Stančík Die Verjährung WIESER Klagenfurt
Petr Stančík, geboren 1968, ist ein tschechischer Prosaautor, Lyriker und Dramatiker. Nach zwei Jahren Regiestudium an der Prager Akademie der Musischen Künste arbeitete er als Fernsehregisseur und später als Texter. Nach 1989 veröffentlichte Petr Stančík zunächst unter Pseudonym. Heute gehört er in Tschechien zu den Bestsellerautoren und widmet sich seit 2016 ausschließlich dem Schreiben. Dabei mischt er Fakten und Fiktion – phantasie- und humorvoll und sprachlich augenzwinkernd lustvoll. Auf Deutsch erschien bereits die Legende Perak: Der Superheld aus Prag, edition clandestin, 2019, Original 2008); für den Krimi Mlyn na mumie (2014, Die Mumienmühle) erhielt er 2015 den renommierten Preis Magnesia Litera. Stančík veröffentlichte weit über zwanzig Bücher in verschiedenen Genres und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Prag.
Stella Benson: Zauberhafte Aussichten
Zwei Frauen gehen auf Entdeckungsreise in den verstaubten Regalen der abgelegten Literatur. Sie entdecken ein, wie sie meinen, “abwegiges“ Buch, das vor über hundert Jahren erschienen und von viel berühmteren Kolleginnen wie Katherine Mansfield oder Virginia Woolf bewundert wurde. Die französische Fassung erhielt damals den Prix Femina. Die Entdeckerinnen verstehen etwas von Büchern: Magda Brinkmann ist Buchhändlerin in Berlin und Nicole Seifert promovierte Literaturwissenschaftlerin in Hamburg. Was führte beide zu diesem „abwegigen“ Buch, das unter dem Titel „Zauberhafte Aussichten“ in der Übersetzung von Marie Isabel Matthews-Schlinzig jetzt in der Reihe Entdeckungen als rororo Taschenbuch erschienen ist. Verfasst wurde es von Stella Benson (1891 – 1933), einer Feministin, Romanautorin und Reiseschriftstellerin. Es gehört in die Reihe der Kriegsliteratur, ist während des Ersten Weltkrieges begonnen worden und 1919 unter dem Titel „Living Alone“ in London erschienen. Es handelt in 10 Kapiteln von Frauen, die sich in London während des Krieges für wohltätige Zwecke engagieren. Sie treffen sich in entsprechenden Komitees, manche von ihnen gehen täglich von Komitee zu Komitee und die Autorin versäumt nicht, dieses – heute würde man sagen: zivilgesellschaftliche – Engagement hoher Intensität ein wenig auf die Schuppe zu nehmen. Zu einer dieser Sitzungen erscheint eine veritable Hexe mit ihrem Besen, die in einem geheimnisvollen Haus auf der fiktiven Fäustlingsinsel in der Themse lebt. Auf der Sitzung verwirrt sie die Komiteemitglieder mit widersprüchlichen Angaben über ihre Person. Die junge Sarah Brown jedoch findet die Hexe interessant genug, um zu der auf ihrem dort stehengelassenen Besenstiel angebrachten Adresse auf der Insel zu gehen und sich in dem Haus einzuquartieren, das den Namen „Alleinleben“ trägt. Die absurde Hausordnung verbietet, dass ein Gast einen anderen bewirten darf, es gibt weder Telefon noch elektrisches Licht und zum Schluss heißt es: „Für das Wohnen in diesem Haus wird kein Entgelt erhoben.“ Vielleicht bewog diese Bestimmung Sarah Brown, das Wagnis einzugehen und das verordnete Alleinsein zu leben. Es entsteht eine fantastische Geschichte, „abwegig“ eben, aber literarisch gekonnt und – das hat die Herausgeberinnen wohl auf ihrer Schatzsuche zur Veröffentlichung bewogen – ein feministischer Schlüsselroman über den Ersten Weltkrieg. Geschrieben ist er voll naiver, hochkarätiger Ironie. Obwohl das Alleinleben im Mittelpunkt steht, treten ebenso skurrile, „englisch“ erfundene, jeweils markant figurierte weitere Personen in dem herausfordernden Buch mit eigenen Geschichten auf. Seine Dialoge sind z.T. in einem Dialekt verfasst, den die Übersetzerin virtuos in eine deutsche Parallelsprache „neben dem Duden“ transponiert. Verrückt ist das alles wie der ganze Krieg, nur nicht so mörderisch. Der Kanonendonner von der Somme oder aus den Ardennen gibt hier den Generalbass für eine die Frauen in London direkt an ihre eigene Front führende magische Geschichte. Offenbar traf das Buch bei seinem Erscheinen den Nerv der Zeit. Als ob es das heute nicht täte!
Harald Loch
Stella Benson: Zauberhafte Aussichten Roman
Aus dem Englischen von Marie Isabel Matthews-Schlinzig
Herausgegeben von Magda Birkmann und Nicole Seifert
Rororo Hamburg 2024 Deutsche Erstausgabe 222 Seiten
Dževad Karahasan: Einübung ins Schweben
Was heißt Schweben? Sich in der Luft, im Wasser im Gleichgewicht halten, ohne zu Boden zu sinken. Frei schweben, sich vielleicht auch schwebend irgendwohin zu bewegen. Oder einfach durch die Luft
schweben, wie fliegen oder gleiten, das sind nur einige Synonyme, die im Internet von it-Sprachhelfern zur Verfügung gestellt werden.
Kann man sich im schwebenden Gleichgewicht halten, wenn brutaler Krieg herrscht?
Sind wir nicht genau aus diesem Gleichgewicht geraten und auf den Boden der Tatsachen gefallen durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine?
Vergegenwärtigen wir uns den Bosnienkrieg in der Rückschau. Endergebnis nur für Sarajewo: 35.000 Gebäude wurden zerstört, etwa 11.000 Menschen starben.
Ich habe den Autor Dževad Karahasan bei einer Europatagung kennengelernt und ihn interviewen dürfen. Seine leise, bedächtige, eindrucksvolle Stimme, die immer Bedeutsames sagt, hat mich so stark
beeindruckt, so tief und wirksam wie sein neuestes Buch, das auch den Leser selbst in einen Schwebezustand befördert.
Dževad Karahasan in Duvno, im ehemaligen Jugoslawien geboren, 200 Kilometer von Sarajewo entfernt, ist ein Erzähler, ein Dramatiker und auch politischer Essayist.
Die Belagerung Sarajewos war immer schon sein literarisches Thema.
Wir erleben in diesem Buch die politischen und menschlichen Auflösungszustände im Anblick von militärischer Gewalt. In den philosophisch grundierten Gesprächen hören wir die klare Sprache des Autors,
von der Kritiker sagen, sie habe die „Dichte einer großen Erzählung“. In Sarajewo, an der Nahtstelle zwischen Orient und Okzident, hat sich ein Vielvölkergemisch vereint: Bosniaken, Serben, Kroaten,
Muslime, Christen, Juden und Nichtgläubige.
Peter Hurd, die eine Hauptfigur des Romans, macht die Belagerung der Stadt verrückt, treibt ihn zum Wahn und Drogenrausch.
Karahasan liebt den dialogischen Roman, der wie eine Brieferzählung daherkommt.
Eine Textpassage führt uns fast mitten hinein ins Früher aber als ein Déjà-vu auch irgendwie in die heutigen Tage des Ukraine-Krieges: „Sie greifen das Innenministerium an, sie schießen aus großen
Kalibern ... Wie war es möglich, dass wir so schnell angefangen hatten, über Kaliber und Waffengattungen zu sprechen, die Entfernung der Explosion einzuschätzen und andere militärische Dinge zu
diskutieren, über die wir heute nicht mehr wussten als gestern, als wir einen Krieg in Sarajewo noch für unmöglich hielten und von Kalibern keine Ahnung hatten.“
Kurz vor dieser Textpassage hat eine Granate auf dem Bürgersteig in Sarajewo einen Menschen pulverisiert. Eine fürchterliche Explosion hatte den ganzen Körper buchstäblich in einzelne rote Tröpfchen
verwandelt, die nach allen Seiten auseinander spritzten.
Wir sind in Sarajevo – zurückgebeamt.
30 Jahre hat Karahasan gebraucht, um in diesem Buch sein Schicksalsthema Sarajevo abzuarbeiten.
Es hat sich gelohnt, so lange zu warten, denn die Dichte seines Romans ist ungeheuerlich.
Karahasan ist ein empfindsamer Autor, der zum Beispiel darüber nachdenkt, dass das Wissen des Menschen früher begonnen hat als alles Erlernte. Zum Beispiel fragt er sich: „Wer hat meine Haut gelernt,
warm und kalt zu erkennen, oder glatt und rau zu unterscheiden, und wann?“
Im Gespräch mit seinem Freund Peter Hurd diskutiert Karahasan auch die Funktion von Sprache: „In der Sprache ist alles enthalten, was möglich ist, also alles, was existiert und alles, was nicht
existiert, aber existieren könnte, und jeder einzelne Mensch erkennt in diesem unbegrenzten Angebot das, was er in sich trägt.“
Auch das Thema Gerechtigkeit wird aufgegriffen: „Warum teilte sich die Gesellschaft in Sarajevo damals derart radikal in jene, die raffen, rauben, retten und sich aneignen und jene, die sorgsam
darauf bedacht sind, dass ihnen auch nicht eine Zigarette in die Hand gerät, die nicht ihnen gehört?“
Von den Bergen um Sarajewo herum schießen Artilleristen und Scharfschützen sogar auf Menschen, die in einer kleinen Gruppe um ein frisches Grab herumstehen, und töten Trauernde oder verletzten sie
schwer.
Es wird also gezielt geschossen auf Friedhöfe in Sarajevo. Als wolle man die Toten nochmals töten, und dabei auch die Lebenden erwischen.
Und wann kommt der Autor nun zum Schwebezustand? Eigentlich in dem ganzen Buch, besonders aber auf Seite 99. Hier wird das Paradoxon erklärt, indem Peter Hurd zum Himmel zeigt und sagt: „Hier
schwebt alles, Rauch schwebt über zahllosen Brandstätten über der ganzen Stadt, in der ständig etwas brennt. Die Seelen der Ermordeten und Unbestatteten schweben über und um uns. Fliegen schweben
über Müllhaufen und Leichen. Unsere rauschgiftabhängigen Freunde schweben, und jetzt, da, schweben auch die Vögel. Und das ganze Schweben spielt sich in der schwersten Stadt der Welt ab.“
Es ist also der Schwebezustand gemeint zwischen Leben und Tod, zwischen Existieren und Aufgeben, zwischen weiser Einsicht und Drogendunst im Kopf, zwischen Scheitern von ahnungsloser Politik und
weiser philosophischer Erkenntnis.
Es sind Karahasans „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“, in die wir hinabtauchen, in eine Stadt unter Belagerung, in der allerdings auch Licht leuchten kann. „Es leuchtet genug, um in Zuständen der
Verzweiflung sogar lesen zu können, aber doch schlecht genug, um nicht alle Scheußlichkeiten der Welt und des eigenen Lebens sehen zu können.“
Für Karahasan ist es eine Erfahrung, dass Krieg in Wahrheit eine Zeit des entblößten Menschen ist.
Und immer wieder sind es diese klaren, kurzen philosophischen Erkenntnissätze altgriechischer philosophischer Bedeutsamkeit, die faszinieren, wie etwa dieser: „Freie Menschen tragen ihre Gesetze in
sich und achten sie, weil sie damit sich selbst achten.“
Es ist auch ein Buch über die Grundsatzfrage Gehen oder Bleiben, Flüchten oder Standhalten, tot sein oder Weiterleben, Fragen, die sich in Sarajevo und dem Bosnienkrieg, die sich aber auch heute im
Überfallkrieg gegen die Ukraine erneut stellen. Insofern ist Karahasans Buch ein Augen- und Ohrenöffner, ein Roman der sensibilisiert, also eine Anleitung für den Überlebens-Schwebezustand.
Dževad Karahasan, 1953 in Duvno/Jugoslawien geboren, zählt zu den bedeutendsten europäischen Autoren der Gegenwart. Sein umfangreiches Werk umfasst Romane, Essays, Erzählungen und Theaterstücke. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung 2004 und mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt 2020.
Dževad Karahasan: Einübung ins Schweben Suhrkamp
I bin reif für die Insel
Schon auf den ersten Seiten kommt uns eine norddeutsche Type entgegen, ein ruppiger Fährmann, der immer die Leinen los- und festmacht, ein paar Worte, ein paar Sätze, sparsam wenig Dialog, und wir sind mitten auf dieser fiktiven Nordseeinsel, die uns fortan bei der Leselust in Bann schlägt mit ihren Menschen, deren schwindenden Lebensentwürfen und deren touristischen Ersatzhandlungen für originales Inselleben uns Landratten faszinieren.
Dörte Hansen schreibt über eine „Zeitenwende“ mit „Wellengang“, Traditionen werden weggespült, das Inselleben ändert sich rapide, die Menschen müssen sich fügen, und immer trifft Dörte Hansen den Ton, in knappen Sätzen, stark verkürzt, schlagwortartig, geradezu lakonisch und dennoch eben treffend: „Alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele. Die nicht mehr richtig atmen können oder nicht mehr glauben, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und die See soll es dann richten, und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut.“
Als ein Wal auf der Insel anlandet, kommt es zum Wendepunkt in der Geschichte. Mehr wollen wir hier nicht verraten.
Da haben Männer in dem Buch wilde Bärte und grimmige Gesichter, da tragen die Tresenkräfte Fischerhemden, da hatten Seebären Erfahrungen mit der tosenden See, da fallen Sätze wie „Man muss, wenn man auf einer Insel leben will, die Tagesränder suchen“, da regen sich die Inselbewohner über Fangquoten auf, die von „Brüsseler Schwachmaten“ verordnet werden. Stattdessen entwickelt sich „Erholungsfischerei“, und die EU finanziert.
„Der Herr ist mein Lotse. Ich werde nicht stranden. Er leitet mich auf dunklen Wassern“, spricht der Herr Pastor, wenn die Urne - ein neues Geschäftsmodell - zu Wasser gelassen wird, weil sich Touristen auch nach dem Tod zur Nordsee hin sehnen und in den tiefen Meeresgrund als Asche-Überbleibsel abtauchen, und die Insel-Influencer verraten im Internet den Followern die letzten Spot-Geheimnisse. Die Wahrhaftigkeit bleibt auf der Strecke, wenn sich die Touristenautos an den Straßenrändern drängeln, schreibt die Hörfunkredakteurin in ihrem dritten Roman.
Trauern die Menschen dem Fischerleben nach? Ja und Nein: „Sie handeln jetzt mit Seifenblasen, wie die meisten auf der Insel. Es ist ein sauberes Geschäft, verglichen mit dem Fischen oder mit dem Töten, Häuten, Kochen eines Wals. Und trotzdem halten manche es (-das neuen Leben-) nicht aus. Im letzten Satz ist vom Salz die Rede „… dem Mund voll Salz.“ Das Buch schmeckt nach mehr vom Meer.
Dörte Hansen Zur See PENGUIN
Dörte Hansen, geboren 1964 in Husum, arbeitete nach ihrem Studium der Linguistik als NDR-Redakteurin und Autorin für Hörfunk und Print. Ihr Debüt »Altes Land« wurde 2015 zum »Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels« und zum Jahresbestseller 2015 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Ihr zweiter Roman »Mittagsstunde« erschien 2018, wurde wieder zum SPIEGEL-Jahresbestseller und mit dem Rheingau Literatur Preis sowie dem Grimmelshausen Literaturpreis ausgezeichnet. 2022 erschien ihr dritter Roman »Zur See«. Dörte Hansen, die mit ihrer Familie in Nordfriesland lebt, ist Mainzer Stadtschreiberin 2022.
Im Aufzug der Geschichte
Schon der Name der Hauptfigur Josip ist ein Phantasieprodukt, gemixt aus „Trotzki“, „Brodski“ und Joseph Roth! Könnte vielleicht auch eine Anspielung auf Josip Broz Tito sein? Auch das Buch ist ein Mix. Und die Songs, die der Moderator im Radio spielt, kommen auch in dieser Form daher. Mit QBR-Code können die Leser die Songmischung auch anhören, zwischen Tom Waits, Procol Harum und den Rolling Stones.
Der Autor verlangt Ordnungssinn vom Leser, denn Juri Andruchowytsch legt eine derartige schreiberische Virtuosität an den Tag, groteske szenische Purzelbäume, mystische Hintergründe - eine Art
ukrainisches Puzzle, vor Beginn des Krieges geschrieben, das der Leser oder die Leserin selbst zusammensetzen muss. Denn diese Gegenwartsdiagnose ist pointiert und schillernd zugleich, verwirrend und
aufhellend, Thriller und Radio-Hommage, ein großartiges Stück faszinierender Literatur.
Da sitzt ein Radiomensch nachts am Mikrofon und schwandroniert vor sich hin, spielt seine Songlist herunter, dazu eine Kaskade der Sprüche über Kindheit, dieses „ewige Drama, oder, wenn Sie so
wollen, die ewige Komödie“.
Oder, die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts, sie „…ordneten sich einem einzigen Ziel unter - der Generierung von gigantischem, kosmisch unendlichem Zaster“. Schöne Grüße an Herrn Putin und die
Oligarchen-Clique. „Ich floh vor dem Imperium, als es gerade zerfiel.“ Oder „In Wirklichkeit bestand unser Winter vor allem aus Tauwetter … Heute erinnern wir uns an de Kälte“.
Kritiker sprechen schon von Weltliteratur.
Szenen, Dialoge, Erinnerungen, Radiomoderationen, Erzählerisches, das alles mischt der Autor in seinen Roman, als wäre das Leben und die Geschichte des Ostens in einen Shaker zu packen, den man
rüttelt oder schüttelt, je nachdem, um diesen Wahnsinnscocktail genießbarer zu machen.
Dieser Rotsky ist eigentlich Musiker und hat die ukrainische Revolution auf dem Maidan als Straßenpianist miterlebt, um mit Noten und Musik auf der Klaviatur und nicht mit Kugeln zu
kämpfen.
Ukraine ist das Vexierbild, das der Autor entwickelt, ohne das Land genau zu benennen, aber doch ist es ureigentlich gemeint. „Verbreiteter Verfall … endlose Hässlichkeit, in Details ebenso wie im
Ganzen (…) Kaputte Umwelt, Gestank, Dreck und Staub. Gleichzeitig ein wahnsinnig hohes Konfliktpotential im öffentlichen Raum, eine darüber ausgegossene schlimme Angespanntheit. (…)“
Rotsky ist auf der Flucht und wird gejagt in einem grellen Plot und in einem Land Absurdistan mit seinen Widersprüchen, Vordergründen und Hintergründen, ein Roman über Umbrüche, Regimeschergen,
Revolutionäre, über Flucht in den Westen.
Das ist Fantastik zur ukrainisch-russischen Realität, auf den verschiedensten Erzählebenen präsentiert, als würde der Erzähler im „Aufzug der Geschichte“ in die verschiedenen Etagen auf- und
abfahren, um sich dort zurechtzufinden. Fast möchte man meinen, der Aufzug stecke gerade fest.
„Andruchowytsch ist ein scharfer Beobachter. In diesem Roman wird alles ins Absurde gedreht, alles verfremdet, und was dagegen hilft, ist die Lebenslust und die Lebenskraft des Helden … Eine
abgefahrene, bizarre Geschichte, mit großer Lust und Leidenschaft erzählt“, schreibt Jörg Magenau, Autor und Literaturkritiker für den RBB.
Fazit: „Wenn Gott unser Richter ist, dann ist der Teufel unser Rechtsanwalt.“
Juri Andruchowytsch, geboren 1960 in Iwano-Frankiwsk/Westukraine, dem früheren galizischen Stanislau, studierte Journalistik und begann als Lyriker. Außerdem
veröffentlicht er Essays und Romane. Andruchowytsch ist einer der bekanntesten europäischen Autoren der Gegenwart, sein Werk erscheint in 20 Sprachen. Der Autor ist zum Klassiker der ukrainischen
Gegenwartsliteratur geworden. Seine Auszeichnungen: Heine-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf 2022, Goethe-Medaille 2016, Hannah-Arendt-Preis 2014.
Juri Andruchowytsch Radio Nach Suhrkamp
Literatur vom Lande - Wilderer
Bauer liebt Künstlerin, Jakob liebt Katja. Kann das gutgehen? Kann Literatur einer solchen Geschichte dem geschmacklosen Parship-Kitsch die Stirn bieten, der in dieser Konstellation angelegt ist? Dem 1982 geborenen Reinhard Kaiser-Mühlecker aus Oberösterreich gelingt es eindrucksvoll in seinem jüngsten Roman „Wilderer“. Er bringt dafür zwei Voraussetzungen mit: Er selbst führt die Landwirtschaft seiner Vorfahren und er ist Künstler, ein Sprachkünstler, der in makellosen Sätzen und mit klaren, manchmal landsmannschaftlich eingefärbten Worten seine gut gebaute Geschichte vom Lande erzählen kann.
Jakob bewirtschaftet den von seinem Vater schon ziemlich heruntergewirtschafteten Hof im Schatten der Autobahn, die an die längst angebrochene Gegenwart erinnert. Er lebt in dem großen Bauernhaus
gemeinsam mit seinen Eltern und der zurückgezogenen Großmutter. Er ist hilfsbereit, geschickt und verdient bei der Gemeinde als eine Art Hausmeister etwas zu den schrumpfenden Erträgen der
einfallslos betriebenen Landwirtschaft hinzu. Im Rahmen dieser Nebentätigkeit lernt er Katja kennen, die für ein paar Wochen ein Stipendium von der Gemeinde bekommen hat. Sie ist eine angehende
Künstlerin aus Salzburg, von Erfolg weit entfernt. Anlässlich eines neugierigen Besuchs auf Jakobs Hof entwickelt sie Interesse an dessen Landwirtschaft und hilft bald sehr anstellig und voller
kluger Gedanken im bäuerlichen Betrieb. Sie entwickelt neue Perspektiven, die Jakob, aus seiner Einfallslosigkeit geweckt, voller Verve und mit der Zeit erfolgreich umsetzt. Beide kommen sich näher,
heiraten, bekommen ein Kind und sehen einer in der Moderne ankommenden Zukunft entgegen.
Ein Jakob ans Herz gewachsener Hund wildert gelegentlich. Jakob versucht erfolglos, es ihm abzugewöhnen und tötet ihn schließlich. Später wird ein neuer Hund angeschafft – auch er wildert und muss
auch dran glauben. Aber es sind nicht die beiden Hunde, die dem Roman den Titel „Wilderer“ geben. Hinter die auch auf die beiden Hauptfiguren seiner Liebesgeschichte irgendwie zutreffende Metapher
setzt der Autor ein nachdenkliches Fragezeichen. Als Katja den Hof – wohl für immer – verlässt, ist sie zur Hälfte Miteigentümerin von Haus und Ländereien und verlangt von Jakob für sich und ihren
gemeinsamen Sohn die Auszahlung ihres inzwischen auch dank ihrer Initiativen werthaltigen Anteils. Sie hat als Künstlerin inzwischen einigen Erfolg erlangt und will sich und ihren Sohn aus Jakobs
Familie befreien. Jakobs Vater und seine Schwester verbindet eine unselige Verwandtschaft, sein Bruder ist ein langweiliger, frömmelnder Beamter und seine Großmutter hat kurz vor ihrem Tode Jakob
doch noch das erhebliche Vermögen überschrieben, das sie bei der „Arisierung“ jüdischen Eigentums in der Nazizeit geraubt hatte. Jakob wird das „Judengeld“, wie es in der Familie respektlos genannt
wird, nicht anrühren.
„Wilderer“ enthält eindrucksvoll gezeichnete, sich entwickelnde Persönlichkeiten. Die Protagonisten wachsen einem auf je eigene Weise ans Herz. Die Nebenfiguren bilden eine farbige Palette
menschlicher Eigenschaften ab und führen Allzumenschliches als literarischen Mehrwert mit sich. Das vermutlich überwiegend städtische Lesepublikum wird das entbehrungsreiche Leben auf einem kleinen
Bauernhof ohne Romantik und in genauer Beschreibung der Natur- und Arbeitswelt nachempfinden können. Wann gab es zuletzt – außer von Kaiser-Mühlecker selbst – Literatur vom Lande, noch dazu so schön
erzählt?
Harald Loch
Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer Roman
S.Fischer, Frankfurt am Main 2022 350 Seiten 24 Euro
Nordstadt - ein Roman über Jugendliche
Impfgegner gab es schon immer und ihre Opfer auch. Boris ist eines. Seine Mutter ließ ihn als Kind nicht gegen Kinderlähmung impfen. Als Jugendlicher erkrankte er und kann auf seinen Polio-Beinen nur eingeschränkt gehen. Schwimmen auch nur mit seinen kräftigen Armen, sein Beinschlag ist kümmerlich. Von ihm und vor allem von seiner Bademeisterin „Nene“ handelt der kleine Roman „Nordstadt“ von Annika Büsing. Er ist das erste Buch der Autorin, die Wert darauf legt, ein Arbeiterkind zu sein. Sie ist im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen und lebt mit Mann und zwei Söhnen wieder dort. Dazwischen war sie gen Norden gezogen, nach Island und dann nach Hamburg.
Heute unterrichtet sie Deutsch und Religion an einem Bochumer Gymnasium. Ihr Roman spielt im Wesentlichen in der Schwimmhalle der „Nordstadt“, handelt von Nenes Erlebnissen als Bademeisterin zu denen auch Boris gehört. Aus gegenseitigem scheuem Respekt wird eine vorsichtige Liebesbeziehung. Alles beginnt mit dem Schwimmbrett auf dem Nene eine Trainingsanleitung für Boris‘ Beinarbeit notiert hat und geht mit ein, zwei – die Ich-Erzählerin Nene zählt bis zu fünf – gemeinsamen Kinobesuchen weiter. Die zaghaften Versuche sexueller Annäherung münden in gelegentliches Gelingen.
Von alledem erzählt die Autorin in einem frischen, manchmal etwas betont jugendlichen Ton. Als Lehrerin hört sie sich so manches in der Klasse ab. Die Dialoge zwischen ihren beiden Protagonisten gelingen ihr oft auf neue Weise humorvoll, manchmal auch nachdenklich existenziell. Ihre beiden Hauptfiguren schenken sich nichts. Boris lebt im Prekariat, hat keine Arbeit oder Ausbildungsstelle, lebt von den geringen Zuwendungen vom „Geldamt“, ist am Monatsende oft so klamm, dass er nichts mehr zu essen hat. Nene steht etwas besser da und zahlt auch für Popcorn im Kino, den Eintritt sowieso. Der sozialkritische Inhalt und der deutliche Ton klagen Verhältnisse an, für die Boris nichts kann. Aber sie entlässt Boris auch nicht in die Mitleidsnische, in der es keinen eigenen Rest an Verantwortung mehr gibt. Nene selbst hat eine schlimme Kindheit mit einem alkoholkranken, schlagenden Vater und manchem Einschreiten des Jugendamts hinter sich. Als Jugendliche wurde sie von einem Gleichaltrigen vergewaltigt. Ob sie das nicht anzeigen wolle, wurde sie gefragt: „Nein, ich will es vergessen“!
Die Autorin gruppiert um Nene und Boris einige treffend gezeichnete Personen in der zweiten Reihe: Eine bürgerliche Halbschwester Nenes, mit der sie sich nicht verstand, sich mit ihr aber versöhnt.
Die Mutter von Boris, die ihm die Polioimpfung verweigerte. Eine langjährige Kundin im Schwimmbecken, deren Badekappe Nene nach derem Tode als Andenken erbittet. Manches in diesem sehr klaren Roman
ist rührend, anderes hart und kompromisslos. Immer überzeugt die Autorin mit dem, was sie richtig sagt und immer sind die Menschen glaubwürdig, wenn sie das sagen, was eigentlich auf der Hand liegt,
aber keiner mehr wahrnimmt. Das tut gut, es endlich so deutlich zu lesen, mit so viel Wärme und Lebenswillen. „Wie kann man gleichzeitig pathetisch und herzlos sein? Geht das überhaupt?“ Heißt es an
zwei Stellen. Nene und Boris werden ihrer Wege gehen, als sie sich im Schneetreiben trennen: „… wir haben sowieso nichts zu verlieren. Nicht, weil das nichts ist, sondern weil es alles ist, weil es
die Welt bedeckt wie der Schnee. Boris nimmt seine Mütze ab und setzt sie mir mit einer Hand ungelenk auf den Kopf, und er sagt: ‚Wenn du mit wem anders rummachst, stecke ich die Stadt in
Brand‘. ‚Episch‘, sage ich.“
Harald Loch
Annika Büsing: Nordstadt Roman
Steidl, Göttingen 2022 128 Seiten 20 Euro
Notizen nicht aus der Provinz
Ja, das Buch macht gute Laune und bereitet das oft zitierte Lesevergnügen, Humor und Sarkasmus blitzen auf, analytische Erkenntnisse mischen sich mit subtilen Beobachtungen über Menschen und das Leben an sich, über Vorgänge und Absurditäten.
Vorbilder für sein Notizbuch gibt der Autor preis, etwa Sloterdijks Zeilen und Tage oder Botho Strauss‘ Der Fortführer, und so führt eben Michael Maar sein Zeilen-Mix auf Fliegenpapier fort, ohne
innere Ordnung. Die Fixierung auf bestimmte Notizen bleiben dem Leser überlassen, er sucht sich aus, was ihm oder ihr gefällt. Auch der Rezensent darf also auswählen.
Besonders gefällt mir, dass Autor Maar Bernhard Vogel dabei ertappt, wie er diplomatisch unkorrekt in hellem Anzug Valery Giscard d’Estaing - ein Parkett-Fauxpas - empfangen will. Schnell eilt
er heim, zieht sich um, wählt den Schwarzen, trifft dann endlich den französischen Präsidenten, der derweil auch sein Outfit gewechselt hat und nunmehr in Hell erscheint.
Alltagsbeobachtungen, Erkenntnisse, Zitate, Literaturverweise, Weisheiten, Literarisches, Feuilletondebatten, die Ehelosigkeit von Adalbert Stifter oder Übersetzungsprobleme bei Marquez, das alles
kommt vor, auch die Sadomaso-Gefühle des Herrn K., gemeint ist Kafka.
Was für ein schöner Satz, der literarisches Bemühen zusammenfasst: „Man will durchs Verb ausdrücken, was einen sonst die Anstrengung des Arguments gekostet hätte.“ Ratsam ist: „In Büchern nie aus dem
Gedächtnis zitieren.“ Alltagstauglich: „Und wohin schreibt man, dass man eine to-do-Liste machen sollte?“ Aus eigener negativer Erfahrung damit ist mir diese Erkenntnis besonders lieb: „Eine der
einfachen Grundregeln des Lebens: Wechsle nie zu Vodafone.“ Ranicki würde dazu lispeln: Das ist große Literatur! Und so nah am Leben.
Bleiben wir bei Literatur, die sich seitenweise ergießt. Da empfindet der Autor die „Sehnsucht nach einem Punkt“, wenn literarische Gedankenströme allzu breit und lang dahinströmen, ohne zum Ende zu
kommen.
Also, ein kurzweiliges Notizbuch, das auf den Einkaufszettel kommen sollte.
Setzen wir also hier, um nicht der eben genannten Gefahr zu erliegen, einen . (=Punkt)
Michael Maar, geboren 1960, ist Germanist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Bekannt wurde er durch seine Dissertation Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem
Zauberberg (1995), für die er den Johann-Heinrich-Merck-Preis erhielt. 2002 wurde er in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen, 2008 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste,
2010 bekam er den Heinrich-Mann-Preis verliehen, 2021 den Werner-Bergengruen-Preis. Seine jüngste Veröffentlichung ist der Bestseller „Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur“. Er
hat zwei Kinder und lebt in Berlin.
Michael Maar FLIEGENPAPIER Vermischte Notizen ROWOHLT
Tagebuch eines Selbstmörders
Ausnahmsweise geht es hier mit dem Schluss los, damit der Interessent nicht von der Lektüre des Buches abgeschreckt wird: Auf Seite 830, der letzten des Romans „Die Mauersegler“ des Spaniers Fernando Aramburu steht der erlösende Satz: „Águeda streckte mir eine Hand entgegen und sagte ernst und mit fester Stimme ‚gib mir das Gift‘!“
Der Philosophielehrer Toni beschließt am 1. August 2018, sich in genau einem Jahr das Leben zu nehmen. „Ein Jahr noch. Warum ein Jahr? Keine Ahnung. Aber das ist mein absolutes Limit.“ Diese obszöne
Idee gliedert den grandiosen Roman in 365 Teile. An jedem seiner verbleibenden Tage schreibt Toni sein geplant postumes „Tagebuch eines Selbstmörders“ .
In den Aufzeichnungen geht es um die Vergangenheit, seit Tonis Kindheit. Es geht um die erzählte Gegenwart. Es geht um einen bei einem Anschlag verletzten und fußamputierten Freund, den er für sich insgeheim „Humpel“ nennt. Das Gymnasium, an dem Toni unterrichtet wird besichtigt. Seine ganze Familie spielt in wichtigen Nebenrollen mit, seine Frau Amalia, mit der er eine zänkische Ehe führt und die ihre Geliebte heiraten will, sobald sie von Toni geschieden ist. Der spanische Bürgerkrieg, die manchmal ätzende demokratische Gegenwart, das Leben in Madrid, das er mit seiner Hündin Pepa so durchstreift, dass die Leserin zu einem Stadtplan greifen möchte, Nachbarn, Kollegen, herausfordernde Schülerinnen und fein gefühlte Szenen unterschiedlicher Sexualität wechseln mit jedem geschriebenen Tag einander ab. Das ist geschickt, wohltuend, in vielen Fällen auch spannend, und lenkt von der angelegten Grundspannung ab, ob und wie der geplante und eher nebenbei immer wieder bekräftigte Vorsatz der Selbsttötung wohl verwirklicht wird. Bewegend sind die Augenblicke bei „Mama“ im Altersheim. Mit seinem jüngeren Bruder Raoul – wechselseitige Hassobjekte – richtet er es so ein, dass sie ihre Mutter nie gemeinsam besuchen. Eine junge Nichte, Tochter dieses Bruders, leidet an einem Hirntumor, der teuer in Essen bestrahlt werden soll. Toni wird einen namhaften Betrag zu den Kosten beisteuern. Da er ohnehin bald aus dem Leben scheiden wird, benötigt er seine Ersparnisse und sein Erbteil nach der inzwischen an Alzheimer verstorbenen Mutter ja nicht mehr.
Aramburu wurde 1959 in San Sebastian im Baskenland geboren und lebt seit über 30 Jahren in Hannover. Er ist ein großartiger Erzähler und Willi Zurbrüggen ist sein großartiger Übersetzer. Der Roman
breitet – immer aus der Perspektive des Suizid-Kandidaten – die ganze Palette der condition humaine vor seinem Publikum aus. Nicht etwa nur das Negative, das Tonis Entscheidung verständlich machen
könnte, auch wahre Highlights menschlichen Erlebens, witzige Begebenheiten und Anekdoten gehören dazu. Eine mehrstufige Ironie durchzieht den Roman. Der eher mittelmäßige Philosophielehrer denkt über
größere Vertreter seines Faches nach, zitiert sie manchmal durchaus passend. Eine vor Jahrzehnten zugunsten seiner späteren Frau Amalia zurückgewiesene, wenig attraktive Freundin taucht zufällig
wieder auf. Allen ihren drei bisherigen Hunden hatte sie den Namen „Toni“ gegeben. Der Philosophielehrer Toni weicht den Nachstellungen dieser Águeda immer wieder aus. Ein Komplott seines Freundes
Humpel – inzwischen hat der sich selbst umgebracht – mit dieser Águeda führt dann zu der Szene, die Toni auf der letzten Seite des Romans beschreibt. Er legt ihr auf ihre Aufforderung das Tütchen mit
Kaliumzyanid in die Hand. „Als sie daraufhin den Inhalt in einen Gully schüttete, sah ich, dass es die Hand mit der Narbe war. Sechs Tage sind seitdem vergangen, und heute Morgen habe ich mir ein
Buch gekauft.“
Harald Loch
Fernando Aramburu: Die Mauersegler Roman
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen
Rowohlt, Hamburg 2022 832 Seiten 28 Euro
Andreas Isenschmid: Der Elefant im Raum – Proust und das Jüdische
O-Ton Goebbels in Paris um 1900! Die Recherche des Literaturkritikers Andreas Isenschmid zu „Proust und das Jüdische“ führt mitten in die Dreyfus-Affäre zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Autor
erspart seinen Leserinnen nicht das volle Ausmaß des damals in Frankreich wütenden Antisemitismus. Der Wortlaut der aggressiven Ausbrüche erinnert an die Schmähungen und Drohungen von Goebbels. Die
vulgäre Pariser Haltung gegen Juden gipfelte in einem tausenstimmigen Chor von Antisemiten, als der jüdische Offizier Dreyfus öffentlich degradiert wurde – widerwärtig und erschreckend! Isenschmid
geht minutiös der Frage nach, wie viel Marcel Proust davon mitbekam, wie viel er in seinen zeitnahen Interventionen davon verarbeitet hat, wieviel in dessen Recherche „Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit“ eingeflossen ist.
Marcel Proust hatte eine jüdische Mutter und einen katholischen Vater. Er war katholisch getauft, aber nicht gläubig. Isenschmid taucht tief in die erlebte Familiengeschichte Prousts ein, fördert
dessen zahlreiche Zeitschriftenartikel aus der Zeit vor, während und nach der Dreyfus-Affäre zutage und setzt aus allem das ambivalente Verhältnis Prousts zum Jüdischen zusammen. Das besteht teils
aus abwertenden, teils aus bewundernden Passagen im Werk Prousts, die der Autor stellengenau zitiert und einordnet. Auch dazu ist Literaturkritik auf höchstem Niveau fähig, wenn sie sich auf die
verfügbaren Quellen stützt. So entsteht nicht nur das schlüssige Resümee von einem Roman, in dem zwei der Hauptpersonen, Swann und Bloch, Juden sind und Marcel eben Marcel ist: „Das ist Prousts
„Recherche“, dieser wohlgeformte Strom verzauberter und verzaubernder Einzelheiten, die sich aller begrifflichen Fixierung entziehen. Die Geschichte der Homosexuellen, welche die „Recherche“ erzählt,
ist unendlich nuancierter und übrigens auch freudvoller als die Formel der race maudite. Und so ist auch die Geschichte der Juden in der „Recherche“ trotz einiger Holzschnitzereien ein Strom
hochnuancierter ambivalenter Einzelheiten.“
Bevor Isenschmid mit einer Trouvaille seine glänzend geschriebene und spannend zu lesende Untersuchung schließt, fasst er noch einmal zusammen: „Denn wenn Prousts „Recherche“ auch aus schönsten, alle
Abstraktionen unterlaufenden Einzelheiten besteht, so ist doch offenkundig, dass im Kreislauf dieser Einzelheiten, wie geheimnisumhüllt auch immer, doch stets ein jüdisches Herz mitschlägt. Man darf
dieses Jüdische nicht zu deutlich benennen, doch vergessen wird es nie. Auch nicht in Prousts letzten Stunden.“ Hierfür entdeckt Isenschmid für sein deutschsprachiges Publikum einen letzten Zettel
aus dem Sterbezimmer Prousts auf dem steht: „Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht.“
Harald Loch
Andreas Isenschmid:
Der Elefant im Raum – Proust und das Jüdische
Hanser, München 2022 240 Seiten 26 Euro
Wie Ulysses auf die Welt kam
Wieviel Gewinn brachte die lost Generation der Weltliteratur! In Paris zwischen den Weltkriegen wurde dieser Gewinn verbucht, und noch ein Hauptgewinn zusätzlich. Eine Buchhandlung war daran maßgeblich beteiligt: „Shakespeare and Company“, gegründet und erfolgreich betrieben von Sylvia Beach. Von ihr handelt Kerri Mahers Roman „Die Buchhändlerin von Paris“.
Im Zentrum stehen James Joyce und dessen „Ulysses“, den Sylvia Beach vor 100 Jahren auf eigene Kappe zuerst veröffentlichte. Vorabdrucke waren in einer amerikanischen Zeitschrift von der dortigen Zensur verboten worden, und englische Verlage hatten sich nicht an diesen Meilenstein der modernen Literatur herangewagt. Die Amerikanerin Sylvia Beach war in Paris verliebt. Nicht nur in die Stadt, sondern auch sehr bald in ihr Vorbild, die Buchhändlerin und Herausgeberin literarischer Zeitschriften Adrienne Monnier. Diese Liebe zwischen zwei Frauen, literarisch gegründet, ist die einfühlsam gezeichnete zweite Linie dieses Romans, der großzügig und intim von der Invasion amerikanischer Autoren in Paris erzählt, die vor dem Muff und dem Alkoholverbot während der Prohibition in den USA erzählt. Shakespeare and Company war Ziel und Mittelpunkt dieser Invasion.
Das, was in Kerri Mahers Roman scheinbar wie Namedropping wirkt, ist in Wirklichkeit sein nicht-fiktionaler Gehalt. Alle diese schon bekannten und erst noch berühmt werdenden Autoren – fast
ausnahmslos waren es tatsächlich Männer – machten das Einmalige der Buchhandlung aus. Hier konnten sie amerikanische und englische Literatur im Original bekommen, hier trafen sie sich. Sylvia Beach
hatte die verbotene amerikanische Zeitschrift mit den Auszügen aus „Ulysses“ nach Paris schmuggeln lassen, bot sie dort ihren amerikanischen Kunden an und hatte selbst die außerordentliche
literarische Bedeutung dieses entstehenden Werkes erkannt. Als sich abzeichnete, dass es keinen Verleger finden würde, sprang sie schnell entschlossen in die beschämende Lücke und organisierte mit
Hilfe von Adrienne Monnier und vielen Freunden die finanziell und auch wegen der von Joyce während des Druckvorgangs immer wieder vorgenommenen Textänderungen technisch herausfordernde
Erstveröffentlichung des Jahrhundertromans.
Kerri Maher schmückt geschickt die nachgewiesenen Tatsachen mit vielen fiktionalen Dialogen und Szenen, die sie literarisch für wahr erfindet. Die erhellen plausibel und oft von wärmenden Tönen
getragen die Atmosphäre dieser Pariser Ausnahme-Society der 1920er und folgenden Jahre. Kaum eine andere Buchhandlung auf der Welt dürfte an die Bedeutung von Shakespeare and Company heranreichen,
aber sehr viele Buchhandlungen sind an ihrem Ort und zu ihrer Zeit derartige Zentren der Literatur. Es ist ja nicht so, dass dort lediglich Bücher verkauft werden. Vielmehr entwickelt sich in vielen
ein literarisches Leben, das nicht nur von den Autoren, sondern auch von dem Publikum inspiriert wird. Es sind kulturelle Kostbarkeiten, in den es keiner zu Reichtum bringt, die ihrerseits aber einen
literarischen Reichtum schaffen.
„Die Buchhändlerin von Paris“ ist auch das Hohelied auf solche Stätten der Literaturvermittlung, ohne die Einzigartigkeit von Shakespeare and Company zu schmälern. Immerhin gehören dazu begeisterte Menschen, die etwas von Literatur verstehen, der sie ihr Leben widmen. Dazu gehören Menschen, die großzügig ihre Existenz, oft auch ihr Vermögen dafür einsetzen, dass Leserinnen und Leser die Freuden der Literatur erleben können. Von zwei von diesen ist in Kerri Mahers Roman die Rede. Schön, dass sie sich lieben, schön dass die Autorin von dieser Liebe so einfühlsam wie diskret erzählt.
Um sie herum schwirren Männer wie Ezra Pound und Ernest Hemingway, André Gide und Paul Valérie, T.S. Eliot, später auch die Fitzgeralds, Henry Miller oder die vor den Nazis aus Deutschland geflohenen Walter Benjamin und Gisèle Freund, die dann im Leben von Adrienne Monnier eine wichtige Rolle spielen würde - Prominenz mit all ihren Macken und Vorzügen. Mit James Joyce hatte Sylvia Beach noch ihre liebe Not, die aber keinen Zweifel an der Qualität von Ulysses zuließ. Welch eine Einladung diesen großen Roman endlich oder wieder zu lesen!
Harald Loch
Kerri Maher: „Die Buchhändlerin von Paris“ Roman Aus dem amerikanischen Englisch von Claudia Feldmann Insel, Berlin 2022
Kerri Maher studierte an der Columbia University und gründete die preisgekrönte Literaturzeitschrift YARN. Sie war viele Jahre Professorin für Creative Writing. Heute lebt sie mit Tochter und Hund in einem grünen Vorort westlich von Boston und widmet sich ganz der Schriftstellerei.
Doppelleben und vergessene Namen
Alter Wein in neuen Schläuchen muss ja nicht schlecht schmecken. Neuer in alten auch nicht. In der Literatur ist das Umfüllen tausendfach erprobt – es kommt eben darauf an. Dem Schweizer Alain Claude
Sulzer gelingt in seinem Roman „Doppelleben“ die Probe aufs Exempel: Er füllt gleich mehrfach Altes in einen neuen Roman. Im Mittelpunkt stehen die Brüder Edmond und Jules Goncourt. Ohne den vom
älteren der beiden Brüder gestifteten wichtigsten französischen Literaturpreis, wäre der Name heute wohl eher vergessen. So aber lebt er fort – doppelt, oder gar ewig?
Den Lebensausschnitt, den Sulzer teils biografisch, teils fiktional wiederbelebt, entnimmt er weitgehend den Tagebüchern, die zunächst von beiden Brüdern minutiös aufgezeichnet, nach dem Tode von
Jules, von Edmond allein verfasst wurden. Die gehören und sind als Quellen und literarisch wertvolle Zeitzeugnisse des Second Empire unter Napoleon III. zum erweiterten Kanon der Weltliteratur.
Sulzer nimmt sein Publikum mit zu Prinzessin Mathilde, der Cousine das Kaisers. In ihrem Salon trafen die Goncourts auf Flaubert, Mérimeée, vor seiner Verbannung auch auf Zola – die literarische Welt
eben. Auch das Ende des Salons nach der Niederlage Napoléons III. in der Schlacht bei Sedan im Jahre 1870 und dessen Internierung auf Schloss Wilhelmhöhe in Kassel rekonstruiert Sulzer aus den
Goncourt5-Tagebüchern.
Zwei Hauptthemen aus diesen Tagebüchern beschäftigen Sulzer in seinem Roman: Die Krankheit und das Sterben des acht Jahre jüngeren Goncourt. Jules hatte sich mit 20 Jahren an Syphilis angesteckt und
verfiel dieser damals in Paris wohlbekannten Krankheit immer mehr. Edmond hielt trotz aller untrüglichen Symptome die Syphilis für unschicklich für einen Goncourt und führte dessen für alle
sichtbaren Verfall auf seine Überarbeitung beim Ringen um die beste Formulierung in den gemeinsamen Texten zurück. Seinen Bruder Jules hielt Edmond für den Begabteren von ihnen beiden.
Im zweiten Brennpunkt steht die über ein Vierteljahrhundert bei den Goncourts dienende Haushälterin Rose. Sie hatte Jules in dessen Kindheit behütet, hatte Edmond gegenüber dessen Mutter gedeckt,
wenn sie ihr gegenüber verheimlichte, dass der Heranwachsende erst spätnachts nach Hause gekommen war. Sie wurde die treue, verschwiegene und bis auf ihre lamentablen Kochkünste perfekte
Haushälterin. Sie war diskret, zuverlässig, ehrlich und ergeben. Nach ihrem sich länger abzeichnenden Tod erfuhren die Brüder eine ihnen unwahrscheinlich vorkommende zweite Wahrheit über Rose: Sie
war in einen sie ausnutzenden Mann verliebt, dem sie immer wieder Geld zusteckte, das sie erspart hatte. Als das nicht reichte, lieh sie sich für ihn das was fehlte. Ein Kind, das sie von ihm bekam,
starb bei einer Amme. Nichts hatten die Goncourts von alledem bemerkt und erfuhren es erst nach Roses Tod. Als Schriftsteller ließen sie sie in ihrem gemeinsam verfassten Roman „Germinie Lacerteux“
weiterleben. Viktor Klemperer verfasste ein schönes Nachwort zu der letzten deutschen Übersetzung, die 1951 in Leipzig erschien. Dieser Roman ist neben den Tagebüchern der Goncourts die zweite Quelle
für das „Doppelleben“ von Alain Claude Sulzer. Er verschafft damit dieser Biographie der Goncourts über ihre Haushälterin Rose zu einem Nachleben und verdichtet es in seiner eleganten, in manchen
Metaphern etwas überanstrengten Prosa zu dem eigentlichen doppelten Leben.
Bei aller Kunstfertigkeit dieses doppelten „Doppellebens“ von Alain Claude Sulzer dürften die Leserinnen und Leser doch bedauern, dass es keine moderne Ausgabe der „Germinie Lacerteux“ der Brüder
Goncourt gibt, die die naturalistische Feinheit des Originals für heute rettete. Dann könnte man den alten neben dem neuen Wein verkosten.
Harald Loch
Alain Claude Sulzer: Doppelleben Roman
Galiani Berlin, 2022 195 Seiten 23 Euro
Selbsterfüllung beim Schreiben
Die sieben Hefte eines Tagebuchs werden in den Jahren 1978/79 in Algier von einer Französin geschrieben, die mit Brahim, einem Algerier verheiratet ist. Sie ergeben den Roman „Erfüllung“ von Nina Bouraoui. Sie handeln von den wachsenden Schwierigkeiten, als Angehörige der ehemaligen Kolonialmacht in einem Land, das die Grauen des Befreiungskampfes nicht vergessen kann. Die Tagebuchschreiberin Michèle Akli flieht aus der Liebe zu ihrem Mann in die Mutterliebe zu ihrem zehnjährigen Sohn Erwan, in die Liebe zu ihrem üppigen Garten rund um ihre gefährdete Villa, flieht auch in die Vorstellung von einer Liebe zu einer ebenfalls mit einem Algerier verheirateten Französin. Michèle ist unsicher, nicht nur wegen der drohenden fundamentalistischen Gewalt im Land.
Sie findet ihr Selbstbewusstsein nur noch in ihrem Garten und beim Schreiben in ihre Hefte. Plötzlich taucht ihr Sohn in der Schule mit einem Freund auf, der sich als ebenfalls zehnjähriges Mädchen entpuppt, die sich „Bruce“ nennt. Dieser androgyne Vulkan wird zur temperamentvollen Gespielin von Erwan. Bedroht sie dessen Entwicklung noch vor der Pubertät? Michèle ist eifersüchtig auf Bruce, beginnt sie, fasziniert von ihr, zu hassen. Sie lernt ihre Mutter Catherine kennen, deren reicher algerischer Mann weltweit als Erdölfachmann tätig ist, mit ihm und Bruce im festungsmäßigen Shell-Gebäude Algiers wohnt. Sie ist die andere Frau, die betörend gut aussieht, ihren meist abwesenden Mann mit anderen Männern hintergeht, sich in Algier dominant überall durchsetzt. Michèle ist fasziniert und zugleich abgestoßen von ihr. Sie stellt sich eine körperliche Beziehung zu ihr vor, die sie sogleich verwirft – Catherine liebt nur Männer.
Die Familien kommen sich durch die wilde Freundschaft zwischen Erwan und Buce näher. Sie laden sich gegenseitig ein. Dabei fallen zwei markante Sätze: Michèle schnappt in der Wohnung von Catherine
deren Bemerkung über sie gegenüber anderen Gästen auf: „Sie ist durcheinander aber entzückend“. Das trifft nicht nur zu, sondern auch Michèles Selbstwert. Ein anderes Mal fahren beide Familien an den
Strand. Ein Mann ertrinkt, der Rettungsversuch des Mannes von Catherine scheitert, der Ertrunkene war nicht zu retten. Da entfährt Michèles Mann Brahim das fatale Wort: „Ein Araber weniger“. Sein
Selbsthass auf das eigene Land. Eiszeit. Es stimmt, was Michèle in eines ihrer Hefte einträgt. Es rechtfertigt auch, dass der Roman keine Lösung anbietet: „Brahim spielt in meinen Plänen keine Rolle,
er steht im Abseits. Er und ich, der Algerier und die Französin, wir setzen die gescheiterte Geschichte unserer Länder fort, und ich weiß, dass nach uns diese erkaltete Leidenschaft von Jahrhundert
zu Jahrhundert andauern wird. Niemand vermag über eine Besitzergreifung hinwegzukommen.“ Nina Bouraoui weiß, wovon sie schreibt. Sie ist zu der erzählten Zeit in Rennes geboren, Kind einer
bretonischen Mutter und eines algerischen Vaters. Sie hat in ihrer Jugend länger in Algerien gelebt, jetzt wieder in Paris. Sie ist eine mit renommierten Preisen ausgezeichnete, erfolgreiche
französische Schriftstellerin. Sie schreibt in klaren Worten auch über manchmal unausgegorene Gedanken ihrer Protagonistin, sie verwendet starke Metaphern für die betörende algerische Landschaft. Die
Sinnlichkeit in den Fantasien Michèles fängt sie zart, eher tastend ein. Ihre Dialoge gelingen. Nina Bouraoui schreibt über unmögliche Lieben in einem Land, in dem es vielleicht nicht möglich ist,
dass eine Französin und ein Algerier sich - oder überhaupt - lieben.
Harald Loch
Nina Bouraoui: Erfüllung Roman
Aus dem Französischen von Nathalie Rouanet
Elster & Salis, Zürich 2022 226 Seiten 24 Euro
Karine Tuil: „Diese eine Entscheidung
Vertrauen ist die Grundlage unserer Zivilisation, Vorsicht und Misstrauen sind unverzichtbare Pfeiler von innerer Sicherheit. Darum geht es in Karine Tuils Roman „Diese eine Entscheidung“. Er spielt im französischen Sicherheitsmilieu um die Ermittlungsrichterin Alma Revel in der Abteilung Terrorismusbekämpfung. Ein brisanter Fall steht an: Der in Algier geborene Abdeljalil Kacem ist nach einem Aufenthalt in Syrien wieder nach Frankreich zurückgekehrt. Hatte er sich dort dem „Islamischen Staat“ angeschlossen? Wird er in Frankreich Attentate verüben? Kann man ihm glauben, wenn er allem, außer seinem Gott abschwört? Alma Ravel befragt Kacem wiederholt, um ihre Entscheidung über die Fortdauer der Untersuchungshaft vorzubereiten. In diesen Dialogen stellt Karine Tuil das ganze Dilemma der Glaubwürdigkeit eines Beschuldigten vor. Karine Tuil weiß, wovon die schreibt. Bevor sie endgültig Schriftstellerin wurde, hat sie in Paris auf Bitten ihrer Eltern, aus Tunesien eingewanderter Juden, Jura studiert.
Als Autorin mischt sie sich in der Tradition französischer Intellektuellen in die Tagespolitik ein. Den Grundwerten der Französischen Revolution fühlt sie sich verpflichtet. In diesem, von Maja Ueberle-Pfaff treffend übersetzten Roman geht es um die prekäre Sicherheitslage nach zahlreichen Anschlägen. Die Sicherheitsbehörden aber auch der Rechtsstaat sind herausgefordert.
Alma lebt von ihrem jüdischen Mann getrennt, der nach einem preisgekrönten Roman nichts Nennenswertes mehr geschrieben hat. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Sie selbst ist nicht religiös gebunden,
leidet aber unter der zunehmend orthodoxen jüdischen Haltung ihres Mannes. Sie ist ganz von ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit erfüllt, ist überarbeitet. Emmanuel Forest, der glänzende Verteidiger
von Kacem sucht sie in ihrem Büro auf, um die Freilassung seines Mandanten zu bewirken. Ihm trägt Alma ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit Kacems vor. Sein Verteidiger erinnert aus einer politisch
linken Perspektive an die republikanischen und rechtsstaatlichen Grundsätze, die auch ihre richterliche Entscheidung leiten sollten. Das Unerlaubte passiert – beide verlieben sich ineinander, können
ihr Privatleben und ihre widerstreitenden Berufe nicht mehr gut auseinanderhalten. Die Entscheidung, zu der sich Alma zusammen mit einem Kollegen durchringt, lautet auf Freilassung mit elektronischer
Fußfessel – gewagt! Aber das Vertrauen und die Freiheit eines Unschuldigen haben Vorrang vor allen Zweifeln und Sicherheitsbedenken. Diese eine Entscheidung war falsch. Schon kurz nach der
Freilassung deaktiviert Kacem die elektronische Fußfessel, besorgt sich eine Kalaschnikow und richtet in einem angesagten Club ein Blutbad an. Dabei kommt auch der muslimische Verlobte der Tochter
Almas um. Sie übernimmt die Verantwortung und quittiert den Dienst in der Abteilung Terrorismusbekämpfung.
Dieser Hochspannungsroman führt noch auf einige Nebengleise, die sämtlich ebenso sorgfältig durchgearbeitet sind wie der Hauptstrang. In diesem steht die Suche nach der Wahrheit, nach der
Wahrhaftigkeit und nach der richtigen Entscheidung im Mittelpunkt. Alle denkbaren Aspekte dieses Dilemmas stehen im literarischen Diskurs dieses Romans, der auch die „unmögliche“ Liebe zu ihrem
zweifelhaften Recht kommen lässt. Er hat viel Fracht und transportiert sie, ohne seine Leserinnen und Leser zu hetzen. Er strapaziert sie schon mit den schrecklichen Bildern und Folgen des Blutbades
genug, mit den unerhörten und obszönen Worten Kacems, dessen Kreide in der Stimme bei den vorbereitenden Vernehmungen noch verlogen nachklingt. In einem Pariser Interview vor fünf Jahren beschrieb
Karine Tuil ihre Arbeitsweise wie folgt: „An meinen Romanen arbeite ich wie eine Architektin. Erst erarbeite ich mir einen Überblick über die Problemfelder, dann spreche ich mit den Menschen aus den
Milieus, erst dann entwerfe ich das Gebäude der Handlung und die einzelnen Personen des Romans. Meine Figuren sind frei erfundene, eigene, fiktionale Geschöpfe. Aber die Romanwirklichkeit, in der sie
einander begegnen, bildet die Welt in schonungslosem Realismus ab.“ So ist sie auch in diesem Roman vorgegangen. Das macht die unerhörte literarische Wucht aus, die „Diese eine Entscheidung“
auszeichnet.
Harald Loch
Karine Tuil: „Diese eine Entscheidung“ Roman
Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff
Dtv, München 2022 351 Seiten 23 Euro
George Saunders: Bei Regen in einem Teich schwimmen Von den russischen Meistern lesen, schreiben und leben lernen
Im gemischten Doppel zu einem außergewöhnlichen Lesegenuss: „Bei Regen in einem Teich schwimmen“ lautet der etwas hermetische Titel des Buches von Georges Saunders, das gleich zweifach erfreut. Es enthält sieben klassische Kurzgeschichten der russischen Meister Tschechow, Turgenjew, Tolstoi und Gogol in bewährten deutschen Übersetzungen.
Das ist eine erlesene Anthologie, bestechend ausgewählt und fehlt in keiner gut sortierten Hausbibliothek – also nichts Neues, doch etwas ganz Kostbares. Das ist aber nicht alles. Georges Saunders
unterrichtet seit über zwanzig Jahren an der Syracuse University (NY) Creative Writing und bespricht mit seinen Studenten der master class diese sieben Kurzgeschichten. Sein jetzt von Frank Heibert
gekonnt übersetztes Buch fasst diese Lehrtätigkeit überzeugend zu dem zweiten Lesegenuss zusammen – Interpretations-Übungen für angehende Autoren. Was zum Schreiben taugt, ist erst recht für das
Lesen-Lernen auf hohem Niveau geeignet – ein literarisches und intellektuelles Vergnügen. Der 1958 in Texas geborene Saunders bringt dafür ganz ungewöhnliche Voraussetzungen mit: Er hat zunächst
Ingenieurwesen im Fach Geophysik studiert und auch in diesem Beruf gearbeitet – bodenständiger geht es nicht. Später fing er an zu schreiben und ist ein erfolgreicher Autor, der 2017 den britischen
Man Booker Prize gewann.
Die ausgewählten russischen Geschichten haben es ihm angetan. Er liest sie nicht unkritisch, nimmt sie Satz für Satz auseinander und baut mögliche Interpretationen darauf auf. Das liest sich bei ihm
aufregend, plausibel und unterhaltsam. Seine Studenten kann man nur beneiden. Den Titel des Buches entnimmt er einer Schlüsselszene aus Anton Tschechows Erzählung „Stachelbeeren“. Am Ende seiner 28
Seiten umfassenden Gedanken zu dieser Erzählung von 14 Seiten steht dann der Satz „Deshalb funktioniert Literatur“. Tatsächlich? Lesen Sie selbst! Am Ende seiner Gedanken zu Turgenjews großartigen
Erzählung „Die Sänger“ gibt er seinen Studenten eine Empfehlung: „…Die Leserin ist da draußen, und sie ist real. Sie interessiert sich für das Leben, und indem sie zu einem Werk von uns greift, gibt
sie uns einen Vertrauensvorschuss. Wir müssen sie nur in Bann schlagen. Und um sie in Bann zu schlagen, müssen wir sie nur ernst nehmen.“ Übersetzt an die Leserin heißt das: „Nehmen Sie den Autor
ernst!“ Das fällt ja vielleicht bei der Lektüre von Gogols „Die Nase“ nicht ganz leicht.
Ein Barbier findet morgens im Brotteig seiner Frau die Nase eines Kollegienassessors, der sie vermisst. Den Beitrag zu diesem Klassiker überschreibt Saunders: „Die Tür zur Wahrhaftigkeit könnte das Merkwürdige sein.“ Da ist der Ingenieur in Saunders herausgefordert. Was macht er? Dasselbe wie Gogol, er gesteht: „erst jetzt, unter Erwägung aller Umstände – sagt der Erzähler - sehen wir, dass die Erzählung vielerlei Unwahrscheinlichkeiten enthält.“ Von Leo Tolstoi stehen zwei Geschichten im Buch: „Herr und Knecht“ und „Aljoscha der Topf“. Das Rätselhafte dieses Titelhelden bleibt unaufgelöst, weil Tolstoi es nicht auflösen will: „Jedes Mal, wenn ich „Aljoscha der Topf“ lese, versetzt mich das in diesen Zustand des Fragens, des Wunderns. Und ich bekomme nie eine Antwort, außer: ‚Wundere dich weiter.‘ Und das, finde ich, ist eine echte Leistung.“ Den Anfang des Buches macht Tschechows „Auf dem Wagen“, die Geschichte von Marijas Einsamkeit. Zu dieser nicht besonderen Grundschullehrerin in der russischen Provinz, entwickelt die Leserin, der Leser eine vielleicht lebenslange Zuneigung: „wir können Marija Einsamkeit jetzt voll und ganz spüren. So als wäre es unsere eigene…“
Zum Schluss noch ein Bekenntnis des Autors über das, was er in aller Welt bei Tausenden begeisterter Leserinnen und Lesern kenngelernt hat: „Ihre Leidenschaft für die Literatur hat mich davon
überzeugt, dass die Welt über ein weitgespanntes Untergrundnetz für gutes Handeln verfügt: ein Gewebe aus Menschen, die das Lesen in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben, weil sie aus
Erfahrung wissen, dass das Lesen sie zu offeneren, großzügigeren Menschen macht – und das Leben interessanter.“
Harald Loch
George Saunders: Bei Regen in einem Teich schwimmen
Von den russischen Meistern lesen, schreiben und leben lernen
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Luchterhand, München 2022 544 Seiten 24 Euro
Liebe in Zeiten der Diktatur
Liebe in Zeiten der Diktatur. „In guten Zeiten heiraten junge Frauen aus Liebe, in schlechten Zeiten aus Interesse. Ich heiratete in der schlimmsten aller Zeiten wegen zwei
Vervielfältigungsmaschinen, die kein Mensch bedienen konnte.“ So leitet die Titelheldin Manolita Perales Garcías die Erzählung über ihre drei Hochzeiten ein. Sie war 18 Jahre alt, der Spanische
Bürgerkrieg war mit dem Sieg Francos zu Ende gegangen. Seine blutige Diktatur forderte zahllose Opfer und den Widerstand heraus. Manolita mischt sich nicht in die unübersichtliche Politik ein. Ihr
Bruder Toñito, „der Schöne“, ist als Sozialist untergetaucht, um seiner Verfolgung zu entgehen. Er versteckt sich in der Garderobe der Tänzerinnen einer Flamenco-Bar in Madrid. Die beschützen ihn.
„In einer Stadt, in der jeder seine Mutter für einen Apfel und ein Ei verkauft hätte, erwiesen sich diese Frauen, deren Ruf mehr als zweifelhaft war, als so unverwüstlich loyal, dass sie meinen
Bruder in eine Fata Morgana hüllten“, erinnert sich Manolita. Toñito bewegt seine Schwester, eine Scheinehe mit dem inhaftierten Genossen Manitas einzugehen, um sich von ihm die Bedienung von
Druckmaschinen erklären zu lassen, die im Untergrund gebraucht werden. Vor einem bestochenen Geistlichen wird diese Ehe im Gefängnis geschlossen. Almudena Grandes, (1960 -2021) hat diesen sehr
spanischen Roman mit viel Empathie für den republikanischen Widerstand geschrieben. Die späte, erst viele Jahre nach Francos Tod erfolgte Anerkennung der Widerstandskämpfer hat sie bewogen, dieses
Buch zu schreiben. Es gelingt ihr, mit feinen literarischen Mitteln eine schlimme Wirklichkeit in den ebenso unschuldigen wie klugen Worten der jungen Manolita heraufzubeschwören. Alle Figuren sind
Menschen aus dem spanischen Volk. Stille Helden sind dabei, Mitläufer, Wendehälse, Verräter. In dieser Zeit wurde nicht gegen Windmühlen gekämpft, sondern gegen die blutige Diktatur Francos. Erst
nach dessen Tod – manch Verräter oder Folterer war inzwischen von der zaghaften Demokratie geehrt worden - heiraten Manolita und Manitas, der inzwischen 60 Jahre alt geworden ist, zum dritten Mal –
diesmal aus Liebe.
Dazwischen liegt ein großer Roman über eine schreckliche Zeit. Dazwischen liegt eine zweite Eheschließung der beiden. Dazwischen liegt das Bekenntnis einer der wichtigsten spanischen Autorinnen zur
Freiheit, zu Demokratie und zu den Idealen der republikanischen Bürgerkriegskämpfer. Mögen sie während des Krieges untereinander zerstritten gewesen sein, Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten usw.
In der Zeit der Diktatur wäre das tödlich gewesen: „Wenn wir Franco zum Teufel gejagt haben, werden wir uns wieder in den Haaren liegen. Aber bis es soweit ist, halten wir zusammen“, sagt Toñito
einmal zu seiner Schwester. Die ist eine Protagonistin, mit der man sich sofort verbündet. Sie ist weder besonders attraktiv oder besonders aktiv. “Zählt nicht auf mich“, sagt sie den Genossen, die
sie zu einem Beitritt auffordern. Das wird ihr Spitzname für einige Zeit. Die jungen Männer leben ihren revolutionären Überschwang. Für sie zählen nur diejenigen, auf die man zählen kann. Trotzdem:
Manolita hat eine selbstverständliche, sehr schöne Gewissheit davon, was richtig und gut ist. Und die Autorin lässt sie das so natürlich ausdrücken, und ebenso natürlich auch so handeln, dass auf sie
wirklich zu zählen war. Keine raffinierte oder elegante Oberfläche verdeckt in diesem Roman die einfach erzählende Sprache, die Almudena Grandes für diesen bekennenden Roman gefunden hat, die
Manolita so natürlich im Munde führt und die alle gern lesen.
Harald Loch
Almudena Grandes: „Die drei Hochzeiten von Manolita“ Roman
Aus dem Spanischen von Roberto de Hollanda
Hanser, München 2022 672 Seiten 30 Euro
Die Jagd - in Russland - das Schreckliche
Sasha Filipenko diagnostiziert flächendeckend Persönlichkeitsspaltungen in seinem Land: „Iwan der Schreckliche “ kann zum Herzblatt werden und Priester weihen Ikonen, Putin kommt noch nicht vor, aber
man möchte jetzt schreiben und Putin bombardiert Kinder. „Wladimir der Schreckliche“!
Das alles ist Russland. Die dunkle Seite der Macht heißt heute Menschen ausschalten. Früher waren die alten Methoden Verhöre im Keller, Druck ausüben, geheimdienstliche Unterredungen beginnen, heute
geht es brutaler zu: LKW in die Kreuzung stellen, Kugel in den Kopf, Gift ins Essen, Stürze aus dem Fenster nach Verhören, Medienberichte mit kompromittierendem Material einsetzen, Strafverfahren
anzetteln und Hasskommentare ins Netz stellen.
Zum Personal des Romans: Ein Journalist weiß wie immer was Wichtiges und Zuviel, ein Sohn gerät in Konflikt mit dem Vater und ein böser Oligarch, der sein gescheffeltes Geld ins Ausland transferiert
und dessen Familie sich gerne an der Côte d’Azur sonnt. „Ich erzähle die Geschichte eines Journalisten und will zeigen, wie in Russland die Pressefreiheit zerstört wird, wie man Reporter fertigmacht.
Da gibt es in autoritären Systemen wie Russland oder Belarus nicht nur den Mord, sondern viele Vorstufen. Immer wenn Journalisten attackiert werden, dann geht es meist nicht nur um sie selbst,
sondern das hat oft auch große Auswirkungen auf ihr familiäres Umfeld. Das erfahre ich gerade auch selbst.“
Filipenkos Enthüllungsthriller macht den Autor selbst zum Gejagten, der ständig seine Wohnsitze ändern muss, um sich der eventuellen Revanche des Systems zu entziehen. Eingangs ist die musikalische
Form einer Sonate als Textformat und die Personenmatrix etwas schwerer zu durchschauen und verlangt Durchhaltevermögen, aber das Klima der Angst, die Vertikale der Macht, der Umgang mit Fakenews,
Drohung, Einschüchterung, den Gegner mürbe machen, diese Mechanismen der Zerstörung von oben sind listig eingefangen und plausibel dargestellt.
„Dafür kannst du sicher sein, dass du in Russland bist. Du siehst diese Schnauzen und weißt sofort – willkommen in der Großmacht.“
Die Jahre laufen normal wie immer. Diplomaten unterzeichnen sinnlose Abkommen, Fußballer schießen entscheidende Tore, Männer betrügen Frauen, und der rote Kaviar wird billiger. Willkommen im Russland
heutiger Tage.
Derart realistisch beschreibt Filipenko in russischer Sprache sein Nachbarland Russland, denn er selbst kommt ja aus Belarus und sieht das Land Lukaschenkos als Diktatur-Testregion, wo alles zuerst
ausprobiert wird und dann in Russland folgt. Filipenko wird für folgende Romane keinen Themenmangel haben.
Sasha Filipenko, geboren 1984 in Minsk, ist ein belarussischer Schriftsteller, der auf Russisch schreibt. Nach einer abgebrochenen klassischen Musikausbildung
studierte er Literatur in St. Petersburg und arbeitete als Journalist, Drehbuchautor, Gag-Schreiber für eine Satireshow und als Fernsehmoderator. Sasha Filipenko ist leidenschaftlicher Fußballfan und
wohnte bis 2020 in St. Petersburg. Er hat Russland verlassen und hält sich derzeit an wechselnden Wohnorten in Westeuropa auf.
Saha Filipenko Die Jagd Diogenes
Der Verlust von Heimat, Sprache, Identität
Wir wissen einfach zu wenig über das große weite Land Kanada und seine Vergangenheit. „Kukum“ ist ein nur 211 Seiten langer Roman, der jedoch einige umfassende Anmerkungen im Fließtext braucht, um den Leser in die geographische Region und in die Vergangenheit der indigenen Bevölkerung einzuführen. Das ist fürs Lesen etwas bremsend, aber fürs Wissen und Verstehen schließlich unabdingbar.
Es geht also um die INNU, die autochthone, eingeborene, einheimische Bevölkerung in der Wildnis Kanadas. Wir lernen dieses Volk, seine Ur-Sprache und seine wilde ursprüngliche Heimat kennen durch die
Lebensgeschichte der Almanda Siméon. Sie ist die Urgroßmutter des Autors Michel Jean, der uns in kurzen, prägnanten Sätzen mit seinen Vorfahren nach Kanada entführt.
Almanda Simeon heiratet früh und zieht beherzt in die Wildnis zu den Nomaden, die an den wilden Flüssen fischen und jagen und die vagabundieren, ortsfest nur kurzzeitig leben, weit wandern, dorthin,
wo die ertragreichen Fisch- und Jagdgründe das Überleben vor allem im harten Winter garantieren.
Zur Geografie: Die Handlung spielt in Mashteuiatsh, früher auch Pointe-Bleue genannt. Es handelt sich dabei um die kanadische Provinz Québec, am Westufer des riesig großen Lac Saint-Jean
gelegen.
Almanda lächelte viel, war erlebnishungrig, lernbegierig, neugierig und liebte Kinder, Enkel und Urenkel, vor allem aber ihren Mann Thomas. So zeichnet Jean seine Urgroßmutter.
Sein Roman ist ihr Lebensroman, ist zugleich die Ur-Geschichte Kanadas, ihre Lebensgeschichte. Aber sie ist auch eine Erzählung von Gegensätzen, von der Vergangenheit der Innu, der Welt von Gestern
und der sie bedrohenden Zukunft, die intensive Waldabholzung und brutale Energiegewinnung durch Wasserkraft bedeutet.
Das Buch zeigt schonungslos, ohne anklagend zu werden, den Gegensatz von gelebter Tradition, etwa des Jagens und Fischens in wilder Naturlandschaft, und dem gegensätzlichen Fortschritt, der
angelegten Eisenbahngeleise, die Dörfer brutal trennen, des Autoverkehrs, der reihenweise Kinder tötet, und der Entwurzelung der Innu-Kinder, die in Internaten zwanghaft - den Eltern entzogen -
um-erzogen werden.
Natur und Technik stehen sich feindlich, unversöhnlich gegenüber, die althergebrachten Ansprüche des Individuums und seiner Selbstverwirklichung (Fischen und Jagen ohne gesetzliche Grundlagen, da
leben, wo man eben gerade hinkommt) und den konträren gesellschaftlichen Anforderungen (fremde Sprache lernen, Kinder und Schulzwang, Internatserziehung). Konkret bedeutet das dann zum Beispiel,
Papierfabriken haben „den Wald geschluckt“ und Staudämme die „ungestümen Wasserfälle“.
Der Gegensatz passiv - aktiv zeigt an, wie Männer dem Alkohol verfallen, weil sie keinen Arbeitsplatz mehr finden, antriebslos werden, und dagegen aktive Frauen, die den Ministerpräsidenten
anspornen, um an Bürgersteige im Dorf zu kommen.
Der lesenswerte Roman ist ein ständiges Erinnern und Vergessen der verlorenen Sesshaftigkeit und der Vertreibung eines einheimischen Volkes aus dem Paradies durch die zivilisatorische
Entwicklung.
Wir erleben den Gegensatz von Wald und Welt mit. Und im Hintergrund steht die alte-immer-neue Frage nach der Identität, eben die eigentliche, wo man herkommt, und auch, wo man hingeht. Im Roman
buchstäblich, in Wirklichkeit ein Fortgehen aus dem Freisein.
Die Umerziehungsmaßnahmen, der Verlust von eigener Sprache und die Aneignung des fremden Französischen kommen ebenso vor wie der sexuelle Missbrauch von Kindern in Klöstern, der allerdings nur am
Rande erwähnt wird. Die schlimmsten Fälle von Missbrauch in Kinderheimen waren zum Zeitpunkt des Entstehen des Romans noch unbekannt.
Almanda Siméon sieht ihre Heimat als eine „… Art Atlantis der Innu, (es) existiert dieser Ort nur noch in der Erinnerung der Alten wie ich und wird mit uns endgültig verschwinden. Bald. So wie es
auch die Portagewege nicht mehr geben wird, die Generationen von Nomaden geduldig angelegt haben. All dieses Wissen wird aus den Gedächtnissen verschwinden, in denen es noch lebendig ist“.
Die „Portagewege“ sind jene Pfade, die benutzt wurden, um die Boote an den Stellen am Ufer voranzutragen, wo die Gefährlichkeit der reißenden Flüsse eine Kanufahrt einfach nicht zuließen. So
verschwinden die Wege, die ein Fortschreiten möglich machten.
Ein seltsamer Widerspruch, der im Wort Fort-schritt steckt. Für die Innu bedeutete das Vorangehen in der Fortschritts-Zeit ein Stehenbleiben, früher waren sie als Nomaden mobil unterwegs. Jetzt, zur
Ansässigkeit gezwungen, an einem Ort zwanghaft verwurzelt. Das Ende von Freiheit. Eine berührende, packende, melancholische Erzählung über Herkunft und Zukunft. Und über Verlustängste.
„Aber unser Territorium jenseits des Sees existiert nur noch in unseren Herzen. Eines Tages werden wir es wiederfinden.“
Michel Jean KUKUM Wieser Verlag Klagenfurt
Den Schlaf begreifen und erforschen
Jo Lendle, der erfolgreiche Verleger-Autor des renommierten HANSER-Verlages, sagt in einem Interview zu seinem neusten Werk: „Es ist auch ein Buch über die Erinnerung. Wie konstruieren wir unsere
Überlieferungen? Welche Geschichten werden weitererzählt? Welche nicht? Das kennt jede Familie.“ Und die Leser auch.
Es sind zwei immer wiederkehrende Themen der Buchbranche, was ist in der eigenen Familie geschehen, über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg? Und wie haben sich die Verwandten in einer
bestimmten Epoche, zum Beispiel im Nationalsozialismus, verhalten?
Da könnte man meinen, da wird wieder allzu Bekanntes aufgetischt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Jo Lendle schreibt die Geschichte seiner eigenen Familie als Fiction. Es gelingt ihm ein spannendes
Buch, das thematisch vier Epochen umfasst: das Kaiserreich, den Nationalsozialismus, die DDR und die Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Einen solchen weit historischen Spannungsbogen zu ziehen, das
muss man können, denn der Zeitrahmen kann leicht überspannt werden. Jo Lendle gelingt es hervorragend, die Zeitläufte dicht auf dicht Revue passieren zu lassen.
Großonkel Lud Lendle ist die eine Hauptfigur. Sie interessiert sich als Forscher für den Schlaf und das Gift. „Wir sind nichts als ein verschwommener Traum. Was wir Leben nennen, ist der Schlaf des
Schlafs.“
Im Krieg beschäftigt er sich dann mit Kampfstoffforschung, lässt sich von den Nazis jedoch trotz Angeboten wenig vereinnahmen: „Lehne Hitler nicht allein aus protestantischen Gründen ab.“
Die Gegenperson, Bruder Heinrich, ist dagegen bei den Nationalsozialisten aktiv, während Lud sich also verweigert.
Jo Lendle spielte schon als Kind mit den Tagebüchern seines Patenonkels und machte sie nach zehnjähriger Arbeit daran zur Grundlage und Quelle für seinen Familienroman.
Zur „ART FAMILIE“ gehört auch Alma, eine Vollwaise, die mit Lud zusammen lebt, eine nähere Beziehung zu ihm erwartet, jedoch zeitlebens von ihm enttäuscht wird. Sie bleibt bloß seine Lebensfreundin
und Begleiterin, wird nicht seine Geliebte oder gar Frau. Luds homoerotische Zuneigung bleibt im Geheimen, in Tagebüchern versteckt. Sie gilt einem Kriegskameraden aus dem Ersten Weltkrieg.
Homosexualität stand damals noch unter Strafe.
Dieser Strang der Geschichte bleibt ebenso vage wie auch das Leben und Wirken des Bruders Heinrich eigentlich nicht im Zentrum steht. Vielmehr liegt bei Ludwig Lendle der Focus der Geschichte, dessen
wissenschaftliche Arbeit nach und nach zum Hauptthema wird.
Wie hängen Narkose, Schlaf und Betäubung durch Gift oder gar Töten wissenschaftlich zusammen. Lendle macht dazu Tierexperimente und Selbstversuche auch am eigenen Körper. Das ist lebenslanges Thema
von Ludwig Lendle. Natürlich interessieren sich die Nazis für seine Forschung, doch Lendle wehrt sich gegen den Missbrauch seiner wissenschaftlichen Ergebnisse: „An der Zukunft der Deutschen Nation
von Hitlers Gnaden mitzuwirken, das wird mir nicht möglich sein.“ So notiert es des Verlegers Großonkel ins Tagebuch. Lendle schweigt und tritt nicht in die Partei ein.
Sein wissenschaftliches Ziel ist es:
„Den Schlaf begreifen.
Den Schlaf erzeugen.
Den Schlaf verbessern.“
… „‘Fledermäuse schlafen zwanzig Stunden am Tag. Delfine,
Wale und Vögel können mit einer Hirnhälfte schlafen. Beim
Fliegen im Schwarm bleibt nur der vorderste Vogel ganz
wach.‘ ‚Manchmal denke ich, mir schläft mein Hirn beim Stricken ein‘, sagte die Gerner“
Sie ist das Hausmädchen in der „Art Familie“.
Dialoge sind rar in diesem Buch. Lendle bevorzugt die knappe Beschreibung der Szenen und Handlung in klaren, klugen, kurzen Sätzen.
Wir lesen einen Roman über eine Familiengeschichte in der Geschichte der deutschen, über das Leben, die Liebe, die Wissenschaft, das Wachsein und die Verschlafenheit im Nationalsozialismus, über
Träume und deren Vergeblichkeit in der Realität und auch am Ende eines Lebens: „Der Tod erinnert uns zu leben. Das ist seine Aufgabe. Eine andere hat er nicht.“
Die RHEINPFALZ schreibt: „Ein wunderbar empfindsamer, elegant und lakonisch geschriebener Roman, dessen dezente Personenzeichnung der Leserschaft viel Gedankenfreiheit lässt. Hier wird deutsche
Geschichte par excellence verhandelt – in jeglicher Hinsicht.“ Genauso ist es.
Jo Lendle Eine Art Familie PENGUIN RANDOM HOUSE
Die Rache ist mein
Wer ist Gilles Principaux für Maître Susane? Diese Frage durchzieht den Roman “Die Rache ist mein“ der 1967 bei Orleans geborenen Marie NDiaye. Wer ist Me Susane? Die eine Frage bleibt
unbeantwortet, die andere mündet in ein Rätsel. Drei Frauen stehen im Mittelpunkt dieses großartigen Romans: Me Susane, das ist ihr Familienname, ihr Vorname spielt keine Rolle, ist eine junge
Rechtsanwältin, die vor kurzem ihre eigene Kanzlei in Bordeaux eröffnet hat. Sie hat sich noch keinen Namen gemacht. „Der Mann, der am 5. Januar 2019 schüchtern, beinahe ein wenig ängstlich ihre
Kanzlei betrat, war Maître Susane, wie sie sofort wusste, schon einmal begegnet, vor langer Zeit…“ Er hieß Gilles Principaux und trug der Anwältin das Mandat an, seine Frau Marlyne zu vertreten.
Deren Name und ihr Fall war in Bordeaux bekannt: Sie hatte gerade ihre drei Kinder in der Badewanne ertränkt. In der Untersuchungshaft wird sie ihrer Anwältin andeuten, wie es zu dieser Tat gekommen
ist und wie sie sie ausgeführt hat. Ihr Mann Gilles liebt sie auf seine Weise so sehr, dass er sich auch nach der Ermordung ihrer gemeinsamen Kinder nicht von ihr abwendet. Er hat sie auf „seine
Weise“ geliebt, so dass sie ihn zu hassen begann, seinem weiteren Leben aber nicht im Wege stehen will. Aber sehen will sie ihn nie wieder. Als Me Susane nach dem ersten Besuch von Gilles Principaux
nach Hause kommt, trifft sie dort ihre Putzfrau Sharon. 40 m² ist ihre Wohnung groß und eigentlich benötigt Me Susane keine Putzfrau. Um ihr keine Arbeit zu machen, erledigt sie den Putz immer schon
vorher. Sie will der aus Mauritius stammenden, ohne Papiere in Bordeaux mit ihrem ebenfalls illegalen Mann und zwei Kindern aus politischem Engagement für die „sans papiers“ helfen, will ihr
gegenüber ein „guter Mensch“ sein.
Zu diesen drei Frauen besetzt Marie NDiaye ihren Roman noch mit wenigen anderen Personen: Die Eltern der Rechtsanwältin spielen mit, ein ehemaliger Anwaltskollege, der seine kleine Tochter in die
Obhut von Sharon gibt und deren Bruder und Schwägerin in Mauritius, wohin sich der Roman für kurze Zeit verlagert.
Im Mittelpunkt steht nicht die ruchlose Tat. Das Plädoyer von Me Susanne wird nur am Schluss kurz angedeutet – ein souveräner literarischer Verzicht auf eine telegene Gerichtsszene. Im Mittelpunkt
steht die in sich und an sich zweifelnde Persönlichkeit der Anwältin. Sie glaubt sich zu erinnern, im Alter von 10 Jahren diesem damals 14-jährigen Gilles Principaux schon einmal begegnet zu sein.
Ihre Mutter hatte vor 32 Jahren als Aushilfe im Hause einer wohlhabenden Familie Wäsche gebügelt und ihre junge Tochter dorthin mitgenommen. In dem großzügigen Haushalt konnte ihre Tochter zwei oder
drei Stunden im Zimmer des Sohnes mit dem Jungen verbringen. Sie war dort sehr glücklich – aber was ist da eigentlich passiert, so dass sie sowohl ihre spätere Berufswahl zurückführt als auch ein
diffuses traumatisches Gefühl daran zurückbehalten hat? Und ist der in ihrer Kanzlei erschienene Gilles Principaux dieser Junge gewesen? Keiner wird es je erfahren.
Me Susanne empfindet anders als sie spricht. Auch im französischen Original sind die Passagen, in denen ihre Empfindungen schonungslos offenbart werden kursiv von denen abgesetzt, in denen sie
ausspricht, was sie nicht empfindet, sondern was sie meint „schuldig“ zu sein. Sie sagt aus falsch verstandenem Takt ihrer Putzfrau Sharon nicht, dass sie sie eigentlich nicht benötigt, sondern ihr
nur helfen will. Aber sie leidet darunter, dass ihr „Geschenk“ nicht auf Gegenliebe stößt. Ihren Eltern spielt sie vor, eine erfolgreiche Anwältin zu sein, um sie nicht traurig zu stimmen usw. Aber
die Autorin baut hier keinen pathologischen Befund auf, sondern erzählt in ihrer wieder von Claudia Kalscheuer hervorragend übersetzten Sprache von den Menschen, die sie erfindet. „Der Titel“, sagt
sie im Gespräch, „soll nicht zu abwegigem Suchen verleiten, er könnte auch anders lauten.“ Manche sehen in dem Buch die „Rache“ der Autorin an dem bourgeoisen Bordeaux mit den Straßennamen für
alteingesessene reiche Familien, die viel Geld als Sklavenhändler verdient haben.
Die teilweise senegalesische Herkunft der Autorin könnte das nahelegen. Eine solche geographische oder historische „Rache“ an Frankreich könnte ja auch in ihrer Übersiedlung nach Berlin liegen, wo sie von 2010 an bis ins vorige Jahr gelebt hat, aus Rache an die Attitude von Sarkozy, der mit einem Kärcher gegen jugendliche Immigranten in den Pariser Vorstädten vorgehen wollte. Die Gewinnerin des Prix Goncourt des Jahres 2009 für den Roman „Drei starke Frauen“ schreibt viel zu gute Literatur, als dass sie solche Rache in oder mit einem Roman ausdrücken würde.
Harald Loch
Marie NDiaye: Die Rache ist mein Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Suhrkamp, Berlin 2021 237 Seiten 22 Euro
Roman über Russland heute: DAFUQ
Klären wir zuerst einen verstörenden Begriff des Buchtitels. Was heißt DAFUQ? Es handelt sich um eine umgangssprachliche Schreibweise von „the f*ck?“, was wiederum eine Abkürzung der Frage „What the f*ck?“ ist, entnehme ich unwissend dem Internetportal giga.de. Man könnte auch freier formulieren: Was zur Hölle ist mit Russland los? Oder auch Putin: „Hä!“. Darin steckt fragend Frust und Zorn.
Anja Romanova ist als 28-jährige Studentin bei einer ungenehmigten Demonstration festgenommen worden. Der Schauplatz und die Handlung hinter Gittern: Sechs Frauen sitzen in einer Gruppenzelle im
Knast, das ist Leben und Schlafen auf Stockbetten, ein einziger langweiliger Raum und die Insassen neun Tage lang festgesetzt.
Der Roman wirkt wie eine Zellen-Sitcom, als wäre es eine TV-Geschichte. Es sind quälende neun Tage im Knast: Zuallererst Langeweile, Duschen ist Luxus, Hofgang ist Abwechslung, Drangsalieren der
Sicherheitskräfte an der Tagesordnung zwischen Vorschrift und blanker Willkür.
Aber wir erleben auch nettere Bullen, die für Putin sind. Die Autorin mischt magische Knastverirrungen mit wilden Phantasien, Mädels, die vom Sex leben, mit Szenen einer Ehe, Tristesse hinter
Gefängnismauern mit Schikanen des Knastpersonals. Ein Polizist gesteht: Habe Putin gewählt, guten Glaubens, habe auf Reformen gewartet, am Ende ist dann doch nur der Name der Partei in EINIGES
RUSSLAND geändert worden. Mit der lobenden Erinnerung an den knallharten Stalin endet der Dialog.
Russland so nah und genau betrachtet und doch so weit von uns existent.
Wir lesen von lesbischen Liebestaumeln, Bettgeschichten mit Männern, zwischen Moskau und Nowosibirsk. Wir hören in Gesprächen von Gefühlen, die im Brustkorb entstehen und körperlich weh
tun.
Einerseits erfahren wir von lesbischen Avancen und andererseits vom erzwungenen Mee-too-Sex in Bürokulissen. Kira Jarmysch schreibt über Blow-Job-Kurse mit Gummidödeln und von Omonleuten, die
Demonstranten mit brutaler Gewalt von der Strasse schleppen.
Ihre regimekritischen Dialoge - die Autorin arbeitet seit 2014 für den prominenten Oppositionspolitiker Nawalny - sind sparsam gesetzt. Etwa so: „Mir gefallen unsere Machthaber nicht.“
Die Amtsräume, die Zellen, die Menschen sind scharf und genauestens beschrieben. In der Zelle nerviges Radiogedröhn, als Psychofolter mit 8oer-Jahre-Gedödel, knarzende Bettkonstruktionen, blinde
Folienspiegel, „Metallstäbe pickten in den Rücken.“ Neun Tage im Leben der Anja Romanowa. Kein Dissidenten-Szenario mit Untergrund-Hintergrund.
Anja kämpft für ein freies Russland und die Rechte der Frauen. Faszinierend die Einblicke ins Auswärtige Amt, wo schon mittags das Trinken beginnt und erzwungener Sex auf dem Sofa
stattfindet.
Anjas Zellengenossinnen sind Konkurrentinnen und eine Solidartruppe zugleich, sie haben Phantasien und Wünsche, kennen Enttäuschungen und Ängste, sind aggressiv und gelangweilt. Wollen Luxus und
sehen sich auch als Körperaktie, weil Männer getune-te Frauen wollen.
Und es geht um Demos gegen die Korruption im Land: „Na, ihr werdet doch für Demos bezahlt.“
„Katja (…) drehte sich um: ‚Wie jetzt, müssen Demonstrationen genehmigt werden?‘ – ‚Ja, eigentlich schon.‘ – ‚Und wogegen hast du demonstriert?‘ – ‚Gegen die Korruption. Gegen die Regierung.‘ – ‚Und
wo muss man das genehmigen lassen?‘ – ‚Beim Bürgermeisteramt.‘ – ‚Das heißt, man muss die Demo gegen die Regierung von der Regierung genehmigen lassen?‘, fragte Katja und stemmte die Arme in die
Hüften. ‚Ich kack ab … Genehmigen die denn überhaupt mal was?‘“
Die Autorin weiß, wovon sie schreibt, vermeidet zu viel konkrete Parallelen zum eigenen Leben, schöpft aus ihrer erzählerischen Kraft und malt ein faszinierendes und verstörendes Großgemälde vom
heutigen Russland in kleiner Kulisse. Ein Kammerspiel.
Fazit: Die Protestbewegung hinter Gittern oder ganz Russland im Knast.
Kira Jarmysch, geboren 1989, studierte Journalistik an der Diplomaten-Kaderschmiede MGIMO in Moskau – ohne Aufnahmeprüfung, da sie Siegerin der landesweiten „Intelligenz-Olympiade“ war. Ihr
hochgelobter Debütroman erschien im Herbst 2020 in einem regimekritischen russischen Verlag. Seit 2014 arbeitet Kira Jarmysch als Pressesprecherin des prominentesten Oppositionspolitikers in
Russland, Alexej Nawalny. Nach Nawalnys Rückkehr nach Moskau im Januar 2021 wurde auch Kira Jarmysch wegen Aufrufs zu Demonstrationen festgenommen.
Pressestimmen
Ganz Russland sitzt im Knast, wie man unschwer zwischen den Zeilen dieses faszinierenden Romans lesen kann. Brigitte
Ein flirrender Roman über das raue Russland von heute. Focus
Kira Jarmysch ist ein einfühlsames, zorniges, oft auch lustiges Portrait der russischen Gesellschaft gelungen. Deutsche Welle
Erschütternd ... Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Kraft dieser verstörend aktuellen Literatur sich über Russland hinaus entfaltet. Tages-Anzeiger
Tragikomisch, dissident und verstörend aktuell ... Ein Buch, in dem Literatur und reale Gegenwart sich aufs Engste verzwirnen ... «DAFUQ» ergänzt die Gegenwartsliteratur um eine aufregende neue
Stimme mit vielen Tonarten – zornig, zärtlich, cool, nachdenklich. Deutschlandfunk "Büchermarkt“
Ein erhellender Roman über das heutige Russland. SWR 2 "Lesenswert"
Als Sprecherin des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny kennt sich Kira Jarmysch im Kampf mit der russischen Justiz gut aus ... Diese Erfahrungen hat sie in einem Roman verarbeitet: «DAFUQ» ist aktueller denn je. dpa
Dieser Roman offenbart nebenbei so vieles, was man über das heutige Russland weiß und nicht weiß, weil er so politisch ist, ohne belehrend sein zu wollen, im besten Sinn des Wortes aus dem Leben.
Und man außerdem richtig laut lachen muss. Lena Gorelik
Ein frappierender Text, eine mitreißende Geschichte wie eine aufregende Erzählung über die Jugend – und eine eindrucksvolle Metapher dafür, was heute in Russland vor sich geht. Galina
Jusefowitsch
Kira Jarmyschs Buch ist umwerfend ... Es lässt teilhaben an dem, was die Frauen von heute wirklich denken und anstreben. Alexej Nawalny
AUDIO
https://www.swr.de/swr2/literatur/kira-jarmysch-dafuq-100.html
Alexander Goldstein: „Aspekte einer geistigen Ehe“
Mit zwanzigjähriger Verspätung gelangt ein beeindruckendes Konvolut literarisch und gedanklich streng gefasster Essays jetzt zum deutschsprachigen Publikum: Alexander Goldsteins „Aspekte einer
geistigen Ehe“. Etwa 50 kurze Prosastücke auf gut 300 Seiten sind beileibe keine „Kleinkunst“ – weit gefehlt: Jedes einzelne ist durchdachte und stilistisch gefeilte Literatur. Der Essayist Goldstein
beeindruckt durch die Vielfalt der Themen, über die er nachdenkt und schreibt.
Er überrascht mit manchem seiner Gedanken, die sein Publikum zum Nachdenken zwingen. Er schleift seine Prosa nicht stromlinienförmig zu leicht zu konsumierender postmoderner Kost, verzichtet auf die elegante Politur, sondern gräbt nach dem treffenden Wort, der weiterführenden Metapher, der den Gedanken erhellenden Syntax. Als ob nicht jede Literatur Versuch wäre, unterscheidet man den Essay (also „Versuch“) von den anderen Prosagenres. Oft wird er auch die unvollendete Art, Gedanken zu formulieren, genannt, als ob nicht jede Philosophie weitergedacht werden könnte, also unvollendet bliebe. Allerdings ist es kein Paradox, dass es zwar unvollendete, aber gelungene, verstörende, auf andere Weise „vollendete“ Essays wie die von Alexander Goldstein gibt.
Der Autor ist 1957 in Estland geboren und in Aserbeidschan aufgewachsen. In Baku hat er studiert und in Literaturwissenschaft promoviert. 1991 wanderte er nach Israel aus und starb mit nur 48 Jahren
an einer Krebserkrankung in Tel Aviv. In Israel arbeitete er für die Zeitung Vesti und für das russisch-israelische Magazin Zerkalo. Dort sind einige der jetzt von Regine Kühn kongenial übersetzten
Essays erschienen. Worum geht es in ihnen? Die Palette seiner Themen ist überwältigend: Er polemisiert gegen die postmoderne Verflachung der Kunst, vor allem
der postsowjetischen Literatur.
Der westlichen konsumierbaren Kultur hält er vor, „weder Samen noch Blut“ zu haben und die Grundfragen der Existenz nicht zu stellen. Er, dessen Pass in der Sowjetunion im „fünften Feld“ die Nationalitäteneintragung „Jude“ trug, setzt sich mit dem Begriff und dem Inhalt von „Nation“ auseinander. Er polemisiert gegen in Israel tätige ausländische Arbeiter aus Asien und differenziert „qualitativ“ auch die Juden in Israel in Ashkenasim und orientalische. In einer längeren Essayfolge bewundert er den japanischen Kaiser-Nationalisten und Umstürzler Yukio Mishima. Dessen physisches und politisches Scheitern hält er für „gelungen“, weil es beweise, dass sein existenzielles Risiko hoch genug gewesen sei. Am anderen Ende der politischen Skala setzt er ein philosophisch begründetes Denkmal für Che Guevara und seine radikal gelebte und gestorbene Hingabe an die Revolution. In dem einzigen erotischen Text der Sammlung bekennt sich der Erzähler zu der eigentlich unmöglichen Liebe zu der russischsprachigen Prostituierten Allotschka aus dem Amüsierviertel von Tel Aviv. Manche Essays haben die Dichte und Aussagekraft von Novellen im kleistschen Sinn und einige Kritiker halten seine Sprache für „Neobarock“, was den elitären Ansatz seiner Sprache unangemessen verniedlicht. Er stellt an sich und an seine Leser hohe Ansprüche und „verfolgt kompromisslos sein ästhetisches Projekt“, wie die an der Humboldt-Universität unterrichtende Literaturwissenschaftlerin und Slawistin Ekaterina Vassilieva in ihrem ausgezeichneten Nachwort befindet.
Alexander Goldsteins Essays stammen von einem hochgebildeten „Grenzgänger“ zwischen den Kulturen und einem die eigene Existenz in die Waagschale des Lebens werfenden außerordentlichen Stilisten. Sie sind großartige, geglückte Versuche, sprachlich und inhaltlich dem, was interessiert, „auf den Grund“ zu gehen.
Harald Loch
Alexander Goldstein: „Aspekte einer geistigen Ehe“
Aus dem Russischen von Regine Kühn
Mit einem Nachwort von Ekaterina Vassilieva
Matthes & Seitz, Berlin 2021 336 Seiten 28 Euro
Tod auf Raten
In Abwesenheit wegen Kollaboration mit den Nazis zum Tode verurteilt, später begnadigt; ein scharfzüngiger und vulgärer Antisemit, der als Armenarzt in Paris den Mittellosen keine Rechnung stellt;
ein die französische Literatursprache revolutionierender Autor, der es in den Kanon der Pléiade bei Gallimard schafft. Louis-Ferdinand Céline hat ein skandalöses, atemberaubendes Leben geführt, das
vor 100 Jahren am 1. Juli 1921 im Pariser Vorort Meudon endete. Sein nach „Reise ans Ende der Nacht“ zweiter großer Roman „Tod auf Raten“ liegt jetzt unter dem neuen, richtigeren Titel in einer
sensationellen Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel vor. Über sie sind ein paar Worte zu verlieren: Céline hält sich in seiner sozial-naturalistischen Wortwahl nicht an die strenge Lexik der
französischen Sprache.
Er verletzt bewusst viele Regeln der Orthographie, der Grammatik und der Syntax ebenso wie das geschmackliche Nervenkostüm seiner Leser. Im Abgleich mit dem erst 1952 vollständig und unzensiert
erschienenen Original wird die Glanzleistung des Übersetzers deutlich: Alles kommt im Deutschen rüber! Überdies schreibt er ein sehr lesenswertes Nachwort.
Das heißt nicht, dass das Buch erträglicher wird. Von den immer wieder eingestreuten antisemitischen Abscheulichkeiten kann man nicht absehen. Der vulgäre Soziolekt der Pariser armen Leute wird unter
der Feder Célines zu krasser Literatur, das gesprochene Wort ist als Schriftsprache nicht nur neu, sondern zuweilen auch abstoßend. Es steht bei Céline nicht nur in der direkten Rede, in Dialogen,
sondern auch und vor allem in den erzählenden Passagen als das Wort des Autors.
Das alles ist ebenso sehr gewöhnungsbedürftig wie großartig. Wenn er von seiner eigenen jüdischen Identität absieht, sagt der Amerikaner Philipp Roth: „Céline ist mein Proust“! Wer Célines Literatur aushält, wird für das meiste, was er aushalten muss, sehr entschädigt. Man hat es „la petite musique“ genannt, was daran so fasziniert. Es gibt Melodien, ausgefeilte Rhythmen, hinreißende Tempowechsel. Schweigen, Atemholen gehen brüsk in wahnsinnige Beschleunigungen über, in ein martellato, ein seitenlanges Hämmern vor allem in den unappetitlichen, gewaltsamen und nie anturnenden sexuellen Orgien, in den frauen- menschenverachtenden und doch auch mitleidenden Beschreibungen von Elend und Armut. Céline weiß, wovon er schreibt. „Mord auf Raten“ enthält sehr viel Autobiographie. Sein unglücklicher und ungeschickter Protagonist heißt wie er selbst Ferdinand. Das Milieu entspricht dem, aus dem Céline mit Geburtsnamen Destouches entstammte: Sein Vater war niedriger Versicherungsangestellter, seine Mutter Putzmacherin. Alles in der Kindheit des Autors wie im Roman in ärmsten Verhältnissen. An allen Ecken fehlt immer das Geld. Der Ferdinand des Romans wird als Arzt eingeführt und erinnert sich an sein prekäres Leben vor dem Ersten Weltkrieg. Der Roman endet mit seinem Eintritt in die Armee. Auch der Autor nahm am Ersten Weltkrieg teil, wurde schwer verwundet und für seine Tapferkeit hoch dekoriert. Erst danach studierte Céline/Destouches Medizin.
Der Ferdinand des Romans scheitert kläglich bei allen Versuchen, einen Beruf zu erlernen. Es gibt kaum freie Stellen. Wenn er eine bekommt, fliegt er bald wieder raus – oft ohne eigenes Verschulden.
Die Ausbeutung eines einfachen Jugendlichen schreit zum Himmel. Seine Eltern schuften nach Kräften. Der Vater wird in der Versicherung schlecht bezahlt und ordentlich schikaniert. Die Mutter versucht
verzweifelt mit Ausbesserungsarbeiten die Familie über Wasser zu halten. Sie arbeitet gegen ihre Gesundheit mit sinkendem wirtschaftlichem Erfolg. Die Gläubiger stehen Schlange und werden aus dem
kleinbürgerlichen Ehrgefühl der Eltern unter Aufbietung alles Kräfte bezahlt. Ihr Sohn Ferdinand hat dieses Ehrgefühl nicht, will sich nicht ausbeuten lassen, schwankt zwischen Faulheit und
schlechtem Gewissen. Der einzige Lichtblick des Romans ist Onkel Edouard, der Ferdinand einen Internatsaufenthalt im englischen Rochester beschafft, wo auch der Autor in jungen Jahren war. Auch dort
scheitert Ferdinand, weil er nicht lernt und weil Internat und Schule Pleite machen.
Das alles ist naturalistische Sozialkritik auf hohem, extremem, literarischem Niveau. Das ist die condition humaine der ganz kleinen Leute, das ist deren Existenzialismus – eben der Tod auf
Raten!
Harald Loch
Louis-Ferdinand Céline: Tod auf Raten
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Mit einem Nachwort des Übersetzers
Rowohlt, Hamburg 2021 812 Seiten 38 Euro
Rasender Stillstand - eine Gesellschaftssatire
Das gibt es doch gar nicht: Eine deutsche Gesellschaftssatire, federleicht und mit den Gewichten der Gegenwart beschwert. Johanna Adorján hat sie geschrieben. Mit 50 Jahren ist sie jung genug, um mit dem ganzen Schwung ihres aus ungarischen Wurzeln gespeisten Temperaments für ihren Roman „CIAO“ auszuholen. Sie ist lebenserfahren und als Journalistin in der Beobachtung des Zeitgeistes genug geschult, um das auf die Schippe zu nehmen, was zu ihrer Story passt.
Hans Benedek ist eine langweilig gewordene Edelfeder in der „Zeitung“, deren Redaktion in Berlin sitzt. Verheiratet mit Henriette, die vor Jahren einen mittlerweile vergriffenen Gedichtband veröffentlich hat, dann zu Hans nach Charlottenburg zog, um in einem Auktionshaus - nicht etwa inhaltlich, sondern mit Keksen – Kunden zu betreuen. Ihre gemeinsame Tochter geht noch aufs Gymnasium, ist von ihren Eltern, von Berlin und überhaupt genervt. Hans Benedek vergreift sich noch und immer wieder an fast noch jugendlichen Volontärinnen. Im Roman ist es gerade Niki. In der „Zeitung“ weht ein frischer Wind. Die neue Chefin senkt die Kosten. Hans kann nicht mehr in den teuersten Hotels absteigen. Er bekommt das zu spüren, als sich zu einem Interview mit der jungen Feministin Xandi Lochner in Baden-Baden verabredet. Die Frauenfraktion in der Redaktion setzt durch, dass nicht Hans allein dieses Interview machen darf, sondern zusammen mit Niki. Es geht doch nicht, dass ein Mann eine Feministin interviewt!
Die Dinge nehmen ihren Lauf. Am Ende demontiert Xandi Lochner ihren für den öffentlichen Auftritt im Kurhaus von Baden-Baden vorgesehenen Gesprächspartner nach Strich und Faden. Später findet sie sich im zweitklassigen Hotelzimmer des inzwischen betrunkenen Hans wieder. Als es spannend wird verlässt sie ihn und löst mit einem entlarvenden Post einen Shitstorm à la „me too“ im Internet aus. Die Chefredaktion reagiert sofort und versetzt Hans in die Onlineredaktion, was er als Degradierung empfindet. Er und auch seine Chefin denken das so, obwohl die Auflagen der Papierausgaben, der „Blätter“ eben, derzeit sinken und Online-Ausgaben langsam Abonnenten sammeln. Wie kann man besser den Stand der Digitalisierung in Deutschland benennen, als mit diesem „Abschieben“ in die Zukunft!
Die Geschichte um Hans und Henriette, um Niki und Xandi Lochner, um falsche Kollegen, um den „Niedergang des alten weißen Mannes“, um Feminismus und vegane Ernährung und – natürlich – das unerträgliche Berlin, diese ganze Geschichte wäre zu banal, brächte Johanna Adorján nicht ihre Leserinnen und nicht nur diese zum Schmunzeln und zum Nachdenken über unsere Zeit. Ihren Witz trägt die Autorin nicht mit dickem Pinsel auf. Bei ihr ist der Witz das Loch, aus dem die Wahrheit pfeift. Sie kennt die Medienwelt und ihre Schwächen. Wenn sie den Klimawandel anspricht, dann zitiert sie nicht das PIK, das Potsdam-Institut für Klimaforschung, sondern porträtiert Hans Benedek: „Sein anderes Markenzeichen, wenn man so wollte, war, dass er seine weichen Lederslipper ohne Strümpfe trug, jedenfalls von April bis weit in den Oktober hinein. Wenn das mit den Temperaturen so weiterging – bisher war es der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen -, schaffte er es dieses Jahr vielleicht sogar bis November.“ Subtil karikiert Adorjàn die Möbel, die Moden und die angesagten Slogans, das, was man isst und trinkt, und was gedacht wird, den sogenannten Mainstream eben. Der Leserin - und wie immer auch anderen - fällt das Dürftige dieser Gegenwart wie Schuppen von den Augen. Das Banale ist nicht reizvoll, aber die Autorin entlarvt es gekonnt literarisch, würzt es mit Sinn und hält dieser bürgerlichen Welt lachend den Spiegel vor. Wer hineinblickt, sieht vor allem Stillstand. Das Motto über „Ciao“ lautet: „All things must change or remain the same“. Dieser Stillstand wird gepaart mit Dummheit, Niedertracht, Verlogenheit und Eigennutz. Das aufmerksame Publikum liest einen amüsanten anthropologischen Befund der Gegenwart und sagt, wenn alles verstanden ist: „not amused“!
Harald Loch
Johanna Adorján: Ciao Roman
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021 270 Seiten 20 Euro
Roman mit Biss: Auf den Spuren von Fürst DRACULA
Der Ort der Handlung wird anonymisiert und abgekürzt. Er heißt einfach B., eine kleine Ortschaft in der Walachei, südlich von Transsylvanien gelegen, am Fuß der Karpaten. Ich kenne die Ecke, habe gute Freunde aus Siebenbürgen.
Die Erzählerin greift rumänische Geschichte auf, die voll unvorstellbarer Grausamkeiten steckt und stellt sie in den Kontext mit Geschehnissen jener „barbarischen kommunistischen Zeit“, in der
Ceaușescu der diktatorische Fürst unserer Tage war.
Die Erzählerin im Buch hat mit Vorliebe Abenteuerbücher gelesen, etwa Jules Vernes, Alexandre Dumas und Karl May. Von Bram Stoker dem Dracula-Erfinder erwähnt sie aber nichts. Aber dafür Ceaușescu, der das Volk „aufsaugende Diktator“. In der Diktatur flohen viele oder wanderten aus, nach der Revolution kehrten aber viele wieder als Heimatsucher zurück.
Wenn die Autorin von Regenfällen erzählt, schreibt sie, dass damals alle „Niederschläge Ihre Feierlichkeit hatten und eine angemessene Bühne“, jetzt „regnete es gleichgültig“. So poetisch
faszinierend sich das Buch an vielen Stellen liest, schwebend, träumend, nimmt es als Fantasy-Geschichte doch auch wieder konkrete Bodenhaftung auf.
Es geht nämlich dann um die korrupten Politiker des Landes, die illegal Schwimmbäder mit Tennisplätzen kaufen, alte Hotels und Restaurants sanieren, Transportfirmen übernehmen, eben Geschäfte mit
alten Parteifreunden tätigen, Projektgelder kassieren und ja auch krumme Geschäfte mit Grundstücken abschließen, illegaler Holzeinschlag miteingeschlossen.
Wie heißt es in der ersten Strophe der rumänischen Nationalhymne:
Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!
Erwache, Rumäne, aus deinem Schlaf des Todes,
In welchen Dich barbarische Tyrannen versenkt haben!
Jetzt oder nie, webe Dir ein anderes Schicksal,
Vor welchem auch Deine grausamen Feinde sich verneigen werden!
Nun der „Todesschlaf“ spielt in dem Buch die Hauptrolle, es geht um eine-Familien-Gruft, Souvenirshops, den Tourismus und um Fürst Vlad III., der mit harter Hand seine Feinde richtete, auf Pfähle
spießte und qualvoll sterben ließ. Der „Pfähler“ Vlad Tepes, der auch als literarisches Vorbild für „Dracula“ diente. Mehr sei an dieser Stelle nicht konkret verraten. Dana Grigorcea erzählt ihre
gruselig-grausame Dracula-Geschichte, dieses politische Gleichnis, mit großer Sprachpotenz und zugleich mit einer gewissen Leichtigkeit.
Es kommt in dem Roman auch das Landestypische zum Zuge, wie ich es von Fahrten nach Transsylvanien mit rumänischen Freunden kenne.
Da wird zum Beispiel Muskatwein oder Weichsel-Likör getrunken, oder Brennnessel-Pasteten mit viel Knoblauch genossen, Auberginen-Salat, Tomaten mit Knoblauch, eingelegte Paprika gegessen und Rotwein
gekippt.
Unsere folkloristische Neugierde wird also geweckt und den Aberglauben des Volkes lernen wir auch kennen. Etwa die Volksweisheit, wenn Salz auf dem Tisch verschüttet wird, kommt es zum Streit.
Gläser, die noch nicht ganz leer sind, bitte nicht auffüllen! Einen Brotlaib von beiden Enden anschneiden, bringt Unglück!
Aber auch Politisches schwingt immer mit. Zum Beispiel, dass Ceaușescu gute Beziehungen zu den Ölstaaten aufrecht hielt. Da war es ihm egal, ob es sich um Diktatoren handelte, er war ja selber
einer.
Wir lesen von Misswirtschaft, uferloser Korruption, einem Volk voller Dummheit und Herdentrieb, einem Land in dem damals unter Ceaușescu, mehr Ordnung, mehr Patriotismus, mehr Respekt vor Autoritäten
herrschte. Man liebte und liebt die starke Hand des Führers.
Fazit der Romanparabel: „Der „Vampir Biss“ ist keine Strafe wie etwa das Pfählen eine ist. Er ist die Erlösung dessen, der geknechtet, verraten und erniedrigt wurde. Her mit Eurem schwachen
Blut! Und dann nehmt und trinkt alle vom Blut des Fürsten. Ihr Ohnmächtigen, die ihr mächtig werden wollt. Dies ist der Blutsbund derer, die für das Recht kämpfen.“
Man könnte auch ein weniger prosaisches Zitat aus diesem "politischen Schauerroman" für das rumänische Volk wählen: Jeder Tritt in den Arsch ist ein mächtiger Schritt nach vorn. Aber wohin torkelt
Rumänien?
Dana Grigorcea Die nicht sterben Penguin
Angst und Aerosole
Gerade beschäftigen wir uns wieder in der Pandemiedebatte um das Thema Lockerung. Dabei wissen wir, dass ihr der Tod folgen kann. Thea Dorn hat in ihrem Briefroman die Geschichte ihrer an Covid verstorbenen Mutter aufgeschrieben. Dies in Form eines Briefwechsels zwischen einer gewissen Johanna und ihrem Freund Max.
Mit einer Postkarte beginnt das Buch: „Liebe Freundin, wie geht es Dir? Dein Alter Freund.“
Es ist ein Buch über die Verlustangst und die Bedeutung des Todes für das Leben oder die Bedeutung des Lebens für den Tod. Also: „Die schlimmste Seuche unserer Tage ist die Angst.“
Die Autorin schreit in diesem Buch geradezu heraus: „Sie haben mich nicht zu ihr gelassen!!!! Den Sicherheitsdienst haben sie gerufen, als ich versucht habe, trotzdem in das Gebäude rein zu kommen.
Irgendwo da drinnen hing meine Mutter an irgendwelchen Maschinen. War am ersticken, verrecken, und sie haben mich nicht zu ihr gelassen!!!! Infektionsrisiko!!! Das Infektionsrisiko sei zu groß.“
Das tödliche Schicksalsende der Italienreise ihrer Mutter ist am Ende für Dorn auch eine Rechtsfrage: Kein Staat dieser Welt, so die Autorin, hat das Recht, einen Menschen zum einsamen Tod zu
verdammen.
Ihre Mutter war eine prominente Schauspieler-Agentin und hatte sich bei einer Italienreise leichtsinnigerweise infiziert. Bei der Beerdigung in München tauchen dann die Fotografen-Geier der
Boulevardpresse auf, um Prominente „abzuschießen“, die Polizei tritt auf, um über Infektionsschutz, Hygieneregelungen und Ordnungswidrigkeiten zu informieren und deren Einhaltung anzumahnen.
In einem gut lesbaren, spannenden Dialogverfahren von Frage/Antwort Frage/Antwort/Ansichtskarten/Briefantworten versucht die Autorin sich an Trauerarbeit. Schmerz, Schreie, Verzweiflung, Unrecht,
Leid, Schicksal, das alles prasselt auf den aufgewühlten Leser ein, denn Thea Dorn möchte dem Unrecht hier den Prozess machen.
Thea Dorn schildert eindringlich und gut nachzuempfinden, wie sie die „ausgestorbene Wohnung“ ihrer Mutter ausräumen muss und dabei noch einmal ihre Nähe sucht. Sie empfindet die Situation dennoch
als „Totenhausfriedensbruch“.
Sie kauft sich zur Beruhigung eine Schachtel Zigaretten, obwohl sie eigentlich nicht raucht, während da draußen eine Lungenseuche tobt. Thea Dorn erträgt kaum den täglichen Pandemie-Horror: Die
Bildschirm-Konferenzen, wenn Schauspieler und Schriftsteller oder Musiker Wohnzimmer-Aufführungen verbreiten. Sie kann die News-Ticker nicht mehr aushalten und auch die Wissenschaftler nicht, die
erklären, was wir alles wissen, und in Wahrheit nichts wissen.
Sie bekommt keine letzte Begegnung mit ihrer toten Mutter gestattet, sie darf sie nicht im Sarg sehen, sie erhält kein Foto mehr von ihr. Ein Abschied ohne Abschied.
Im Briefwechsel entdecken wir immer wieder philosophische Erkenntnis- Sätze, aber auch Eindrücke über den Zustand unserer Gesellschaft, wenn zum Beispiel das Vernünftige ins Absurde umschlägt.
Thea Dorn zitiert Sokrates und Seneca, Kleist und Platon, Simone de Beauvoir und Canetti, ihre philosophische Kenntnis bettet Dorn anspruchsvoll in den Text ein, beschreibt aber auch alltagsnah ihren
Katzenjammer, ihre Zweifel oder die schreckliche, aber dennoch hilfreiche Apparate-Medizin
Sie beschreibt eine Gesellschaft zwischen nicht ausgelebtem Hedonismus und faszinierender Massendisziplin, zwischen Herdenimmunität und Alltagswahnsinn.
Wir stolpern als Leser über die verklausulierte Handlungshilfe zum Pandemie-Arbeitsschutz-Standard für die Branche „Bühnen und Studios im Bereich Proben und Vorstellungsbetrieb“, derart
bürokratisch-beamtig formuliert, dass einem das Grausen kommen könnte. Für Dorn führen wir eine Lumpen- Tragödie auf, dazu ein Halleluja auf eine wahre „Ökokalypse“.
Johanna, ihre Brief-Hauptperson, muss feststellen, dass auch ihr verlässlicher Liebhaber In der Pandemie reumütig zu seiner Familie zurückgekehrt ist, und sie es ihm nicht einmal verdenken kann. Die
Leichtigkeit des Seins ist eben verloren. Wird unerträglich.
Geradezu begeistert hat mich der Satz Johannas, dass sie als Feuilleton-Redakteurin bei ihrer Zeitung eigentlich hätte kündigen müssen, und zwar, als der erste News-Ruhm eingerichtet wurde, als es um
Klickzahlen für Artikel, Aktienkurse, TV-Sternchen auf Seite Eins ging, an dem Tag, als der Kultur-Teil halbiert wurde, als die Chefredaktion vor versammelter Mannschaft verkündete, dass reine
Buchbesprechungen, Theater-, Opern- und Konzertkritiken nicht mehr erwünscht seien. Es gehe nur noch um „Diskurs“. Aber Diskurs auf welchem Fundament, möchte man fragen, auf dem der TV-Sternchen???
Der Aktienkurse? Der Klick-Zahlen?
Resignativ heißt es auf Seite 158: Was soll ich in der Kultur, gemeint ist die Redaktion dafür, wenn die Kultur selbst den Bach runter geht? Untergangs-Berichterstattung machen?
Es regt die Autorin auch auf, dass Politiker in der Lockdown-Diskussion Nagelstudios und „Muckibuden“ in einem Atemzug mit der Kultur nennen. Sie hatte den Wunsch, einen öffentlichen Aufruf der
Künstler dagegen zu initiieren. Doch das gelingt ihr nicht. Zu viele sprechen dagegen. Am Ende begreift sie: Ein Aufruf bringt nichts, was wir brauchen ist ein Aufstand. Fragt sich am Ende der Leser
aber, Aufstand – wer? Und gegen wen genau?
Es ist ein aufwühlendes Argumente-Buch, das hinterfragt, zweifelt, schimpft, argumentiert, philosophiert, weint und auch zuweilen weinerlich ist und sein will, eine Seelen-Bestandsaufnahme, ein
Befindlichkeits-Barometer, keine Postkartenidylle, denn der Briefwechsel ist eigentlich ein Dialog mit dem Mittel der Ansichtskarte auf der einen und des Antwortbriefes auf der anderen, auf Maxens
Seite.
Mit Mail und Whatsapp, Facebook oder Tiktok wäre das weniger gut möglich. Es kann sein, dass das Buch Trost spendet. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Wie überhaupt Garantien in Pandemien garantiert
scheitern können.
Thea Dorn TROST Briefe an Max Verlag PENGUIN
Thea Dorn, geboren 1970, studierte Philosophie und Theaterwissenschaften in Frankfurt, Wien und Berlin und arbeitete als Dozentin und Dramaturgin. Sie schrieb eine Reihe preisgekrönter Romane und Bestseller, Theaterstücke, Drehbücher und Essays und moderierte die Sendung »Literatur im Foyer« im SWR-Fernsehen. Seit März 2020 ist sie leitende Moderatorin des »Literarischen Quartetts«. Thea Dorn lebt in Berlin.
Schilf im Wind
Das waren noch Zeiten! Im Jahre 1926 erschien in der Türkei eine Briefmarke mit dem Porträt der frischgekürten italienischen Literaturnobelpreisträgerin Grazia Deledda. 95 Jahre später, 8. März 2021, am Internationalen Frauentag, kündigte die Türkei das europaweite Menschenrechtsabkommen zum Schutz von Frauen auf. Hier geht es nicht um die Türkei, sondern um den Roman „Schilf in Wind“, der gerade in der Manesse Bibliothek in einer schönen Neuausgabe erschienen ist.
Grazia Deledda ist 1871 auf Sardinien geboren und 1936 in Rom gestorben. Wie viele ihrer Romane spielt auch „Schilf im Wind“ auf ihrer Heimatinsel. Deren Landschaft und Menschen stehen im Vordergrund ihrer Literatur. Sie ruft lebendige Traditionen in einer rückständigen Gesellschaft auf. Sie selbst stammt aus einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater war Rechtsanwalt, ihre Mutter, wie damals in Italien auf dem Lande noch üblich, Analphabetin. Seit ihrem 14. Lebensjahr schrieb sie selbst und strebte durch ihr Schreiben erfolgreich nach einem selbstbestimmten und wirtschaftlich unabhängigen Leben. Ihre meist aus einfachem Milieu stammenden Menschen versieht sie mit nuancenreich differenzierten menschlichen Stärken und Schwächen.
Die üppige Besetzungsliste des Romans hat Grazia Deledda mit einer repräsentativen Auswahl der vormodernen sardischen Gesellschaft gefüllt. Drei nicht mehr ganz jungen, auch untereinander nicht ganz
einigen Schwestern Ruth, Esther und Noemi aus einer verarmten Adelsfamilie, ist nur noch ein kleines Gut für ihren Lebensunterhalt verblieben. Das wird von dem alten Knecht Efix in ihrem Auftrag
bewirtschaftet. Eine vierte Schwester hat schon vor geraumer Zeit die herunterkommende Familie verlassen, hat auf dem Festland geheiratet und ist inzwischen verstorben. Sie hat ihren Sohn Giacinto
hinterlassen, der nach wechselhaftem Leben in den Heimatort seiner Mutter, zu seinen drei Tanten zurückkehrt.
Es gibt noch den reichen Don Pedru, der einst Noemi heiraten wollte, aber wegen der „Schande“ der durchgebrannten vierten Schwester davon Abstand genommen hatte. Es gibt eine Wucherin und es gibt die bitterarme aber hinreißend schöne, irgendwie nicht erreichbare Grixenda. Deledda erzählt farbig von einem einwöchigen Kirchenfest, das eigentlich der Buße, in Wirklichkeit aber dem Vergnügen dient. Die immer auch dem Leben zugewandte Volksfrömmigkeit erwacht unter der Feder der Autorin zu einem schönen Fest - alles in der von Gebirge und dem Meer geprägten Landschaft, in der der Wind das Schilf bewegt.
Im Inneren der Menschen spielt das Kerbholz eine entscheidende Rolle. Der so selbstlos dienende Knecht Efix hat Schuld auf sich geladen. Einen Berg Schulden hat der junge Giacinto angehäuft, den er
nicht abtragen kann. Schicksale einfacher Menschen, verstricken sich unauflöslich ineinander, führen zu menschlichen Katastrophen die eigentlich ins Unglück münden müssten. Das Schicksal und die
Autorin wollen es aber anders: Nachdem einige der Hauptpersonen – teils aus Kummer, teils im glücklichen Bewusstsein einer Wendung zum Guten – gestorben sind, erfüllen sich die Wünsche der für
einander Bestimmten. Das Gut der Adligen wird gerettet und nichts ist verloren. Ebenso wenig wie die im 1913 erschienen italienischen Original enthaltenen Anspielungen auf das sardische Volkstum. Sie
werden durch einen ausführlichen, von Jochen Reichel besorgten Kommentar erschlossen. Er hat auch die schon ältere Übersetzung von Bruno Goetz der heutigen Zeit angepasst.
Ein ausführliches Nachwort von Federico Hindermann stellt die Autorin und ihren Roman „Schilf im Wind“ auf ihren Platz in der Weltliteratur. Sie war erst die zweite Frau nach Selma Lagerlöf, die den Literaturnobelpreis erhielt. Einige Jahre vor „Schild im Wind“ hatte sie an dem von der Pädagogin Maria Montessori organisierten ersten italienischen Frauenkongress teilgenommen. In ihrem Roman spielt noch die traditionelle Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern eine dramaturgisch entscheidende Rolle und ist Bestandteil des in der Nobelpreisbegründung hervorgehobenen Lokalkolorits.
Harald Loch
Grazia Deledda: Schilf im Wind
Aus dem Italienischen von Bruno Goetz
Von Jochen Reichel überarbeitete und kommentierte Neuedition mit einem Nachwort von Federico Hindermann
Manesse, München 2021 438 Seiten 25 Euro
Durs Grünbein OXFORD LECTURES
Poetik-Vorlesungen sind für Literaten eine gute Möglichkeit, aus dem Schriftstellerzimmerchen im Elfenbeinturm heraus zu treten, den Schreibtisch, das Notizbuch, den PC oder das Tablet zu verlassen, vor sein Publikum zu treten und reflexiver auf das eigene Schaffen zu schauen als es bei einer einfachen Lesung mit Buchhandlungspublikum möglich wäre. Es sind VOR-Lesungen und keine Lesung, und es ist meist den Literatur-Größen vorbehalten, dazu eingeladen zu werden.
Es geht um die „Lord Weidenfeld Lectures“. Zu den früheren Inhabern dieser Professur an der Oxford University zählen George Steiner, Umberto Eco, Amos Oz und Mario Vargas Llosa. Die „Lectures“ sind
einer der wirklichen Höhepunkte im akademischen Jahr, gleich ob Wissenschaftler oder Schriftsteller, vor Studenten dann auftreten.
Durs Grünbein wählt in seinen vier Texten den Zusammenhang zwischen Totalitarismus und Geschichte, kombiniert Wort und Bild Vergangenheit und Zukunft, eigene subjektive und objektive
Geschichtsbetrachtungen. Es geht um das Stückwerk von Erinnerungen und die Möglichkeit, dafür literarisch die passenden Worte zu finden.
So empfindet man als Leser der „Lectures“ den Literaten Grünbein als sorgfältigen „Geschichtsarchäologen,“ der mit Pinselchen das historische Erdreich, den Geschichtsstaub entfernt, damit die genauen
Strukturen von „History“ klarer zu sehen sind.
Ob Hitler auf der Briefmarke, der Autobahnbau der Nazis, der aggressive Angriffskrieg mit Bombadierung aus der Luft, hier setzt Grünbein thematisch an und setzt zugleich seinen individuellen Umgang
mit Geschichte der kollektiven Erfahrung von Vergangenheit gegenüber.
In der ersten Vorlesung geht es also um Grünbeins Briefmarken-Sammlung und das Konterfei Hitlers auf den postalischen Wertzeichen, die er als Kind ins Briefmarkenalbum sortiert hatte. Viele
verschiedene Farben und Wertzeichen gingen um die Welt. Im nächsten Text thematisiert Grünbein das Zukunftsprojekt Autobahn, die von den Nazis in die Landschaft hinein inszeniert wurde. Im Kapitel
Bombenkrieg, Titel „Im Luftkrieg der Bilder“, thematisiert Grünbein die Bombennächte, die Zerstörung der englischen Städte und kommt zu der persönlichen Einsicht: “Der Hitler-Stalin-Pakt von 1939
wird mir für immer als Warnung im Gedächtnis bleiben.“
Kurt Kister, Süddeutsche Zeitung, wirft in einer SZ-Rezension die grundsätzliche Frage auf: Schadet es nicht der wissenschaftlichen Seriosität, wenn es gut lesbare, gar literarische
Geschichtsschreibung gibt?
Darf Geschichtsschreibung also literarisch fundiert und grundiert sein, in wie weit darf Persönliches, die Eigenbeobachtung also, in Geschichtsschreibung einfließen? Kister kommt zu dem Ergebnis, die
in ihrer Subjektivität beste Geschichtsschreibung ist die, die auch die Verortung der eigenen Position gegenüber dieser Geschichte zulässt. „Grünbeins Aufsätze gewordene Reden sind gute, weil
stilistisch brillante Beispiele dafür, warum Literatur ohne Geschichte kaum denkbar ist“, schreibt Kister.
Ich finde einen historischen Zusammenhang als ausreichende Begründung dafür, den Grünbein selbst benennt: „Was mich nicht loslässt, ist das Problem der totalen Verfügbarkeit ganzer Völker“, schreibt
Grünbein.
Damit ist die Frage nach der Möglichkeit der Gewaltherrschaft in allgemeiner Form gestellt, und aktueller könnte dieser Befund angesichts der krisenhaften Entwicklung in Demokratien nicht sein. Es
sind die Nachbilder autoritärer Herrschaft, neue Träume von Rechtspopulisten von der Volksgemeinschaft, Politikmarketing und Populistenpropaganda, die rückwärtsgewandten Visionen von starken Nationen
und deren möglichst autarken Wirtschaften, die Durs Grünbein umtreiben.
Am Schluss aber, so formuliert es sein Verlag Suhrkamp, steht eine erste Erfahrung von Ohnmacht im Schreiben und die daraus erwachsende, bis heute gültige Erkenntnis: „Es gibt etwas jenseits der
Literatur, das alles Schreiben in Frage stellt. Und es gibt die Literatur, die Geschichte in Fiktionen durchkreuzt.“
Es ist aber die Literatur, die zu folgendem Ergebnis kommt: „Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler“ (Ingeborg Bachmann)
Vielleicht ist Literatur doch der eindrucksvollere und wirkungsvollere Ratgeber als Geschichte, um aus der Geschichte zu lernen? Und wir sehen am Ende betroffen, den Vorhang zu und wieder alle Fragen
offen…
Durs Grünbein: Jenseits der Literatur. Oxford Lectures. Suhrkamp
Pressestimmen
„Ausgehend vom historischen Detail und ausgerüstet mit einem enormen Wissen, zieht [Durs Grünbein] historische Koordinaten nach und sucht nach den Verschaltungen von Technik, Ideologie und Sprache.“
Jörg Schieke, MDR KULTUR
„Durs Grünbeins brillanter Gedankenstrom in vier Teilen sollte viel diskutiert und gelesen werden.“ Peter Helling, NDR
„Durs Grünbeins faszinierender Versuch einer alternativen Geschichte der NS-Zeit.“ DIE WELT
„‘Jenseits der Literatur‘ ist ein geharnischter, kluger und umsichtiger Essay.“ Michael Braun, Kölner Stadt-Anzeiger
Anna Baar: Nil Roman
Bin ich Sobek, habe ich ihn für meinen Fortsetzungsroman erfunden oder bin ich der Chefredakteur, der mich zwingt, den Roman schnell zu einem dramatischen Ende zu bringen? Diese Frage nach dem
Selbdritt stellt die Protagonistin – oder ist sie nicht vielleicht ein Mann? – in dem literarisch wohlkonstruierten Roman „Nil“ von Anna Baar.
Jede Leserin dieser kleinen literarischen Kostbarkeit wird die Frageschraube noch eine Drehung enger ziehen und nach dem Platz der Autorin fragen, schließlich, eingedenk dieser Schichtung von Wirklichkeit und Fiktion, auch nach sich selbst: „Am Ende trifft alles zu, gerade das Ausgedachte.“ Anna Baar, 1973 im damals jugoslawischen Zagreb geboren, lebt heute in Klagenfurt und Wien. Dem hiesigen Publikum ist sie durch ihr Erfolgsdebüt „Die Farbe des Granatapfels“ in bester Erinnerung.
Erinnerung gewinnt auch im „Nil“ eine auf das Selbst der Autorin weisende Bedeutung: „Wir werden unsere Geschichten nicht los, ob wir sie nun erzählen oder nicht, manchmal rutscht etwas davon heraus,
mitten ins Schweigen hinein, in die stehengebliebene Zeit…“ Der Vater der Protagonistin war Tierpfleger im Zoo, vögelte seine an den Küchentisch gelehnte Frau im Stehen. Seine Strenge zwang seine
Tochter zu ständigem Leugnen: „Ich war es nicht“, wenn ihr eine Tasse zu Boden fiel und zerbarst.
Um das Elternhaus kreist sie als Sobek, auch als sie es längst – für immer? – verlassen hat. Jetzt schreibt sie also für ein Frauenmagazin Fortsetzungsromane. Der Chefredakteur gibt ihr einen Wink - einen Befehl? – sie solle „alles so arrangieren, dass es zu einer Art Bühnenspiel wird, mich unters Publikum mischen, Zuschauer unter Zuschauern sein.“ Sie macht sich ans Werk: „Die Handlung gestalte ich schlicht: Einer geht nachts im Schneesturm immer dieselbe Straße entlang, um einen zu finden, der ihn erwartet, erkennt. Auf dem Weg geht ihm auf, dieser Jemand bin ich. Mein Name tut nichts zur Sache. Seiner soll Sobek sein.“
Eigene Erinnerung der Protagonistin, die von ihr gestaltete literarische Wirklichkeit und auch der Schreibauftrag für das Frauenmagazin verflechten sich kunstvoll. Jeder Leser wird das zu entwirren
versuchen. Immer wieder taucht ein Steinbruch auf, von dessen Rand jemand springen könnte, der nicht weiterkommen will. Immer wieder mischt sich die Autorin mit kleinen weltweisen Aperçus in ihre
eigene Erzählung ein: „Der Mensch leidet gern am Zustand der Welt, aber ungern an sich.“ Oder auch, wenn Sobek ums Elternhaus streunt: „Zur letztgültigen Heimkehr genügte kein Eintritt in
gleichwelches Haus…“ Anna Baar schreibt das alles mit einer sehr genauen Feder, die sie auch für das nur vage Wirkliche wetzt, und schichtet damit einen literarisch anspruchsvoll gelungenen
Roman.
Harald Loch
Anna Baar: Nil Roman
Wallstein, Göttingen 2021 150 Seiten 20 Euro
Hure im Weißen Kleid - Von Hand zu Hand
Ausgerechnet eine Hochzeit! Ein schwuler Bräutigam und eine schon von Hand zu Hand gereichte Braut feiern im Nobelvorort Rosedale bei Toronto vor geladenen Gästen aus der Oberschicht. Gähnende Langeweile im Publikum, fehlende Empathie für das Paar, bissige Bemerkungen und fetzende Dialoge mischt die kanadische Autorin Helen Weinzweig zu einem auf avantgardistische Weise unterhaltsamen kleinen Roman. Der Titel „Von Hand zu Hand“ weist auf die Vergangenheit der Braut. „Von den Partygästen wird sie ihrer Sünden wegen routinemäßig beleidigt; eine Dame höhnt, dass sie bald wieder im Geschäft sein wird, auch wenn sie verheiratet ist; eine alte Flamme sieht sie als Hure im weißen Kleid und spuckt ihr vor aller Augen ins Gesicht.“ In einem lesenswerten Nachwort fasst James Polk, der erste Lektor der Autorin, so die Atmosphäre dieser Feier zusammen, auf der viele Frauen wütend, verlassen und gedemütigt sind. Auch die getrennten Eltern der Braut sind nicht ohne. Ihr Vater, zwar benachrichtigt aber nicht eingeladen, erscheint aus seinem Exil in Mexico mit seiner achtzehnjährigen Frau, einer Indianerin, die ihr Baby vor dieser bizarren Kulisse am Boden hockend stillt. Die Struktur des Romans bestimmen die Dialogfetzen. Und die haben es in sich: Teils Biss, teils „quasi-rabbinische Weisheiten“, wie ihr früherer Lektor findet. Zu den überkommenden Traditionen heißt es im rasanten Stakkato ihrer Dialoge:
„Oder wir können sie ignorieren. / Auf eigenes Risiko. /Alles ist. / Was? / Auf eigenes Risiko.“
Helen Weinstein ist 1915 im damals noch zum zaristischen Russland gehörenden Polen als Helen Tenenbaum geboren. Ihre Mutter sei eine streitlustige Friseurin, ihr Vater ein leidenschaftlicher
Talmudgelehrter und marxistischer Revolutionär gewesen, der bald nach Italien floh. Die Mutter zog mit ihrer Tochter nach Toronto und eröffnete im Judenviertel einen Salon. Dort lernte Helen, die
zunächst nur Jiddisch gesprochen hat, Englisch. Sie fing erst mit über 50 Jahren an zu schreiben, als sie sich in ihrer Ehe mit dem Musiker John Weinzweig in der Hausfrauenrolle langweilte. Ihren
Schreibprozess – immer alles aufzuschreiben, was ihr gerade in den Sinn komm – bezeichnete ihr Lektor als „aleatorisch“. Damit ist die zufällige Anordnung der oft nicht einmal eine Seite
beanspruchenden Romansplitter gemeint. Das erinnerte manchmal an den Nouveau Roman oder auch an die avantgardistische argentinische Literatur. In „Von Hand zu Hand“ verdichtet sich diese
unkonventionelle Art zu einem von Hans-Christian Oeser treffsicher übersetzten literarischen Leckerbissen, dessen Unterhaltungswert mit der bissigen Ironie konkurriert, in der die Autorin die ihr
nicht unvertraute „bessere“ Gesellschaft auf die Schippe nimmt. Leider hat Ellen Weinzweig nur noch einen weiteren Roman schreiben können. Sie erkrankte bald, büßte ihren intellektuellen Scharfsinn
ein und starb 2010 im Alter von 94 Jahren in einem Heim.
Zeremonienmeisterin der Hochzeit ist die Chefin des Etablissements, das die Brautleute ohne Abschied mitten während der Feier verlassen. Sie fingieren eine Hochzeitreise, frieren in Wahrheit in ihrem
Auto, mit dem sie ziellos durch den Ort fahren bis sie davon ausgehen, dass alle Gäste verschwunden sind. Dann kehren sie zu dem Hotel zurück, wo die Braut die Suite „Versailles“ für die
Hochzeitsnacht gebucht hatte. Weil sie erst so spät zurückkommen, ist diese Suite inzwischen geschäftstüchtig anderweitig vermietet und dem Paar bleibt nur eine Dachkammer. Das Buch, dem der Verlag
einen vornehmen Leineneinband spendiert hat, gehört dagegen in die Belle Etage der Literatur.
Harald Loch
Helen Weinzweig: Von Hand zu Hand Roman
Mit einem Nachwort von James Polk
Aus dem kanadischen Englisch von Hans-Christian Oeser
Wagenbach, Berlin 2020 155 Seiten 20 Euro
Joseph Schmidt - der "deutsche Caruso"
Er war der „deutsche Caruso“. Ein hoch talentierter, in der Welt bekannter Tenor. Er war Jude und sein Schicksal war die Flucht vor den Nazis. Das Buch erzählt weniger seine überragende
Künstlerkarriere als vielmehr die Fluchtumstände in den Zeiten der Judenverfolgung.
Joseph Schmidt will aus dem besetzten Vichy-Frankreich in die rettende neutrale Schweiz fliehen, die ihm Asyl geben soll. Hier entstehen die Parallelen zur heutigen Zeit: Wie gehen die Menschen mit
Flüchtlingen um, und gibt es Parallelen zu damals?
Es gelingt dem Autor Lukas Hartmann eine schwierige geschichtliche wie politische Thematik in einem gut lesbaren, nie langweiligen Ton an den Leser zu bringen, ja ihn geradezu zu fesseln, obwohl von
der Handlung her eigentlich nicht viel geschieht.
Nazideutschland zerstörte die Karriere des weltweit bekannten Tenors. Zeitungen und Radiosender vergaßen ihn willentlich. Seine Schallplatten wurden aus den Regalen genommen. Joseph Schmidt bekam
Auftrittsverbot und wurde aus dem Musikleben regelrecht verbannt.
Er wird in einem Lager festgesetzt, erkrankt sehr schwer, wird jedoch von den Lagerärzten bei der Behandlung vernachlässigt und nicht richtig behandelt. Das rettende Asyl erreicht er nicht. Er stirbt
im Internierungslager.
Es ist also eine traurige Geschichte, die auch traurig zu Ende geht.
Dem Autor gelingt es, den Leser in die damalige Zeit des Naziterrors und der sie unterstützenden Kollaborateure zu versetzen und zugleich Erinnerungen an die heutige Zeit zu wecken, ohne dabei jedoch
einen moralischen Zeigefinger zu erheben. Das Buch müsste lehrreiche Schullektüre für den Unterricht werden. Ob im Fach Geschichte oder im Fach Musik wäre dieses Buch mit seinem Thema gleich
wichtig.
Ein Lied geht um die Welt
Der Autor Lukas Hartmann, geboren 1944 in Bern, studierte Germanistik und Psychologie. Er war Lehrer, Journalist und Medienberater. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Spiegel bei Bern und schreibt Bücher für Erwachsene und für Kinder. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Schweiz und steht mit seinen Romanen regelmäßig auf der Bestsellerliste.
Link
Rezension wdr