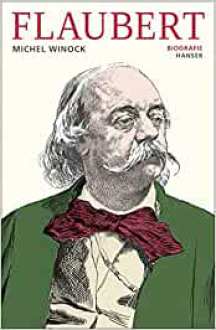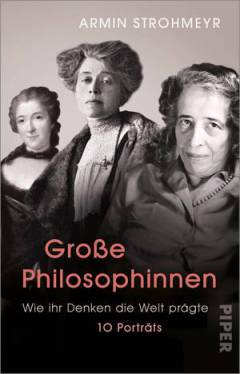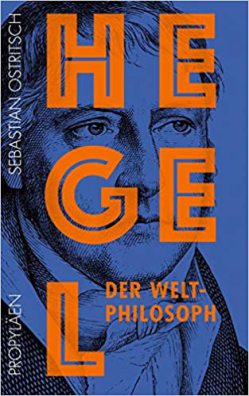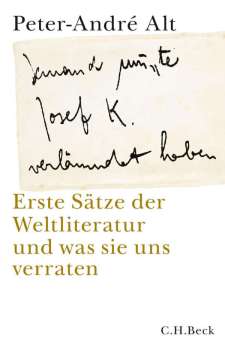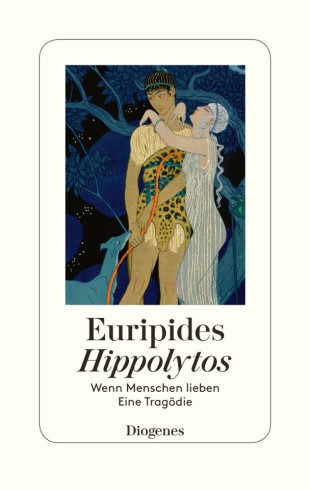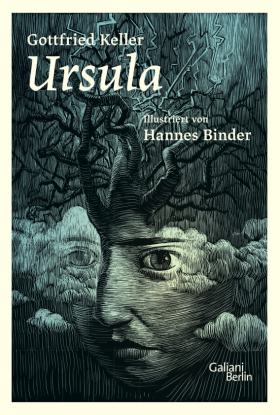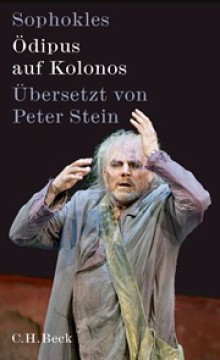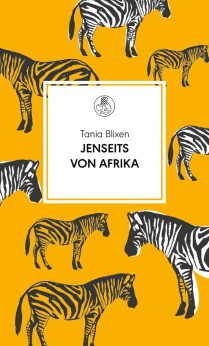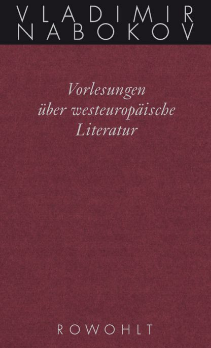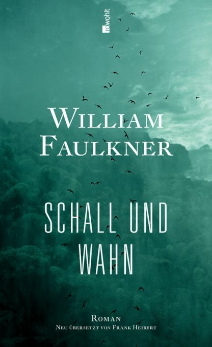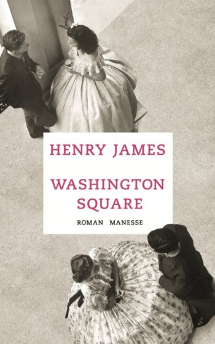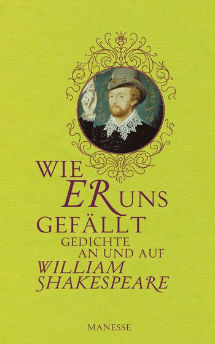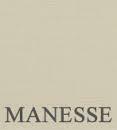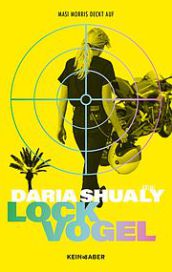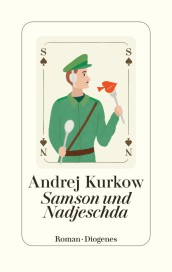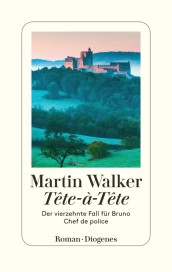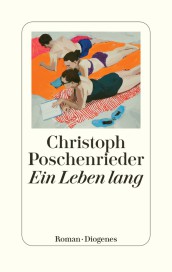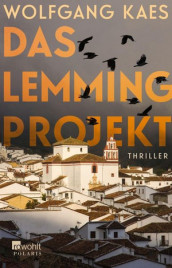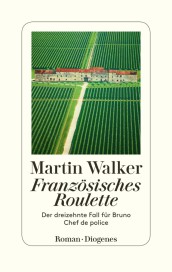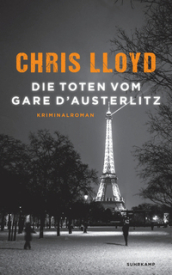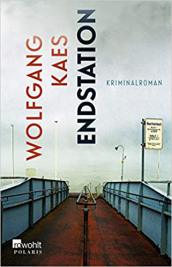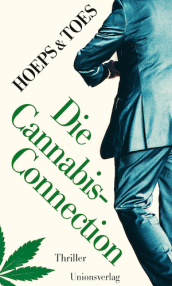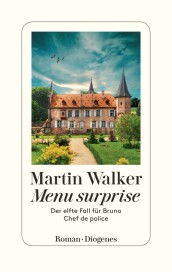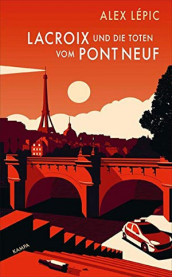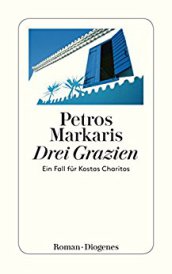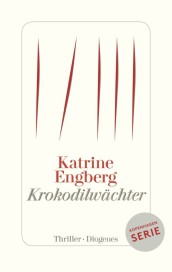Klassiker der Weltliteratur
Auf dieser Seite Hinweise über Klassiker der Weltliteratur, insbesondere Neuausgaben
Qualvolles Ringen um richtige Worte: Flaubert
Noch eine! Endlich! Ein Historiker schreibt, von Clio, der Muse der Historiographie geküsst, die entscheidende Biografie über einen der größten Dichter, der seine Werke mit der Akribie des
Historikers, des an den Quellen schöpfenden Autors geschrieben hat. Es geht um die Biographie von Michel Winock über Gustave Flaubert, die soeben in schöner Übersetzung bei Carl Hanser erschienen
ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht über Leben und Werk von Gustave Flaubert (1821 – 1880) nichts wüssten. Die Literaturwissenschaft, die populärere Publizistik, die biografischen Erzählungen und
auch die Versuche psychologischer Deutung füllen ganze Bibliotheken. Jean-Paul Sartre hat Flaubert seinen mehrbändigen anthropologisch-philosophischen Großessay „Der Idiot der Familie“ gewidmet, der
mit dem vielzitierten Satz beginnt: „Was kann man heute von einem Menschen wissen?“
Michel Winock, Professor am Sciences Po weiß, was man heute über Flaubert wissen kann und schreibt es auf. Er weiß aber auch, was man heute über die französische Geschichte des 19. Jahrhunderts
wissen kann. Er setzt beides in Beziehung zueinander und entdeckt in Leben und Werk Flauberts eine „erstrangige Quelle“ für die französische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
Er bereichert die literaturwissenschaftliche Sicht auf Flaubert aus der Perspektive des Historikers – voller Empathie für die Literatur. Zwei Revolutionen (1830 und 1848), der deutsch-französische Krieg und die Pariser Commune, der Bürgerkönig Louis Philippe, das Kaiserreich Napoléons III und die Republik fallen in diesen Zeitraum von einem halben Jahrhundert. Es ist das Jahrhundert des Bourgeois. „Zwei Dinge halten mich aufrecht: Die Liebe zur Literatur und der Hass auf den Bourgeois“, zitiert der Biograf Flauberts aus dessen umfangreichem Briefwechsel, der ein unerschöpflicher Steinbruch für die dadurch sehr authentische Lebensbeschreibung ist. Flauberts Leben folgt einem anderen Zitat: „Seid solide in eurem Leben und ordentlich wie ein Bourgeois, um zügellos und eigenwillig in euren Werken zu sein.“ Am Zügellosesten war Flaubert in seinem in Karthago spielenden Roman Salammbo, am Deutlichsten wird die Welt der Bourgeoisie in den Figuren seiner bis heute erfolgreichsten Bücher Madame Bovary und L’Éducation sentimentale. Winock beschreibt die geradezu besessene Arbeit Flauberts an den Details seiner Werke, die einer „historischen Wahrheit“ verpflichtet waren.
Er schreibt von Flauberts qualvollem Ringen um das richtige Wort, die treffende Metapher, den Rhythmus und Wohlklang eines Satzes. Jahre hat er an seinen Roman gearbeitet, Jahre, in denen er auf seinem Sitz in Croisset am Ufer der unteren Seine bei Rouen fast wie ein Einsiedler gelebt hat. Winock kennt auch das Pariser Leben Flauberts, wo er bald wie ein Gesellschaftslöwe auftrat, groß, laut und lebhaft. Er beschreibt die heute so illuster wirkenden Kreise, in denen Flaubert dort verkehrte. Namen wie Victor Hugo, Émile Zola, Turgenev, Maupassant, George Sand, Daudet oder die Brüder Goncourt zählten zu Gästen in Zirkeln und Salons, in denen Flaubert nach seinen ersten Erfolgen ein gerngesehener Gast war und die er selbst – sonntags immer, wenn er in Paris war - in seiner dortigen Wohnung empfing.
Winock weiß und berichtet von den Frauen, die Flaubert beeindruckten oder – mehr noch – die er beeindruckte. Mit vielen von ihnen und mit seinen literarischen Freunden pflegte er einen intensiven
Briefwechsel, den sein Biograf gekonnt auswertet. Der Tod seines Vaters, der ein berühmter Chirurg in Rouen war und ihm ein Vermögen hinterließ, das es Flaubert ermöglichte, sich ganz der Literatur
zu widmen, dieser Tod „befreite“ ihn, wie Sartre in seinem „L’Idiot de la famille“ analysiert. Der frühe Tod seiner geliebten Schwester Caroline stürzte ihn in tiefe Trauer.
Er übertrug seine Geschwisterliebe auf ihre Tochter, seine Nichte in die er seine ganze Menschenliebe investierte. Deren Mann, einem Sägewerksbesitzer, hatte Flaubert große Teile seines Vermögens anvertraut. Als der insolvent wurde, stand Flaubert plötzlich im Alter vor dem finanziellen Ruin. Winock beschreibt den Stolz, mit dem Flaubert Hilfsangebote ablehnte. Vor allem wollte er nicht dem Staat auf der Tasche liegen. Selbst in Zeiten der Armut zeigte sich Flaubert großzügig, nicht nur mit Worten, sondern in selbstlosem Einsatz für Freunde. Urteile von Zeitzeugen, Lobeshymnen und Verrisse seiner Werke runden ein Bild ab, das einen ungeheuer intensiven Künstler und ein halbes Jahrhundert Frankreich in einen zusammenschauenden Blick nimmt. Er sieht in L‘Éducation sentimentale „ein Dokument ersten Ranges: Flauberts Untersuchungen der Realitäten einer Epoche, die er verabscheut, zehren von seiner Beobachtungsgabe. Der Kult des Wahren – der seiner Meinung nach Verallgemeinerung und Übertreibung verlangt – rivalisiert bei ihm stets mit der Obsession des Stils.“
Harald Loch
Michel Winock: Flaubert Biografie
Aus dem Französischen von Horst Brühmann und Petra Willim
Hanser, München 2021 655 Seiten 32 zeitgenössische Abb. 36 Euro
Große Philosophinnen Wie ihr Denken die Welt prägte 10 Porträts
Ein Studienbuch ist es nicht, aber ein schönes Lesebuch. Zehn Philosophinnen proträtiert der Germanist Armin Strohmeyr und wagt die Aussage: Wie ihr Denken die Welt prägte. Das ist bei einigen der Frauen zweifellos der Fall, nicht immer kann der Autor auf dem knappen Raum ihr „Prägen der Welt“ aus ihrem Denken ableiten. Das meiste ist aber interessant, manches auch überraschend und alles mit leichterer Feder geschrieben, als der Titel befürchten lässt. Vor jedes Porträt setzt der Autor eine kurze kultur- oder philosophiegeschichtliche Einleitung von wenigen Seiten. Jeder Philosophin widmet er eine kurze biographische Skizze, im Mittelpunkt stehen ausgewählte Werke, Briefe oder sonstige Zeugnisse ihres Denkens. Die Hälfte der Porträtierten sind Französinnen, vier sind ihrer Herkunft nach Jüdinnen. Einige sind dem interessierten Publikum durch umfangreichere Fachpublikationen bestens bekannt. Bei einigen spielen auch die Männer ihres Lebens mit in diesem Reigen über 1000 Jahre.
Der beginnt mit der menschlich großartigen Liebesgeschichte zwischen Héloīse (1099 – 1164) und Abaelard. Die ist vielfach rezipiert worden und bekannter als das frühemanzipierte Denken der „Advokatin
der Liebe“, das aus einer Vielzahl ihrer nur teilweise erhaltenen Briefe zu erschließen ist. Der Nachruhm der Scholastikerin, die ihr „Recht auf Liebe“ gegen Gott und die Welt verteidigt und
durchgesetzt hat, wirkt bis in die Gegenwart. Nach mehreren Umbettungen wurde für sie gemeinsam mit ihrem Geliebten 1817 auf dem großen Pariser Friedhof Père Lachaise ein monumentales Grabmal
errichtet.
Die Scholastik verwendete eine dialektische Methode, um in Theologie und Philosophie und anderen Wissenschaften zu argumentieren. Davon hielt die Mystikerin Hildegard von Bingen (1098 – 1179) nichts
und entsprechend gering ist der philosophische Ertrag. Ihre heute von vielen geschätzten Qualitäten lagen eher auf poetischem Gebiet. Ganz anders dagegen Christine de Pizan (1364 – 1430), die mit
ihrem „Buch von der Stadt der Frauen“ einen philosophischen und emanzipatorischen Meilenstein setzte, bevor die Inquisition diese Modernität unmöglich gemacht hätte. Die Stadtbaumeister dieser Stadt
der Frauen sind Frau Vernunft, Frau Rechtschaffenheit und Frau Gerechtigkeit. Jeanne d’Arc wird eine Ehrenbürgerin dieser sicher lebenswerten Stadt. Über Émilie du Châtelet (1706 – 1749), die
langjährige Geliebte Voltaires, mit dem sie ein scharfzüngiges Doppel in der Aufklärung abgab, weiß man heute viel mehr. Sie war eine begnadete Naturwissenschaftlerin und Philosophin. Weniger bekannt
aber sehr lesenswert ist ihre „Rede vom Glück“. Ricarda Huch (1864 – 1947) hätte man wegen ihres riesigen literarischen Werks nicht in der Reihe der großen Philosophinnen vermutet. Armin Strohmeyr
belehrt sein Publikum eines Besseren und weist vor allem auf ihre in der vielgeschmähten „inneren Emigration“ bewahrte und gewonnene Distanz und Gegnerschaft zum Nationalsozialismus hin.
Die beiden Jüdinnen Edith Stein (1891 – 1942) und Simone Weil (1909 – 1943) konnten während der Nazizeit nicht in Deutschland bzw. Frankreich bleiben. Edith Stein, eine Husserl-Schülerin, die zum
Katholizismus konvertierte, wurde aus ihrem klösterlichen Versteck in den Niederlanden zusammen mit ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Zu ihr sagt sie „Komm wir gehen für
unser Volk“. Der Autor meint, „ob sie damit das Volk der Christen, oder das der Deutschen (das andere Deutschland) oder doch das Volk der Juden meinte, bleibt ihr Geheimnis. Die Französin Simone Weil
war sozialistische Aktivistin, Philosophin („ich kann, also bin ich“) und Mystikerin. Sie konnte der deutschen Besetzung in die USA entkommen und wollte dort nicht passiv den Völkermord mitansehen,
schiffte sich mitten im Krieg nach England ein, um sich dort de Gaulle anzuschließen. Wegen ihrer kränklichen Konstitution konnte man sie nicht im Einsatz gegen die Nazis verwenden. Sie starb, völlig
entkräftet in London.
Über die beiden großen Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, Hannah Arendt (1906 – 1975) und Simone de Beauvoir (1908 – 1986) ist in großen Biographien vieles bekannt gemacht und gewürdigt worden. Die
eine gilt als politische Philosophin, die über den Totalitarismus geschrieben hat und deren Wort von der „Banalität des Bösen“ (Eichmann) in der Welt ist. Die andere hat mit „Das andere Geschlecht“
einen entscheidenden frühen Impuls zur Emanzipations- und Gleichberechtigungsdebatte gegeben und überdies dem Existenzialismus, den ihr Lebenspartner Sartre vertrat, die fehlende ethische Komponente
beigegeben. Schließlich wendet sich Strohmeyr der Schweizerin Jeanne Hersh (1910 – 2000) zu, die hierzulande weniger bekannt ist, aber vielfältige politische Funktionen ausübte, z.B. als
Sektionsleiterin Philosophie bei der UNESCO. Mit allen Porträts weckt Strohmeyr Interesse nach mehr. Eine kleine Bibliographie erschließt weiterführende Lektüre zu Originaltexten und
Sekundärliteratur.
Harald Loch
Armin Strohmeyr:
Große Philosophinnen Wie ihr Denken die Welt prägte 10 Porträts
Piper, München 2021 318 Seiten 12 Euro
Sebastian Ostritsch: Hegel. Der Weltphilosoph
Manchmal sagt der Dank eines Autors mehr als alle Klappentext-Prosa: „Frank Ackermann und den Besuchern des Philosophischen Cafés im Stuttgarter Hegel-Haus danke ich für viele erkenntnisreiche
Samstagvormittage, in denen ich die Freude am außerakademischen Philosophieren entdecken durfte, ohne die ich das Unterfangen eines populärwissenschaftlichen Hegel-Buches nie in Angriff genommen
hätte.“
Wer sich hier bedankt ist der am Philosophischen Institut der Universität Stuttgart lehrende und forschende, 1983 geborene Sebastian Ostritsch in seinem Buch „Hegel. Der Weltphilosoph“. Das
Experiment, einen im Original schwer zu lesenden Philosophen „populärwissenschaftlich“ zu vermitteln, ist in Zeiten, in denen Einrichtungen wie das Stuttgarter Philosophische Café vorerst geschlossen
bleiben, zugleich ein Verdienst. Es musste ohne Inanspruchnahme eines „Übersetzerfonds“ entstehen, obwohl das Übertragen der sperrigen, mit Bedeutungsverschiebungen gegenüber dem gewöhnlichen
Sprachgebrauch arbeitenden Originaltexten Hegels in eine allgemeinverständliche Sprache das nahegelegt hätte. Das Experiment ist in hohem Maße gelungen.
Ostritsch folgt dem Leben des „Weltphilosophen“ in seinen Markanten Etappen: Im strengen Tübinger Stift der dortigen Eberhard Karls Universität studierte Hegel evangelische Theologie und Philosophie.
Hier teilte er ein Zimmer mit den Freunden Hölderlin und Schelling. Gegen den konservativen Geist des Stifts begeisterten sich die Freunde für die Ideen der Französischen Revolution. Nach seinem
Abschluss nahm Hegel Stellen eines „Hofmeisters“ (Hauslehrers) in Bern und Frankfurt an und begann 1801 seine Universitätskarriere als Privatdozent in Jena, wo er in den Tagen von Napoleons Sieg bei
Jena und Auerstedt sein erstes bedeutendes Werk, die „Phänomenologie des Geistes“ fertigstellte. Sein Biograph meistert die erste Herausforderung und kann den nicht leicht zu verfolgenden, wie im
Rausch niedergeschriebenen Weg Hegels von der sinnlichen Gewissheit bis zum absoluten Wissen für seine Leser gangbar machen. Nach der Verwüstung seiner Wohnung durch französische Soldaten musste
Hegel Jena verlassen, übernahm vorübergehend die Stelle als Zeitungsredakteur in Bamberg, um bald für acht Jahre als Rektor an das Nürnberger Egidien Gymnasium und in das Amt des Schulrats der Stadt
zu wechseln, bevor er für zwei Jahre an die Universität Heidelberg wechselte.
In der Zeit arbeitete er seinem zweiten großen Hauptwerk, der Wissenschaft der Logik. Auch hier bewährt sich die „Übersetzungskunst“ seines Biographen. Er folgt der Entwicklung der Gedanken Hegels von dem Dreiklang „Sein, Nichts, Werden“ zu einer Interpretation von Hegels Dialektik, die Ostritsch von dem populären Ohrwurm von „These, Antithese, Synthese“ befreit und über die Stufen Seinslogik, Wesenslogik zum eigentlichen Kern, der Begriffslogik vordringt. Hierbei gelangt auch Ostritsch an seine Grenzen der populärwissenschaftlichen Vermittlung.
Das Epitheton „Weltphilosoph“, das der Biograph Hegel beimisst, hat er in seiner glanzvollen Zeit an der Berliner Universität verdient. Der Berliner Zeit Hegels widmet Ostritsch nicht nur seine
biographische Aufmerksamkeit – er überquert wie Hegel oftmals nach der Arbeit in der Universität die Straße Unter den Linden, um die gegenüberliegende Hofoper zu besuchen – sondern er verfolgt die
weiteren Publikationen und aus Vorlesungs-Mitschriften seiner Studenten auch das akademische Lehrpensum Hegels. Seinen Lesern vermittelt der Hegel-Biograph dessen Enzyklopädie, die Rechtsphilosophie,
über die Ostritsch in Bonn promoviert hat, seine Ästhetik sowie die „Gretchenfrage“, seine Religionsphilosophie.
Etwas knapp gerät in dem einem „Weltphilosophen“ geltenden Werk 250 Jahre nach dessen Geburt die nachhaltige Rezeption von Hegels Werk, der ja über den als „deutschen Idealismus“ weit hinausgehenden moderneren Strömungen wie der Existenzphilosophie oder auch dem Dialektischen Materialismus von Marx und Engels nachhaltige Impulse erteilt hat. Allen Lesern, denen nach Ostritschs populärwissenschaftlicher Aufbereitung Hegels der Appetit nach mehr steht, bietet das gute Literaturverzeichnis Anregungen zur vertiefenden Lektüre im „Home Office“.
Harald Loch
Sebastian Ostritsch: Hegel. Der Weltphilosoph
Propyläen, Berlin 2020 315 Seiten 26 Euro
Was ist heute noch klassisch an den Klassikern?
Er ist in keinem Netzwerk, er twittert nicht, er diskutiert und schreibt und denkt und spricht: Rüdiger Safranski, geboren 1945, ist Philosoph und Autor zahlreicher Biographien über E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Schiller, Goethe. Seine philosophischen Essays handeln von der Wahrheit, vom Bösen, von der Romantik, der Globalisierung sowie von der Zeit an sich.
Er traf sich mit Michael Krüger, viele Jahre Verlagsleiter der Carl Hanser Literaturverlage und Herausgeber der „Akzente“, und mit dem journalistischen Fragesteller aus der Schweiz: Martin Meyer, „Redaktor“ im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung und sein langjähriger Leiter, um über das Thema KLASSIKER! WELCHE ROLLE SPIELEN DIE KLASSIKER HEUTE? zu diskutieren.
Sie sind, abseits dieser hektischen aktuellen Welt ins Dreiergespräch vertieft, ins philosophische „Gedankengestöber“, vermutlich bei einem oder mehreren Gläsern Rotwein, denn Analogien zum Weinmachen werden öfter zum Vergleich herangezogen etwa so: „…wie ein Winzer, der weiß, wie man guten Wein macht“.
Sagen wir es gleich am Anfang: Es ist ein gutes, tiefgründiges, lehrreiches Gespräch, und daraus ist ein gutes Buch geworden, eine Fundgruppe an Anekdoten, Zitaten, Erkenntnissen, Weisheiten, Frechheiten, Klugheiten, Bosheiten, Einzelheiten und Gesamtheiten.
Was für ein Füllhorn, was für ein Vergnügen dieses Gesprächsbuch zu lesen, es durchzulesen, zurückzublättern, nach vorne zu blicken, erneut nachzulesen, irgendwie beim Lesen gedanklich damit zu „arbeiten“.
Da sprüht der Geist, und der Leser wundert sich, dass es so etwas überhaupt noch gibt und publiziert wird.
Safranski ist in Rottweil geboren, ein Ort direkt am Neckar, zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald gelegen. (Die DDRler waren für die Schwäbische-Alb-Leute also Russen“.) Dort wächst der Schöngeist Rüdiger Sanfranski auf, begegnet Schiller, Goethe, George, Keller, Raabe und entwickelt ein Gefühl für die „Kostbarkeit der Sprache, die Unendliches umfassen kann.“
Wir erleben die 1960er und 1970er Jahre mit Studentenrevolte, freier Liebe, Maoistengruppen, Pop- und Rockmusik noch einmal in diesem Gespräch. „Es ging der Liebe gut“, die Jungs trugen Krawatten, die Mädchen blumige Glockenröcke oder eine Caprihose mit Brille dazu. Die Welt drehte sich damals anders, heute ist sie erstarrt: „Wir sahen aus wie wild gewordene Konfirmanden“.
Der „exotische“ Kommunismus (Maoismus) reizte Safranski mehr als der altbackene á la UdSSR oder DDR, Mao war für die Studenten-KLASSE attraktiv, die der Arbeiter-KLASSE, zum Beispiel in der Zeitschrift „Dem Volke dienen“ wollte, aber weniger in den Betrieben agitierte, dafür aber mehr in den Betten unterwegs war.
Sie gruppierten sich als Anarchisten, Spotaneisten, DKPisten und Maoisten, denen speziell Safranski folgte. „Der maoistische Spuk hatte für mich immerhin fünf Jahre gedauert“. Nach dem Antiautoritären, Libertären, Freiheitlichen folgte das Sektiererische, Dogmatische.
Die drei Kontrahenten am Tisch, aber Brüder im Geiste, diskutieren über eine lange Strecke, was ein literarischer Kanon sein kann, und Sanfranski reklamiert dafür „objektive Kriterien“, dazu gehören eben Werke, die einen geistigen Inhalt, eine geistige Originalität, eine wirklich neue Art, sich in der Welt zu fühlen, in die Welt hinein zu blicken, über die Probleme des Lebens neu nachzudenken stehen, und dafür sprachliches und stilistisches Gelingen beweisen. Der Kanon ist eben rangsetzend.
Safranski hat ein „lebensweltliches Verständnis“ für die Klassiker von Homer bis Kafka, von Kierkegaard bis Frisch.
Der Autor schafft ein Werk, und das Werk wirkt überwältigend auf den Autor zurück, etwa bei Sartre, Camus, Heidegger, Adorno.
Dabei machen sich die drei Geister nichts vor und erkennen, dass die bürgerliche Vorstellung von Literatur, die einen prominenten Platz im Bewusstsein der Gesellschaft hatte, vorbei ist. Literatur sei in der öffentlichen Wahrnehmung heute marginalisiert, den schlechten Geschmack habe es in der Vergangenheit zwar immer schon gegeben, aber heute habe er eben ein gutes Gewissen bekommen.
Die Zeiten eines Politikers wie Carlo Schmid (SPD), der Baudelaire übersetzte, sind vollends vorbei. Heute meinen Politiker, Bücher schaden der Reputation.
Die Diskutanten spüren, dass sie einem immer exklusiver werdenden Klub angehören und sie sich dabei selbst als „Kenner“ deshalb durchaus elitär geben dürfen, während Nichtleser damit rechnen müssen, dem NICHTS zu begegnen, auch in einem selbst, mit der Erkenntnis Lesen öffnet für die Welt und ist zugleich Selbstbegegnung.
Dabei kann es manchem Nichtleser passieren, wie es dem Berliner ergehen kann, der auf die Aufforderung: ›Mensch, geh in dir!‹ antwortet: ›War ik schon, is och nischt los!“
An weiterer Stelle heißt es im Text, und wenn man die Bücher nochmals liest, liest man in dem, der man einst war. Das ist wiedergefundene Zeit. Und gibt es mehr Zukunft als ein verlockendes Buch, das man noch nicht gelesen hat?
Parallel zu der laufenden Diskussion erfahren wir vom Leben Safranskis, von seinen Einstellungen, Erfahrungen, Einordnungen, seinem kulturellen Verständnis: „Die deutsche Nachkriegskultur kommt mir manchmal wie ein trockengelegter Alkoholiker vor. Die deutsche Kultur ist abstinent, und es gibt sehr viele Leute, die darüber wachen, dass es auch so bleibt.“
Das Buch ist auch eine politische und gesellschaftliche Bestandsaufnahme, die einige Schuldige für die UN-Kultur ausmacht.
Gehen wir ins Detail:
In der Literaturkritik ist ein „frömmelnder Ton“ eingezogen, wie in der politischen Szene überhaupt. Selbst der politische Kitsch kommt korrekt daher. Das wahre Leben kommt dabei jedenfalls nicht so richtig zur Sprache.
Safranski sagt: „Mich überkommt immer ein Gefühl der Enge, wenn ich diese Pastoren der Korrektheit höre. Die begreifen nicht: Dichtung gibt es, weil die Menschen nicht ganz dicht sind. Literatur ist das Abenteuer der Öffnung. Aber nicht in diesem ideologischen Sinn, wie heute jeder weltoffen sein soll. Das ist dann tatsächlich jeder, der nach Mallorca oder nach Florida fliegt. Mir geht es um eine andere Öffnung, eine für die Tiefe, was heute auch bereits etwas Anrüchiges hat …“
Es regiert das Korrekte und irgendwie Nützliche. Damit werden literarische Geschmäcker verstümmelt…“Am schlimmsten ist es an den Schulen und den Universitäten.“ …
„Es gibt viele schöne Bücher, aber es fehlt ein Stachel, wie wir ihn von der früheren Literatur kennen.“
Das Buch lässt uns auch in die Schreibwerkstatt des Autors blicken. Er arbeitet beim Schreiben von Biographien mit Zettelkästen und Kladden, notiert Stichpunkte und Kapitel hinein, überlegt sich die Bucheinteilung, formuliert die Anfangssätze eines Kapitels mit der Hand und schreibt dann am PC weiter, und was seine überlegte Wirkung angeht, ist für ihn klar: “Man trifft am besten, wenn man nicht zielt“.
Und die weiteren Aussichten, die Seher sehen sie nicht rosig: Konformitätsdruck empfindet Safranski auch sehr stark bei diesen Themen: “Man hat wirklich das Gefühl, dass der Korridor der Meinungen, die für diskussionswürdig gehalten werden, enger wird. Vielleicht gehen wir wirklich einer Zeit entgegen, in der es nur noch eine handverlesene Schar von Lesern gibt. Dann gleichen Buchhandlungen geistigen Delikatessgeschäften, wo Leute verkehren, denen Bücher noch etwas wert sind. Es muss nicht immer die große Zahl sein.“
Dieses Buch gehört in jede Schulbibliothek, jedem Deutsch- und Geschichtslehrer in die Hand gedrückt, jedem Politiker. Gut, es fordert den Leser und die Leserin auch, aber gerade das macht es ja auch aus, das „Hirnkaschtl“ wieder einmal anzustrengen, und irgendwie beruhigt es dann doch auch, dass Deutschland bzw. die Schweiz solche Autoren, Verleger und Redakteure noch hat, selbst, wenn die in der Schweiz anders, nämlich Redakt o r heißen, da haben wir sie wieder, die Differenziertheit von Sprache.
Was bleibt von diesem Buch, das ist das Prinzip Hoffnung: „Wir sollten sagen: Die Literatur bleibt etwas Großartiges, auch wenn immer weniger daran teilnehmen.“ Oder, auch dem Buch entnommen, das Zitat: „Dürfen die Nachtigallen singen - in dieser üblen Welt?“
RÜDIGER SAFRANSKI KLASSIKER! WELCHE ROLLE SPIELEN DIE KLASSIKER HEUTE? EIN GESPRÄCH ÜBER DIE LITERATUR UND DAS LEBEN MIT MICHAEL KRÜGER UND MARTIN MEYER HANSER
Erste Sätze der Weltliteratur
Kafka erledigte das Schreibproblem von erstem und letztem Satz gleich in einem literarischen Atemzug: „Ich bin Ende oder Anfang“, und zugleich formulierte er weltberühmte Eingangssätze der modernen Literatur, etwa „Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet."
Oder etwa dieser Einstieg in die Erzählung „Die Verwandlung“: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“
Das sind wortgewaltige erste Sätze der Weltliteratur, die zitatfähig im Gedächtnis bleiben, selbst wenn man die Werke Kafkas nicht gelesen hat.
Nun hat der Germanist Peter-André Alt in seinem Buch ERSTE SÄTZE DER WELTLITERATUR UND WAS SIE UNS VERRATEN Anfänge von Romanen berühmter Schriftsteller gesammelt, interpretiert, analysiert.
Erste Sätze locken den Leser. Sie sollen überraschen, packen, schmeicheln, erschrecken, verlocken, erregen, verführen, Stimmungen oder Personen zum Leben erwecken.
An 249 Beispielen zeigt der Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft, wie die Literaten von Homer bis Handke, von Aristoteles bis Wassermann, von Karl May bis Thomas Mann erste Sätze geprägt haben.
Alt nennt sein Buch ein Essay: „Am Beginn jeder Erzählung steht ein Verführungsversuch“. Mit diesem ersten Satz seines Buches über erste Sätze lockt Peter-André Alt uns ins Thema.
Der Autor eines Buches fängt nie am Nullpunkt an, er befindet sich in einem Netz von Vorüberlegungen, er „… bewegt sich immer schon in einem Geflecht aus Lebenserinnerungen und literarischen Eindrücken, im Bann von früher Geschriebenem – eigenem wie fremdem.“
Der amerikanische Romancier Wilhelm Faulkner bringt es lapidar und - konkreter geht’s nicht - auf den Punkt: „Schreib den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will.“
Damit könnte es der Germanist bewenden lassen, aber er entfaltet dagegen auf den folgenden Seiten ein virtuoses Satz-Panorama erster Sätze und zugleich bietet er uns ein Ordnungssystem unterschiedlicher Anfänge.
Die Methoden für Anfangssätze sind so vielfältig, wie die Themen, die sie behandeln. Der Anfangssatz wird entweder geplant, oder er ist ein Einfall von nächtlichen Phantasien oder Tagträumen, er wird aus Furcht formuliert oder nachträglich – nach dem Entstehen des Textes – im Nachhinein ins Manuskript korrigiert.
Für die Beispielsätze wählt André den Kanon europäischer Literatur aus, setzt einen Anfangssatz vor jeden Kapitelbeginn als Beispiel und ordnet sie hernach sehr vielfältig einer Systematik unter.
In manchen ersten Sätzen verbirgt sich der Steckbrief einer Person, etwa in Patrick Süskinds „Das Parfüm“: „Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten reichen Epoche gehörte“.
Ein weiteres Beispiel, es werden Orte und Zeiten beschrieben, etwa in Georg Büchners Erzählung LENZ: “Den 20. ging Lenz durchs Gebirg“.
Anfangssätze beschreiben Situationen wie zum Beispiel Siegfried Lenz in der DEUTSCHSTUNDE: „Sie haben mir eine Strafarbeit aufgegeben“.
Plötzliche Ereignisse treten ein oder es wird einfach nur Spannung erzeugt etwa in diesem Satz von Paula Hawkins: „Da liegt ein Kleiderhaufen an den Geleisen.“
Ob in Kinderbüchern oder Erwachsenenromanen, ob bei Karl May oder Günter Grass, es werden Bekenntnisse, Sprechakte, Gerüchte, unwahrscheinliche Begebenheiten, Ironie, Kitsch und Triviales eingesammelt. So heißt es bei Günter Grass in der BLECHTROMMEL: „Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt“. Oder bei Karl May: „Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein.“
Alt fasst zusammen: „Der Beginn eines Textes ist nie unschuldig oder spontan, er gehorcht mindestens dem Kalkül des Effekts und häufig dem Wissen über das, was folgt.“ Oder: „Wer vom Anfang spricht, steckt schon mitten im Ende.“
Es ist ein kurzweiliges, spannendes Buch der Literaturgeschichte, vom Altertum bis in die Neuzeit einen klugen Bogen spannend, ohne zu literaturwissenschaftlich übergescheit daher zu kommen. Solche Bücher hätte man gerne im Deutschunterricht benutzt.
Wir sind nun am Ende meines Textes und ich weise noch einmal darauf hin, dass Kafka Anfang und Ende in einen einzigen Satz gefasst hat, der hier jetzt von mir an das Ende gesetzt wird so wie er am Anfang des Textes hier steht, es ist ja ein Extrakt, quasi in reinster Form: „Ich bin Ende oder Anfang“, und dieser Satz Kafkas könnte, wie gesagt, sowohl Einleitungs- wie Schlusssatz eines Romans sein.
So geht es eben immer weiter, nach jedem Ende folgt ein neuer Anfang oder wie ein weiterer Satz von Hermann Hesse lautet (kein Anfangssatz!)
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
Hoffentlich ist das auch nach Corona-Krisen so…
Peter-Andre´Alt Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten C.H.Beck
Pressestimmen
"Peter-André Alt (…) zeigt, wie klug, mitreißend und kunstvoll viele der angeblich so langweiligen Klassiker geschrieben haben.“ FOCUS, Uwe Wittstock
"Peter-André Alt (…) analysiert auf wunderbar gescheite, aber gar nicht professorale Weise, wie Spannung aufgebaut oder Idylle hergestellt wird. Er hat ein Buch geschrieben, das man sich gern zum Immer-wieder-Schmökern neben das Bett legt.“ Süddeutsche Zeitung - Newsletter Prantls Blick, Heribert Prantl
HippolytosWenn Menschen lieben - Ein Tragödie
Diese klassische Tragödie „Hippolytos“ gehört auf die Bühnen der Gegenwart! Euripides, der modernste des großen griechischen Dreigestirns, hat die Tragödie etwa 428 v.Chr. geschrieben. Sie zählt neben seiner „Medea“ oder „Alkestis“ zu seinen Meisterdramen. Die Tragödie handelt von der Liebe einer besonders tugendhaften Frau, Phädra, zu dem keuschen jungen Hipploytos und endet unvollendet, aber tödlich. Die Götter haben sich eingemischt. Vor allem Aphrodite kann nicht verwinden, dass Hippolytos ihr Verlangen nach ihm nicht erhört hat. Sie hasst die Keuschheit, ist ja die Göttin der Liebe. Hippolytos hat nichts im Sinn mit Frauen, auch mit dieser Göttin nicht. Er verehrt Artemis, die Göttin der Jagd, die ihrerseits in ihn verliebt ist Diese Rivalität der Götter war die klassische Erklärung für das, was Euripides als Ambivalenz oder auch Widersprüchlichkeit der Natur des Menschen ausmacht: Unter Phädras Keuschheit liegt noch etwas anderes. Aphrodite kann dieses Andere, das verborgene Triebhafte in ihr wecken. Daraus entwickelt sich die ganze Wucht dieser Tragödie. Phädra ist die zweite Frau des Königs Theseus und hat mit ihm zwei Söhne. Hippolytos ist ein Sohn dieses Theseus aus erster Ehe. Phädra erkennt das Unmögliche ihrer Liebe zu Hippolytos und versucht sie zu unterdrücken. Unglücklicherweise erzählt sie ihrer Amme von dieser heimlichen Liebe. Die versucht das Unmögliche zu ermöglichen und erzählt Hippolytos unter einem Eid der Verschwiegenheit von Phädras Gefühlen für ihn. Er weist das von sich und das Unglück nimmt seinen Lauf.
Am Ende nimmt sich Phädra das Leben und beschuldigt sich fälschlich der Untreue gegenüber von Theseus. Der verdammt seinen Sohn Hippolytos, der vermeintlich das eheliche Bett geschändet hat und verlangt von Poseidon, bei dem er einen Wunsch offen hat, den außerdem von ihm verbannten Hippolytos zu töten. Der Gott lässt Hippolytos verunglücken. Der wird sterbenskrank vor seinen Vater, König Theseus geschleppt. Als dea ex machina tritt urplötzlich die von Aphrodite ausgespielte Artemis auf und klärt Theseus über seinen Irrtum auf. Hippolytos stirbt unter den Augen seines Vaters dem er den Fluch, die Verbannung und den Tod verzeiht, der aber seiner Herrschaft nicht mehr glücklich werden kann.
Die Handlung ist verstörend. Euripides bereitet sie gekonnt im erprobten klassischen Spiel von Dialogen und Chor so auf, dass ein Wort, das vor ihm so nicht möglich war, weit in eine andere Zukunft weist. Hippolytos seufzt am Ende seines Lebens: „Ach! Könnten doch die Menschen Fluch den Göttern bringen!“ Das ist ebenso unerhört wie konsequent. So dachten vor zweieinhalbtausend Jahren wohl manche der Athener, befragten eine Theodizee, durchschauten das menschenverachtende und -vernichtende Werk der Götter. So weit geht der kommentierende Essay des Baseler Gräzisten Anton Bierl nicht. Aber in seinem sehr informativen, Aufbau und Wirkweise der griechischen Tragödie schön erklärenden längeren Text gibt er dieser ältesten Theater-Literatur und ihrem jüngsten Meister ihre eigentliche Bedeutung zurück: Hier spielt sich Menschliches in vollendeter Form vor klassischem mythologischem Hintergrund ab. Hier ist ein Autor am Werk, für heutige Leser und das Publikum der Gegenwart hervorragend von Kurt Steinmann übersetzt, der lange vor den Erkenntnissen der modernen Psychologie Bescheid wusste und der seine realitätsnahe Ahnung von der Natur des Menschen für die Bühnen aller Zeiten wirksam aufbereitete.
Harald Loch
Euripides: Hippolytos
Aus dem Griechischen übersetzt von Kurt Steinmann
Mit einem Essay von Anton Bierl
Diogenes, Zürich 2019 Ln. 144 Seiten 20 Euro
Gottfried Keller: „Ursula“
Als Gottfried Keller vor 200 Jahren in Zürich geboren wurde, lag die Reformation – besser: lagen die Reformationen – schon lange zurück. In Zürich ist diese epochale Umwälzung mit dem Namen Zwinglis verbunden, der im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts die Rückbesinnung auf das Wort der Bibel, eine schmucklose Kirchengestaltung und den Verzicht auf musikalische Unterlegung der Liturgie durchsetzt. Bis heute ist sein Name mit der brutalen Verfolgung der Täufer und mit den blutigen Religionskriegen gegen die katholischen Kantone verknüpft. Im Zweiten Kappelerkrieg wurde Zwingli 1531 von der katholischen Seite gefangengenommen, verhöhnt und getötet. Gottfried Keller hat in einer seiner Zürcher Novellen dieses historische Geschehen aufgegriffen und vor diesem Hintergrund die von religiöser Unvereinbarkeit beherrschte Liebesgeschichte „Ursula“ geschrieben. Aus Anlass des runden Geburtstags von Gottfried Keller hat der Verlag Galiani Berlin dieses Schlüsselwerk der Schweizer Literatur neu aufgelegt und es von dem Zürcher Comiczeichner und Maler Hannes Binder illustrieren lassen. Entstanden ist eine kleine Kostbarkeit, würdig der literarischen Bedeutung der Erzählung.
Im Mittelpunkt der 1523 einsetzenden Handlung steht der „Rottmeister“ Hansli Gyr, der mit einem kleinen Zürcher Söldnerheer den Papst gegen Angriffe der Franzosen verteidigt hatte. Als er einige
Jahre zuvor losgezogen war, hatte er seinen Blick auf die heranwachsende Nachbarstochter Ursula geworfen und sein Blick war fast noch kindlich erwidert worden. Als Hansli seinen Hof nach Jahren der
Abwesenheit wieder betritt, findet er ihn von den Nachbarn wohlversorgt, trifft auch sogleich die aufgeblühte Ursula. Sie erneuern ihren schon früh gewechselten Blick. Als Hansli aber bei deren
Eltern nach alter Sitte um die Hand der Tochter anhält, wird ihm bedeutet, dass das nach neuer Sitte nicht nötig sei, er aber doch zu der neuen Religion übertreten müsse. Die Eltern und viele
Dorfbewohner waren Täufer geworden. Hansli erlebt eine Zusammenkunft dieser Sekte und ist entsetzt. Er wird sich ihr nicht anschließen, liebt Ursula weiterhin und wird von ihr auch geliebt. Aber sie
will von dem Glauben, den ihr Vater autoritär verordnet, nicht lassen.
Aus dieser Konstellation entwickelt Keller eine kraftvoll erzählte Liebesgeschichte, die nach einigen Jahren und wirklich spannenden Zwischenschritten glücklich endet. Unterwegs erzählt Keller en
passant ein Stück Zürcher Reformationsgeschichte, lässt Ulrich Zwingli persönlich auftreten, hält ein paar Prüfungen für beide Liebende bereit, die sich einige Jahre nicht mehr sehen. Keller gebietet
für „Ursula“ über eine der erzählten Zeit behutsam angenäherte Sprache. Er ist ein begnadeter Prosaautor, dessen während seines jahrelangen Berlinaufenthalts entstandener Roman „Der Grüne Heinrich“
längst zur Weltliteratur gehört. Er fängt das dörfliche Leben und die es umgebende Landschaft ebenso treffend ein wie die zärtlichen Gefühle der beiden Liebenden, die so lange nicht zueinanderkommen
können. Angesichts der Wiederkehr von Religionen im öffentlichen Raum und auch in den persönlichsten Beziehungen gewinnt die Novelle „Ursula“ heute eine neue Bedeutung. Die kostbare Ausstattung
dieser wunderbar illustrierten Ausgabe trägt sowohl dem Geburtstag des Autors als auch der Aktualität des Themas auf eindrückliche Weise Rechnung – ein schönes Buch!
Harald Loch
Gottfried Keller: „Ursula“
Illustriert von Hannes Binder
Galiani Berlin, 2019 128 Seiten 22 Euro
Ödipus - archaische Modernität
Ödipus ist nicht zuletzt durch Freud zu einem zentralen Topos der Anthropologie geworden. In der griechischen Antike ist er vor allem in den Tragödien des Sophokles formuliert worden. Auf den Bühnen der Welt spielen „König Ödipus“ und die damit zusammenhängende „Antigone“ bis heute Maßstäbe setzende Rollen. Das Spätwerk des Sophokles „Ödipus auf Kolonos“ hat dagegen keine vergleichbare Theaterkarriere erlebt – bis Peter Stein das Stück vor acht Jahren im Rahmen der Salzburger Festspiele mit Klaus Maria Brandauer in der Titelrolle zu einem triumphalen Erfolg inszenierte. Grundlage dieses Erfolgs ist in erster Linie die von Peter Stein selbst besorgte wundervolle Übersetzung des antiken Textes. Sie folgt derselben Übertragungs-Philosophie wir in der legendären „Orestie“ des Aischylos für die Berliner Schaubühne drei Jahrzehnte zuvor. Das Ergebnis besticht durch Klarheit und Schönheit.
Die Handlung ist aus der griechischen Mythologie bekannt: Ödipus hat seinen Vater Laios unwissentlich in einem Handgemenge erschlagen und später dessen Witwe Iokaste geheiratet, von der er nicht
wusste, dass es seine Mutter war. Mit ihr hat er vier Kinder, darunter seine Tochter Antigone gezeugt. Als er die Zusammenhänge erfährt, sticht er sich die Augen aus und flieht vor Schande ins Exil –
nach Kolonos. Die letzte Lebensphase des Ödipus, der von Antigone begleitet und liebevoll betreut wird, ist Gegenstand der letzten Tragödie des Sophokles. Der ergreifende Text enthält auch aus dem
Munde des Ödipus die Seufzer des bald neunzigjährigen Dichters über die Beschwernisse des Alters. Und nach dem verheerenden verlustreichen Krieg zwischen Athen und Sparta und der wundersamen
Wiederauferstehung der Heimatstadt des Sophokles dessen sehr schöne Huldigung an die überwältigende Schönheit der attischen Landschaft. Der Chor singt diese Kernpassagen der Tragödie, deren
erzählende Handlung vor allem in den Dialogen des Ödipus mit seiner Tochter vorangetrieben wird.
Bernd Seidensticker hat diesen wichtigen Text herausgegeben und mit einem kenntnisreichen Nachwort versehen. Er war Professor für Klassische Philologie an der FU Berlin und geht vertiefend auf Leben
und Werk des Sophokles, die historischen Zusammenhänge und das Stück, seine Übersetzung und die Salzburger Inszenierung ein. Sein Kollege Hellmut Flashar von der LMU München fügt einen interessanten
Essay über das Drama und seine Rezeption bei und führt dabei in die überraschende Welt der Vertonungen besonders der Chorpassagen der Tragödie ein – sie reichen vom Barock über Rossini und
Mendelssohn bis zu Wolfgang Rihm.
Das Stück beweist in der geradezu klassischen Übersetzung von Peter Stein die archaische Modernität, die dem komplexen und zugleich einfachen Stoff entspricht. Die Ausgabe des Verlages ist
verdienstvoll und wird der Tragödie vielleicht ihren angemessenen Platz auf den Bühnen oder gewiss in dem Kanon der Weltliteratur sichern.
Harald Loch
Sophokles: Ödipus auf Kolonos, übersetzt von Peter Stein
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Bernd Seidensticker und mit einem Essay von Hellmut Flashar
C.H.Beck, München 2018 192 Seiten 20 Abb. 19,95 Euro
Leserparadies Sizilien Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Die Sirene
Der elfte Fürst von Lampedusa ist 1896 in Palermo geboren. Das Wenige, das er literarisch geschrieben hat erschien erst nach seinem Tode im Jahre 1957. Weltberühmt wurde er durch seinen einzigen Roman „Il Gattopardo“. Den Hymnen über seine Insel Sizilien, seit der Antike gesungen, fügte er seine Erzählungen hinzu. Sie liegen unter dem Titel „Die Sirene“ in einer sehr schönen Neuübersetzung nach der authentischen Fassung jetzt auf Deutsch vor. Moshe Kahn hat sie besorgt. Es geht um jahrhundertalte Geschlechter, um Latifundien, verfallende Schlösser neben antiken Tempeln, um Kindheitserinnerungen an Zeiten, denen nur diejenigen nachweinen, die sie überlebt haben. Und es geht um das, was Sizilien zur Insel macht, um das sie umgebende Meer.
Die persönlichste Erzählung sind die „Kindheitserinnerungen“. „Als ich fünf oder sechs war“, gedenkt der Autor, „fuhren wir in der Kutsche nach Sciacca.“ Nach Jahrzehnten erkennt er im Ort wieder, was er als Kind gesehen hatte: “ein intensiv blaues, fast schon schwarzes Meer, das wie wild unter der Mittagssonne glitzert, einen dieser Himmel des sizilianischen Hochsommers, dunstig wegen der Schwüle…“ Wer alles hat in der über zweieinhalbtausendjährigen Geschichte Siziliens nicht dasselbe gesehen! In dem textkritischen Kommentar zur Titelgeschichte „La Sirena“ werden zwei Varianten einer Kernaussage über dieses Meer angeführt: „Das Meer von Sizilien ist das farbigste, das aromatischste…“ oder „das farbigste und das romantischste“ - aromatico vs. romantico!
Das Meer fordert alle Sinne heraus, deshalb ist „aromatico“ das richtige Wort. In der Erzählung „Die Sirene“ begegnet im Jahre 1938 im piemontesischen Turin der junger Journalist Corbera einem greisen Professor des Altgriechischen. Zaghaft nähern sie sich, stellen fest, dass sie beide von Sizilien stammen. Der Altphilologe fragt, ob auf der Insel noch seine geliebten Seeigel gegessen werden. Beim nächsten Besuch besorgt der Jüngere solche Seeigel aus dem nahegelegenen Genua. Nach fast fünf Jahrzehnten erwacht der Sizilianer im Alten: „Danke, Corbera, du bist ein guter Famulus gewesen. Schade, dass sie nicht aus dem Meer da unten sind, diese Seeigel, dass sie nicht in unsere Algen eingewickelt sind. Ihre Stacheln haben ganz sicher niemals göttliches Blut vergossen. Das hier sind sozusagen boreale Seeigel, die an den kalten Riffen von Nervi oder von Arenzano schlummerten.“
Himmel und Meer auf Sizilien sind eben einzig, und der kritische Alte grantet: „Das Meer wird wohl das Einzige sein, was ihr nicht ruinieren könnt, abgesehen von den Städten natürlich.“
Im Stadium des letzten Vertrauens erzählt der Alte dann Corbera seine Geschichte aus dem Sommer 1887, als ihm – oben junge Frau, unten Fisch – eine Sirene, Lighea, die Tochter der Kalliope ins Ruderboot schwappte. Sie lächelte ihn an: „Dieses Lächeln drückte nur sich selbst aus, das heißt eine nahezu animalische Freude zu existieren, eine nahezu göttliche Leichtigkeit. Dieses Lächeln war der erste Zauber, der auf mich wirkte, indem er mir Paradiese vergessener Heiterkeit offenbarte. Von den durcheinandergebrachten Haaren rann das Meerwasser über die weit geöffneten grünen Augen und die Gesichtszüge kindlicher Reinheit.“
Wer wie Lampedusa den Himmel und das Meer Siziliens, die antike Mythologie und den Geschmack von Seeigeln, ein drei Wochen währendes erotisches Fest in einer knappen Erzählung zu einem Paradies für Leser vereint, braucht keinen Plot, keine Spannung, braucht eigentlich auch nicht mehr als diese Erzählung zu schreiben, um unsterblich zu sein.
Harald Loch
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Die Sirene Erzählungen
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Piper, München/Berlin 2017 288 Seiten 24 Euro
Ein Buch in Cinemascope und Farbe
Ich war nie in Afrika, kenne es nur aus Erzählungen meiner Frau, die in jungen Jahren mit Jeep und Zelt die wildesten Regionen dieses Kontinents – damals nicht ungefährlich und heutzutage ebenso –
durchstreifte. Einige gift-gefährliche Speere und Trommeln in meinem Schlafzimmer künden noch heute davon.
Dann las ich Joseph Conrads HERZ DER FINSTERNIS und war fasziniert.
Mehrfach traf ich den Afrikaexperten und Journalisten Peter Scholl-Latour, dessen Heim in Berlin auch eine Art Afrika-Ausstellung war und Scholl-Latour sagte im Interview, Afrika ist tot, Afrika ist
verloren, wir haben es kaputtgemacht. Wir sprachen über sein Buch "Afrikanische Totenklage - Der Ausverkauf des Schwarzen Kontinents" Auch für Tania Blixen ist „Afrika, dunkel lockende Welt“, sie
lebt als Weiße 17 Jahre im schwarzen Ostafrika.
JENSEITS VON AFRIKA war nicht nur ein Roman- und Hollywood-Erfolg, mit ihrer Liebeserklärung an die Natur Afrikas und an seine Stammes-Ureinwohner Kenias schuf Tania Blixen ein faszinierendes Stück
Weltliteratur, das jetzt in der schön gestalteten Mannesse-Reihe neu aufgelegt wurde.
Die Reihe legt Wert auf eine lesefreundliche Typografie, hochwertige alterungsbeständige Materialien, farbige Lesebändchen, Qualitätsdruck und editorische Sorgfalt. «Eines der schönsten Bücher
unseres Jahrhunderts», lobt Truman Capote den Klassiker des 20. Jahrhunderts.
„Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngong-Berge. Nach allen Seiten war die Aussicht weit und unendlich. Alles in dieser Natur strebte nach Größe und Freiheit“. So beginnt das Buch, das keiner
literarischen Gattung konkret zugeordnet werden kann, aber dazu später.
Ostafrika, die majestätischen Berge, die weiten Savannen faszinieren die Feierabend-Autorin Blixen, die sich in der Nähe von Nairobi am Rande des Ngong-Gebirges ansiedelt, um dort Kaffee
anzubauen.
Die Dänin Karen Christence Dinesen von Blixen-Finecke hat als Autoren-Vorname schlicht Karen oder Tania. Tagsüber trägt sie das Gewehr in der Hand, und am Abend den Bleistift zum Schreiben.
Ihre Kulisse ist Afrika und seine Vergangenheit. Sie betreibt die Karen Coffee Company Ltd („Kaffeeanbau ist eine langwierige Arbeit“), und sie lebt auf ihrer Farm zwischen Gazellen und Antilopen,
Elefanten und Löwen, ist verfolgt von Hyänen und Heuschreckenschwärmen.
Sie vergleicht Giraffen mit „langstielig gefleckten Riesenblumen“ , Nashörner beschreibt sie als „kantig zum Leben erwachte Nashörner“, der königliche Löwe ließ auf Beutefang im
„silberglänzenden Gras einen dunklen Streifen Kielwasser hinter sich zurück“ und der ruhte danach im kurzen Gras im „zarten frühlingshaften Schatten der Akazien, mitten in seinem eigenen
afrikanischen Lustpark“. In all dieser auch sprachlichen Schönheit findet sie Trost, wenn es schwierig wird in ihrem Leben und auf der Farm.
Afrika ist für Blixen „Sehnsuchtslandschaft“, ein „gefühltes“, vergangenes Afrika.
Der Leser kann dieses Buch als autobiographischen Roman oder als Memoiren lesen, die Texte haben auch den Charakter von landes- oder völkerkundlichen Studien an sich, es ist eine Ich-Erzählung und
dennoch hat es auch etwas Romanhaftes an sich, zwar dialog-arm aber farbenreich, ein Selbstbericht aber zugleich verfremdet, Realität und Phantasie in einem: „Selbstberichtsroman“ schreibt Ulrike
Draesner im Nachwort. Blixens Sprache erzeugt 3D-Bilder, es sind poetische Landschaftsbeschreibungen. Ein Bilderbogen-Afrika, so bunt wie ein Regenboden und so landschaftsüberspannend breit. Ein
formatkleines aber 688 Seiten langes MANNESSE-Büchlein, in CINEMA SCOPE und in Farbe.
Mandelstam - Gedichte und Briefe

„Ein herrlicher Dichter, der größte von allen, die in Russland unter der Sowjetherrschaft zu überleben versuchten“ schrieb Vladimir Nabokov über Ossip Mandelstam, dessen Geburtstag sich am 15. Januar zum 125. Mal jährt. Der Versuch zu überleben scheiterte an Stalin. Aber Mandelstams Werk hat überlebt – nicht zuletzt dank der legendären zehnbändigen Werkausgabe, die Ralph Dutli vor Jahren für den Amman Verlag übersetzte und besorgte. Sie ist jetzt beim Rechte-Nachfolger S. Fischer lieferbar. Eine Reihe von Gedichten ist seinerzeit nicht in die Ausgabe aufgenommen worden. Der Herausgeber hatte darauf verzichtet, weil sie in den noch von Mandelstam selbst zusammengestellten Gedichtbänden nicht auftauchten. Ralph Dutli hat sie alle übersetzt und jetzt erstmals in einer bemerkenswerten, auch literaturgeschichtlich wertvollen Ausgabe veröffentlicht. Die Poeme sind großenteils während des Aufenthalts von Mandelstam im Wintersemester 1909-10 in Heidelberg oder in unmittelbarem zeitlichem und poetologischem Zusammenhang entstanden. Einige Briefe aus Heidelberg an zwei russische Dichter ergänzen das durch zwei lesenswerte Essays des Herausgebers und Übersetzers bereicherten Band. Es entsteht durch sie ein schöner Einblick in das „silberne Zeitalter“ der russischen Poesie.
Der achtzehnjährige Mandelstam war nach einem kurzen Studienaufenthalt in Paris erneut von Sankt Petersburg nach Westeuropa aufgebrochen, um seine Bildung zu vertiefen. In Heidelberg verfestigte sich sein Entschluss, Dichter zu werden. Die jetzt erstmals auf Deutsch zu lesenden frühen Gedichte sind die beachtlichen frühen Gehversuche, über die Marina Zwetajewa urteilte: „ Es gibt solche, die mit dem Maximum beginnen und sich auf diesem Maximum halten bis zur letzten Zeile ... Sie sind von Geburt an da. Ihr Kinderlallen ist schon Summe, nicht Quelle.“ Nun sind die für das hiesige Publikum neu zu entdeckenden Gedichte keineswegs „Kinderlallen“ im wörtlichen Sinne. Sie ergeben – alle zweisprachig nachzulesen – einen frühen Ausblick auf ein Werk, das später durch „zornigen Mut“ dem heimischen Diktator in der Sowjetunion die Stirn bot und damit das eigene Todesurteil herbeidichtete. Diese frühen Arbeiten aus Heidelberg und in zeitlichem Zusammenhang mit diesem Studienausflug in die romantische Stadt, in der sein Übersetzer seine Wahlheimat gefunden hat, werden ausführlich kommentiert in dieser mustergültigen Ausgabe wiedergegeben. Sie markieren den Übergang des Dichters von seiner anfänglichen Verbundenheit zum späten Symbolismus zu dem „Akmeismus“, der sein ganzes Lebenswerk prägen sollte. Dutli markiert diesen Übergang von der einen zur nächsthöheren Stilrichtung in dem Heidelberger Gedicht „Nichts, worüber sich zu sprechen lohnt.“ Dort heißt es „Wenn es keinen Sinn im Leben gibt,/Bleibt das Sprechen zwecklos und getrübt“ und wenig später: „Öde die Sprache, die nur als verständlich gilt“. Da steht in wenigen Zeilen ein ganzes poetolgisches Programm, das den großen russischen Dichter ein Leben lang leitete.
Harald Loch
Ralph Dutli: Mandelstam, Heidelberg
Gedichte und Briefe 1909-1910. Russisch-Deutsch
Mit einem Essay über deutsche Echos in Ossip Mandelstams Werk: „Ich war das Buch, das euch im Traum erscheint.“
Wallstein, Göttingen 2016 192 Seiten 19,90 Euro
Nicht nur Lolita...
Vladimir Nabokov: Vorlesungen über westeuropäische Literatur
Die Literaturstudenten von Vladimir Nabokov kann man sich nur als glückliche Menschen vorstellen. Sie haben vor 60 Jahren an einem grandiosen intellektuellen und ästhetischen Vergnügen teilgenommen. Heute darf sich glücklich schätzen, wer die damaligen Vorlesungen über russische und über westeuropäische Literatur, demnächst auch Nabokovs legendäre Demontage des Don Quijote in den sorgfältig edierten und in kostbares, mit Schmetterlingsprägung geschmücktes Leinen gebundenen Bücher nachliest. Soeben sind im 18. Band der Gesammelten Werke Vladimir Nabokovs Darstellungen und Analysen einiger zentraler Werke der europäischen Literatur erschienen. Von John Updike stammt das Vorwort zur 1980 erschienenen amerikanischen Ausgabe. Umrahmt werden die Vorlesungen von zwei ins Herz aller Literatur zielenden Vorträgen Nabokovs: „Gute Leser und gute Autoren“ und „Die Kunst der Literatur und der Normalverstand“. Dazwischen liegen nicht mehr als sieben Werke auf dem liebevoll gedeckten Tisch des Dozenten, der damals noch kein weltberühmter Schriftsteller war und diese Vorlesungen allein zum Broterwerb an den Universitäten Cornell und Harvard hielt.
Das einzige deutschsprachige Werk in seinem Heptagon der Leuchttürme ist Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Man kann es nur als ein Gelingen der Vorsehung bezeichnen, dass es der bedeutende Schmetterlingsforscher ist, der Nabokov ja zeitlebens war, der Kafkas Käferstück um Gregor Samsa seinen Studenten und jetzt auch seinen Lesern nahebringt. In einem glänzend inszenierten Wechselspiel zwischen interpretierender Inhaltsangabe und längeren Originalpassagen aus Kafkas Text entsteht ein neues Kunstwerk. Es handelt von Kafkas Verwandlung und von den Elementen großer literarischer Kunst. Es ist mit dem Herzblut des Lesers, der sich verzaubern lässt und ganz im Stile Nabokovs geschrieben. „Stil ist nicht Werkzeug, er ist nicht eine Methode, er ist nicht Wortwahl allein. Viel mehr als das, ist Stil ein spezifisches Element oder Merkmal der Persönlichkeit eines Autors.
Das Genie kann sich im literarischen Stil eines Schriftstellers nicht ausdrücken, wenn es nicht in seiner Seele gegenwärtig ist.“ Das sagt Nabokov am Ende seiner Vorlesungen über Jane Austens Mansfield Park, mit der der Band eingeleitet wird. Dieses Meisterwerk aus dem frühen 19. Jahrhundert „ist ein Märchen. Gestalt und Gehalt mögen bei Miss Austen auf den ersten Blick altmodisch, gestelzt, wirklichkeitsfern erscheinen. Doch das ist eine Täuschung, der nur der schlechte Leser unterliegt. In einem Buch hängt die Wirklichkeit einer Person, eines Gegenstandes oder eines Sachverhalts ausschließlich von der Wirklichkeit des betreffenden Buches ab. Für einen genialen Autor gibt es so etwas wie das wirkliche Leben nicht: Er muss es selbst schaffen, mit allen seinen logischen Elementen.“
Nabokov nähert sich den Romanen immer wieder durch Zeichnungen, eine Vorgehensweise, die er auch seinen Studenten ans Herz legt. Der 1852/53 erschienene Roman Bleakhaus von Charles Dickens erschließt sich räumlich durch eine selbstgezeichnete Englandkarte und inhaltlich über ein Diagramm der Hauptthemen. Es geht um englisches Justizleben, um unglückliche Kinder und um eine Detektiv-Handlung. „Bei dem Zaubertrick, den sich Dickens vorzuführen anschickt, muss er diese drei Weltkugeln balancieren, sie in einem Zustand beständiger Stimmigkeit bewahren, muss er diese drei Ballons in der Luft halten, ohne dass sich ihre Schnüre verheddern.“ Der geniale Dozent zeigt seinen Studenten, wie Dickens dieser Zaubertrick gelingt. Dann schwärmt dieser fabelhafte Literaturliebhaber von Madame Bovary. An dem Roman hatte Gustave Flaubert jahrelang gefeilt, ehe er 1856 erscheinen und einen Riesenskandal auslösen konnte. Nabokov spürt der Struktur dieses seiner Ansicht nach vielleicht besten Stücks des 19. Jahrhunderts nach und entfaltet den Studenten – wiederum in einer Skizze – das „Schichten-Motiv“ anhand der Mütze von Charles Bovary. 30 Jahre später erscheint Der sonderbare Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Wie in allen seinen Vorlesungen lässt er wieder den Autor selbst sprechen und verbindet dessen O-Töne mit klugen, durchaus auch kritischen Bemerkungen, mit denen er dem „wunderbarsten Buch“ Stevensons auf beglückende Weise gerecht wird. Dann verführt er seine Hörer zu Proust. In Swanns Welt ist der erste, 1913 erschienene Teil des großen Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. „Proust ist ein Prisma. Dessen einziger Zweck besteht darin, das Geschehene optisch zu brechen und durch diese Brechung in der Rückschau eine Welt neu zu erschaffen.“ Mit Kafkas Verwandlung war das Studienjahr schon fast zu Ende, ehe sich Nabokov anschickte, mit seinen Hörern einen weiteren Gipfel zu bezwingen: 1922 erschien in einer Art Privatdruck Ulysses von James Joyce. Schon zu Beginn der Ulysses-Vorlesungen zählt Nabokov die „wohlbekannten Schönheiten“ und die „offenkundigen Schwächen“ des Romans auf, um sich erst „dann ein Kapitel nach dem anderen vorzunehmen, um die Frage zu klären, worum es sich eigentlich handelt“. Die vielen Literaturfreunde, die immer wieder den Ohrwurm murmeln, man könne den ganzen Ulysses unmöglich schaffen, werden sich nach der Lektüre von Nabokovs Vorlesungen schämen oder grämen, dass sie es nicht doch versucht haben. Sie haben sich – das wird ihnen dann klar - um eine große Belohnung betrogen.
Harald Loch
Vladimir Nabokov: Vorlesungen über westeuropäische Literatur
Herausgegeben von Fredson Bowers und Dieter E. Zimmer
Aus dem Englischen von Ludger Tolksdorf und Dieter E. Zimmer
Band XVIII der Gesammelten Werke
Rowohlt, Reinbek 2014 780 Seiten Leinen 38 Euro.
Novellen aus der Normandie
Guy de Maupassant: Von der Liebe und anderen Kriegen Novellen (Neuübersetzung)
Mit einer Novelle zu der von Emile Zola herausgegebenen Gemeinschaftspublikation „Abende in Medan“ betrat Guy de Maupassant im Jahre 1880 mit Aplomb die literarische Bühne Frankreichs. „Schmalzkügelchen“ heißt sie in der neuen Übersetzung von Hermann Lindner. Sie ist mit über 60 Seiten die längste in der schönen Auswahl „Von der Liebe und anderen Kriegen“. Sie begründete den literarischen Ruhm und Erfolg des aus lothringischem Adel stammenden, in der Normandie aufgewachsenen Autors, der lange Zeit nur als „anstößiger“ Unterhaltungsschriftsteller galt. In einer nur etwa zehn Jahre währenden Schaffensperiode schrieb er neben sechs Romanen („Bel Ami“) annähernd 300 Novellen und entfaltete eine reiche journalistische Tätigkeit. Die jetzt vorliegende Auswahl bestätigt ihn als großartigen Stilisten und als sozialkritischen Beobachter der französischen Bourgeoisie.
„Schmalzkügelchen“ handelt während der letzten Phase des Deutsch-Französischen Krieges im Winter 1870/71. Eine Gruppe von 10 Bürgern aus Rouen will sich den Preußen entziehen, die die Stadt eingenommen haben und fährt mit einer großen Kutsche in Richtung Meer. Vom Schneetreiben und einem preußischen Offizier aufgehalten, bleiben sie in einem Landgasthof stecken. Der Deutsche hat es auf die mitreisende, attraktiv-proportionierte Dirne abgesehen, die es aus patriotischen Überzeugungen ablehnt, dem feindlichen Offizier zu Diensten zu sein. Da der die ganze Gruppe festhält, bis er seinen Willen durchgesetzt hat, drängen die selbstgerechten Mitreisenden das „Schmalzkügelchen“, wie die Prostituierte anzüglich-beziehungsreich heißt, im Interesse aller den Deutschen endlich zu erhören. Als sie das aus Solidarität tut und damit die Weiterreise aller ermöglicht, schlägt ihr die moralische Entrüstung der wohlhabenden Kaufleute und Adligen sowie ihrer Gattinnen entgegen: Ein Dokument der Verlogenheit einer ganzen Klasse. Es bestätigt die von Flaubert und Schopenhauer beeinflusste pessimistische Weltsicht Maupassants aber auch seinen Stilwillen und seine Kunst, Personen mit wenigen treffenden Sätzen zu charakterisieren und – in diesem Fall – zu entlarven. Das ist mehr als der Naturalismus, dem er oft verkürzend zugeordnet wird.
Die literarische Meisterschaft, die durchaus auch auf hohem Niveau unterhalten kann, beweist der 1893 an den Folgen einer Syphilis-Infektion gestorbene Autor auch in den kürzeren Storys dieser Auswahl, die die ganze Palette seiner literarischen Möglichkeiten aufzeigt: „Zwei Freunde“ werden, als sie sich trotz der deutschen Besatzung zum Angeln außerhalb von Paris verabreden, von dem Preußen als Spione füsiliert. „Im Frühling“ warnt ein Passagier auf einem Seine-Dampfer einen jüngeren Mitreisenden vor der Liebesblindheit, die die schöne Jahreszeit mit sich bringt. „Das Glück“ eines alten Ehepaares auf Korsika steht gegen die Annehmlichkeiten der zivilisierten Welt. „Der Horla“ ist eine großartige, unheimliche Schauernovelle.
Harald Loch
Guy de Maupassant: Von der Liebe und anderen Kriegen Novellen
Neu übersetzt, mit einem Nachwort und Anmerkungen von Hermann Lindner
dtv, München 2014 320 Seiten 9,90 Euro
Liebe statt Musketiere
Alexandre Dumas: Ein Liebesabenteuer (Deutsche Erstübersetzung)
Ein einziges Mal verhält sich der notorische Herzensbrecher und Frauenheld wie ein Gentleman – und schon wird ein bezauberndes Buch aus der Geschichte. Der über sich selbst verblüffte Held hat sie aus der Ich-Perspektive erzählt: Alexandre Dumas, der Autor des Grafen von Monte Christo und der Schöpfer der Drei Musketiere. Er ist 54 Jahre alt, als die ungarische Schauspielerin Lilla Bulyowski, von seinem internationalen Ruhm angezogen, ihn in Paris aufsucht und um Begleitung und Einführung in das Pariser Kulturleben bittet. Sie ist schön, jung, geistreich, glücklich verheiratet und hat einen Sohn, den sie abgöttisch liebt: normalerweise ein gefundenes Fressen für den Frauenjäger Dumas. In einem der wunderbaren galanten Dialoge, deren die französische Literatur so reich ist, stecken die beiden gleich zu Beginn ihre Grenzen ab: aus dieser durchaus erotischen Beziehung wird eine beglückende Freundschaft zwischen einem Mann, der kaum glauben kann, dass ihm dergleichen gelingt und einer Frau, die sicher in ihren Gefühlen und voller mutiger Unschuld in die Höhle des Löwen dringt, um ihren schauspielerischen und literarischen Horizont zu erweitern. Ein paar Wochen sind beide in Paris zusammen, dann begleitet Dumas seine Freundin zunächst nach Brüssel und dann über Köln und auf einer Rheinreise per Schiff bis nach Mainz, um weiter nach Mannheim zu reisen, wo Lilla Sprach- und Sprechunterricht bei der berühmtesten deutschen Schauspielerin ihrer Zeit, bei Sophie Antonie Schröder nehmen will, um auch auf deutschen Bühnen auftreten zu können.
Alexandre Dumas erzählt sein für ihn so untypisches Liebesabenteuer mit der ihm eigenen Selbstgefälligkeit. Überall unterwegs wird er erkannt, überall wird ihm gehuldigt, stehen ihm alle Türen offen. Wie nebenbei erwähnt er seinen Besuch der dem preußischen Kronprinzen gehörenden, von Schinkel entworfenen Burg Stolzenfels auf einer zwanzig Jahre zurückliegenden Rheinreise. Der Kastellan, der ihn dort ganz außer der Reihe empfängt und bewirtet entpuppt sich beim Abschied als der Kronprinz persönlich, der Dumas, von dessen glänzendem Namen überwältigt, geradezu königlich bewirtet. In Mannheim angekommen, erzählt Dumas seiner Reise-Freundin von Kotzebue und seinem Mörder Sand, dem er nach eingehenden Recherchen am Ort des Geschehens eine Novelle gewidmet hatte. Dumas ist auf dieser Reise in Höchstform, beflügelt von der neu zu erfahrenden Erotik der Freundschaft mit einer wunderschönen, knapp halb so alten Frau. Unterwegs machen beide noch die Bekanntschaft einer reizenden Wienerin, mit der sie eine Strecke des Weges teilen. Den beiden jungen Frauen erzählt Dumas dann von einem über zwanzig Jahre zurückliegenden – ebenfalls wahren - Liebesabenteuer auf Sizilien, als er einem Freund die versprochene Frau ausspannte und – anders als mit Lilla – die vollen Freuden körperlicher Liebe auskostete. Diese autobiographische Novelle sexueller Erfüllung bildet, mitten in der Freundschaftsgeschichte, das Kontrastprogramm zu dem erotischen Knistern zwischen ihm und Lilla.
Das Selbstporträt, das Dumas von sich zeichnet, gerät ihm treffend. Den Narzissmus lässt man der Berühmtheit durchgehen. „Dumas ist heute eine Ikone Frankreichs. Zu seinem 200. Geburtstag im Jahre 2002 wurden seine Gebeine in das Allerheiligste der Nation, das Pariser Panthéon, überführt. Dort liegen neben ihm und seinem Freund Victor Hugo nur vier weitere Schriftsteller: Voltaire, Rousseau, Zola und Malraux.“ Das schreibt Romain Leick in seinem klugen Nachwort zu dieser deutschen Erstübersetzung des Liebesabenteuers. 150 Jahre nach dem Erscheinen des französischen Originals können auch deutsche Leserinnen und Leser diese geistreiche und charmante Kostprobe aus dem Werk des großen Franzosen genießen. Roberto J. Giusti überträgt den Esprit des Originals in wundervollen Worten und der Verlag hat dem Werk eine würdige, elegante Ausstattung spendiert.
Harald Loch
Alexandre Dumas: Ein Liebesabenteuer
Aus dem Französischen von Roberto J. Giusti, Nachwort von Romain Leick
Manesse, Zürich 2014 Leinen 202 Seiten 19,95 Euro
Wer hat Angst vor diesen Büchern?
Virginia Woolf. Essays
Seit 25 Jahren erscheinen die gesammelten Werke von Virginia Woolf im S. Fischer Verlag. Die künstlerisch entworfenen Buchumschläge von Sarah Schumann haben sich in dieser Zeit zu Kultobjekten entwickelt. Zum Abschluss der großen Werkausgabe sind jetzt zwei Bände mit Essays erschienen. Es lohnt sich, diese Meisterwerke intellektueller Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Leben zu entdecken. Diese Betrachtungen und Rezensionen sind seinerzeit in renommierten Zeitschriften wie dem Times Literary Supplement erschienen.
„Granit und Regenbogen“ ist der Titel des einen Bandes. In ihm sind Arbeiten gesammelt, die sich zwei literarischen Themen widmen: dem Roman und der Biographie. Besonders bemerkenswert ist der Essay „Frauen und erzählende Literatur“, der aus Vorträgen entstanden ist, die Virginia Woolf im Jahre 1928 in Cambridge gehalten hat. Er ist als gedankliche Vorstufe zu dem bahnbrechenden Großessay „Ein eigenes Zimmer“ zu verstehen und beschreibt die Bedingungen, unter denen Frauen in England seit Beginn des 19. Jahrhunderts Romane geschrieben haben. Es geht um die Anfänge mit Jane Austen, den Schwestern Emily und Charlotte Brontë sowie um George Eliot und reicht bis in ihre zeitgenössische Gegenwart.
In einem Ausblick schreibt sie: „So werden, wenn wir prophezeien dürfen, in künftigen Zeiten Frauen weniger Romane schreiben, aber bessere Romane; und nicht nur Romane, sondern Lyrik und Kritik und Geschichte. Doch hierin schaut man gewiß in die Ferne zu jenem goldenen, vielleicht fabelhaften Zeitalter, in dem Frauen haben werden, was ihnen so lange versagt blieb - Muße und Geld und ein eigenes Zimmer.“ In ihrem „Versuch über literarische Kritik“ zerpflückt sie die Bedeutung des Literaturkritikers und schiebt sie der „menschlichen Leichtgläubigkeit“ zu. Am Beispiel der ersten beiden Bücher von Hemingway macht sie klar, was sie meint und entwickelt – das ist heimliche Kern ihrer Absicht – ein geradezu überwältigendes Beispiel glänzender Literaturkritik, erschienen im New York Herald Tribune vom 9. Oktober 1927. Sie endet kokett und selbstkritisch: „Damit offenbaren wir einige der Vorurteile, der Instinkte und der Irrtümer, aus denen sich zusammensetzt, was wir literarische Kritik zu nennen belieben.“
Auch in dem anderen, jetzt erschienene Band, „Das Totenbett des Kapitäns“, geht es um Rezensionen aber auch ums Rezensieren. In einem langen Essay unter diesem Titel differenziert sie die Literaturkritik von der Rezension, über die sie sich so abschätzig äußert, dass sich ihr eigener Mann, der Literaturredakteur und -kritiker Leonard Woolf in einer „Bemerkung“ zu diesem Essay veranlasst sah, die Notwendigkeit von Rezensionen zu betonen und die Ehre der Rezensenten wiederherzustellen. Beide Beiträge haben ihre hohe Aktualität behalten. In ihrem längeren Essay über das Lesen kommt Virginia Woolf auf die „fragwürdige Sphäre“ der Schönheit zu sprechen: „Warum aber Schönheit die Wirkung auf uns ausübt, die sie hat, das merkwürdige heitere Vertrauen, das sie uns einflößt, kann niemand sagen“, um dann – ambivalent und rätselhaft zu ermahnen: „Irgendeine Gabe müssen wir darbringen, irgendeinem Tun müssen wir uns widmen, und sei es nur, durchs Zimmer zu gehen und die Rose im Glas zu verrücken, die übrigens ihre Blätter verliert.“
Woolfs kritische Essays haben oft eine scharfe Klinge. Die benutzt sie wie ein schönes Werkzeug und schafft mit manchmal überraschenden Wendungen kleine Kunstwerke aus journalistischen Auftragsanlässen. Das können nur ganz Große. Die Autorin von „Orlando“ oder „Mrs. Dalloway“ schreibt auch in der kleineren Form des Essays bestechend modern und mit langem Nachhall. Die Blätter ihrer Rose scheinen nicht zu welken.
Harald Loch
Virginia Woolf:
Granit und Regenbogen. Essays
Deutsch von Brigitte Walitzek und Heidi Zerning
S. Fischer, Frankfurt am Main 2014 320 Seiten 19,99 Euro
Das Totenbett des Kapitäns. Essays
Deutsch von Hannelore Faden und Helmut Viebrock
S. Fischer, Frankfurt am Main 2014 288 Seiten 19,99 Euro
Faulkner
William Faulkner: Schall und Wahn
Neuübersetzungen bieten älteren fremdsprachigen Werken eine neue Chance, manchmal sind sie so etwas wie eine zweite Geburt. Das gilt in besonderem Maße für Werke, die in der Originalsprache bereits „sperrig“ sind, sich der leichten Lektüre widersetzen. Handelt es sich wie bei William Faulkners wohl bedeutendstem, zuerst im Jahre 1929 unter dem Titel „The Sound and the Fury“ erschienenen Roman „Schall und Wahn“ um eine Wegmarke nicht nur der amerikanischen Moderne sondern der Weltliteratur schlechthin, kann eine neue Übersetzung zum Ereignis werden. Frank Heibert vermittelt eine wichtige literarische Aktualität dieses Schlüsseltextes für deutsche Leser.
Der vierteilige Roman handelt am Beispiel der Familie Compson vom Zerfall der alten Südstaatenwelt in den USA und spielt in Faulkners näherer Heimat, in Mississippi. Gerade hat dieser Staat in unseren Tagen auf sich aufmerksam gemacht. Dort haben Farbige, die der Demokratischen Partei nahestehen, in den Vorwahlen zu den nächsten Präsidentschaftswahlen massenhaft und erfolgreich den konservativen Kandidaten der Republikaner unterstützt, um dessen ultrakonservativen innerparteilichen Gegner von der Tea-Party-Bewegung zu verhindern. „Schall und Wahn“ spielt also in einem seit dem Erscheinen des Romans wenig veränderten amerikanischen Milieu der Rassendiskriminierung. Faulkner schreibt dagegen an, indem er die Besonnenheit der schwarzen Wirtschafterin Disley gegen die konservative Dekadenz der weißen Familienmitglieder stellt.
Aus vier Erzählperspektiven werden Fragmente eines Geschehens beleuchtet, das die Wirklichkeit eher durch einen Grundton des Verfalls als durch eine lineare Handlung darstellt. Im ersten Teil wird das kaum zusammenhängend zu verstehende Geschehen aus der Sicht des geisteskranken Bruders Benjamin vermittelt. Bereits in diesem Kapitel wird die Erzähltechnik des „Bewusstseinsstroms“, des „stream of conciosness“ zur Vollendung gebracht. Hierbei handelt es sich um die Verlagerung der äußeren Handlung auf die Innenperspektive des wahrnehmenden Subjekts. Die Sinneseindrücke, Gedanken, Empfindungen und Erinnerungen einer Figur bilden so etwas wie einen frei assoziierenden inneren Monolog. Im Falle des Idioten Benjy entsteht ein psychologisch komplexes Bild einer sich fragmentarisch zusammensetzenden Wirklichkeit. In den späteren Teilen des Romans wechselt die Perspektive. Im zweiten Kapitel stellt Faulkner das Bewusstsein von Benjys Bruder, des Harvard-Studenten Quentin am Tage seines Selbstmords dar. Das nächste Kapitel ist ein einziger innerer Monolog des dritten Bruders, Jason Compson, und wechselt von dem literarisch anspruchsvollen Ton des zweiten Teils in eine harte realistische Sprache. In den ersten drei Teilen kreisen die Bewusstseinsströme und damit die über sie ablesbare äußere Handlung um die Schwester Caddy. Im Mittelpunkt des vierten Teils stehen deren nichteheliche Tochter Quentin <sic! sie heißt genauso wie ihr Onkel>, die unkonventionell lebt und damit eine Hoffnung nach dem Niedergang der aristokratischen Tradition andeutet sowie der österliche Kirchgang der kraftvollen und geduldigen schwarzen Wirtschafterin Disley.
Der Roman stellt hohe Anforderungen an den Leser, seine Aufmerksamkeit und seine Bereitschaft, die unkonventionelle Zeitauffassung des Autors ebenso als literarisches Ausdrucksmittel zu akzeptieren wie die gelegentliche Auflösung der syntaktischen Konsequenz der Sätze. Der Roman erfordert die Fähigkeit, den Bewusstseinsströmen ganz unterschiedlicher Figuren zu folgen und deren differenzierten Sprachduktus in eigenem Verständnis zu entschlüsseln. Wer hierin dem erkenntnistheoretischen Grundansatz des Autors folgt, wird den allmählichen Verfall dieser Gesellschaft nicht durch dessen objektive Darstellung sondern durch die subjektive Teilnahme der Figuren besonders intensiv nachvollziehen können. Welche enorme sprachliche Leistung dem Übersetzer abverlangt wird mag der ermessen, der sich einmal am englischen Original versucht hat. Frank Heibert erläutert in einem intensiven und ergiebigen Nachwort seine Übersetzungs-Poetologie. Ihm gebührt die uneingeschränkte Bewunderung für seine Arbeit.
Harald Loch
William Faulkner: Schall und Wahn Roman
Neu übersetzt von Frank Heibert
Rowohlt, Reinbek 2014 380 Seiten 24,95 Euro
Geistreich und giftig
Henry James: Washington Square
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts war die Welt noch heil, doch die Herzen waren verletzlich wie heute. Auch damals gab es schon Amerikaner, die es in Europa besser aushielten als in ihrem Land, das die Wunden des Bürgerkrieges noch nicht wirklich überwunden hatte. Henry James, 1843 in New York geboren, schrieb den etwa 40 Jahre vor seinem Erscheinen spielenden Liebesroman „Washington Square“ Im Jahre 1881 in London. Seitdem gehört der Titel zum Kanon der Weltliteratur. Hierzulande erlebt dieser moderne Klassiker seine wohlverdiente Renaissance in der vortrefflichen Neuübersetzung von Bettina Blumenberg.
Catherine Sloper ist die traurige, tapfere Heldin des Romans, der zu wesentlichen Teilen im Hause ihres Vaters Dr. Austin Sloper, eines der angesehensten Ärzte New Yorks, am Washington Square spielt. Der hatte einen Sohn im Alter von drei Jahren und seine Frau eine Woche nach der Geburt von Catherine verloren. „Seine kleine Tochter blieb ihm, und obwohl sie nicht das war, was er sich gewünscht hatte, nahm er sich vor, das Beste aus ihr zu machen.“ Als sie zehn Jahre alt war, nahm er seine ältere Schwester, Mrs. Penniman, eine Pfarrerswitwe zu sich. In einem Satz charakterisiert Henry James diese den ganzen Roman als Begleiterin von Catherine mitbestimmende Person: „Obwohl Mrs. Penniman über ein erstaunliches Maß einer etwas künstlich wirkenden Selbstsicherheit verfügte, schreckte sie doch aus nicht näher zu bestimmenden Gründen davor zurück, sich ihrem Bruder als Quelle der Gelehrsamkeit darzustellen.“
Das ist der ironische Ton, der das Werk von Henry James und insbesondere „Washingon Square“ bestimmt und das ist auch der Ton, in dem Dr. Austin Sloper mit seiner Umwelt, vor allem aber mit seiner Tochter umgeht. Die bleibt eine blasse junge Dame, erweckt aber das Interesse des jungen Abenteurers Morris Townsend. Ihre Vermögensverhältnisse sind jedenfalls kein Hinderungsgrund für ihn und eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen beiden, die in eine Verlobung mündet. Catherines Vater missbilligt diese Liaison von Grund auf. Er sieht in Morris einen Mitgiftjäger und droht seiner Tochter mit Enterbung, wenn sie – inzwischen volljährig – gegen seinen Willen diesen elegant und wortgewand auftretenden Habenichts heiratet. Hinter dem Rücken ihres Bruders und nicht ohne eigene romantische Phantasie antichambriert Mrs. Penniman vermeintlich zu Gunsten von Catherine.
Aber der Vater bleibt unbeugsam und will aus einer Haltung, die wirtschaftliche Tüchtigkeit als männliche Haupttugend ansieht, keinen Schritt nachgeben. Catherine ist die Erbschaft nach ihrem sich ja noch bester Gesundheit erfreuenden Vaters nicht so wichtig wie ihrem Bräutigam, der sich zurückzieht, als er sieht, dass eine heimliche Hochzeit zwar von Catherine gewollt wird aber zu einem endgültigen Bruch zwischen ihr in ihrem Vater führen würde. Er lässt Catherine einfach sitzen – vielleicht ist die Leidenschaft seiner Liebesschwüre doch von dem Blick auf die Mitgift geprägt.
Morris verschwindet aus dem Blickfeld von Catherine und ihrem Vater. Die Wunde, die er hinterlassen hat, wandelt sich zu der Würde einer Frau, die ihr auch Jahrzehnte nach den frühen Verletzungen späte Sympathien einträgt. Sie respektiert die Autorität ihre Vaters immer, die verbittet sich aber gelegentlich bei allem Gehorsam dessen ironischen Umgang mit ihr und lässt den Vorrang des familiären Kapitalismus ihres Vaters ihr Herz nicht vergiften. In den vom Vater auch unter Prestigegesichtspunkten geführten Auseinandersetzungen – Henry James verschnürt sie herrlichen Dialogen – macht Catherine manchen Stich. Im Wettstreit zwischen puritanischem Patriarchat und den Gefühlen einer Frau triumphiert – leise zwar und verhalten – die Herzensbildung. Das Ganze gelingt ohne einen Anflug von Kitsch, ist stets geistreich erzählt, sprüht vor Eleganz und offenbart deren giftige Oberfläche. Der Verlag hat diesem Meisterroman eine würdige Ausstattung spendiert.
Harald Loch
Henry James: Washington Square Roman
Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Bettina Blumenberg
Manesse, Zürich 2014 278 Seiten Leinen 24,95
Shakespeare - der Fixstern am Autorenhimmel
Kritik
Titel Tobias Döring (Hg.): Wie ER uns gefällt. Gedichte an und auf William Shakespeare, Manesse
Inhalt Der Manesse-Verlag hat zum 450. Geburtstag von William Shakespeare eine Gedicht-Anthologie herausgegeben. Unter dem Motto: Welchen Reim machen sich Lyriker auf William Shakespeare dem wortmächtigen Autor, dessen Reimstärke in vielen Wort-Zueignungen gewürdigt wird. Die Jubiläumsanthologie ist von Tobias Döring herausgebracht worden und eint auch einige Originalbeiträge zu dem Band im Auftrag der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Beiträge von Autorinnen und Autoren aus vier Jahrhunderte sind dort versammelt Von Hölderlin bis Pasolini, von Byron bis Nabokov, von Baudelaire bis Lorca und von Lemuel Johnson bis Thomas Brasch reichen die lyrischen Referenzen und Würdigungen in diesem exquisiten Band.
Autor Tobias Döring (Herausgeber) Tobias Döring (geb. 1965) wurde nach einem Studium an der University of Kent und an der FU Berlin 2004 an die LMU München berufen, wo er einen Lehrstuhl für Englische Literaturwissenschaft innehat. 2011 zum Präsidenten der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft gewählt, hat er sich als Herausgeber, Autor und Rezensent weit über den akademischen Zirkel hinaus einen Namen gemacht.
Cover Shakespeare-Porträt im Girlanden-Rahmen
Gestaltung Ein in grünes Leinen gebundenes Buch, mit Lesebändchen. Originaltexte, grün gedruckt, zeigen das ursprüngliche Sprachmuster.
Zitat aus dem Buch „Wenn man dich auch citieren kann
Komm doch ein Weil zu mir…“
(Ulrich Bräker)
Shakespeare! – was würdiger auf solchen Namens Klang
Als Schweigen. Stammle nach dem Zauberwort…“ (Robert Browning)
„Shakespeare! Seele und Fackel, Licht, Genius und Feuer!“ (Theodor des Banville)
„Ich habe schon immer gedacht,
dass Shakepeare ein Konsortium war. „ (Eugenio Montale)
„Ich seh dich an der Schreibmaschine schwitzend
Mißbrauchbare Verse herstellen.“
(Heiner Müller)
„Was Sprache kann und wozu Worte taugen, wenn sie ein wirklich Vermögender gebraucht, das demonstriert Shakespeares Theaterwerk durchweg (…) Nur in beständiger Lektüre, im Wiedergeben, Weitergeben, Nach- und Vorsprechen, im Um- und Anverwandeln seines Werkes mag er Ewigkeitswert gewinnen.“
Meinung Shakespeare, wie er uns gefällt zeigt den Dichter als Fixstern am Dichterhimmel –Weltenschöpfer und Provokateur, als ewigen Zeitgenossen, wie der Verlag das Buch ankündigt. 144 Gedichte in zehn Sprachen von Autoren aus 20 Ländern sind hier versammelt. Sieben Themen-Aspekte bilden eine Art Raumteiler für die Kapitel. Inspiration durch Shakespeare, Lebensbühnen und Welttheater, Vorstellungs- und Handlungswelten, Figur- und Maskenspiele, Hamlet-Reden und Ophelia-Bilder, als Abschluss rundet eine komische Coda den Wortreigen ab.
Die Autoren orientieren ihre Wortspiele und Reim-Reihen an der Figur Shakespeare selbst oder an Figuren aus seinen Stücken. Ein Nachwort von Tobias Döring, dem Präsidenten der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, leistet interpretatorische Hilfe für den Leser und die Leserin.
Leser Shakespeare-Fans, Wortakrobaten, Literaturwissenschaftler und Studenten, Anglistiker und Lyrikfreunde.
Verlag Manesse
Keine neue Vorabendserie: Friedrich und Kant
Ursula Pia Jauch: Friedrichs Tafelrunde & Kants Tischgesellschaft
Eine freche Schweizer Philosophin stößt den großen Friedrich vom hohen Ross. Das muss man gelesen haben, wenn man geistreiche und sprachmächtige Polemik über historische Vorgänge mag, die 250 Jahre alt sind. Das hat hohen Unterhaltungswert, hält allem, was die Welt mit Deutschland verbindet einen Spiegel vor, turnt an, klärt auf und liegt zuweilen kräftig neben der Sache. Ursula Pia Jauch ist in Zürich Professorin für Philosophie, vorzugsweise des 18. Jahrhunderts. Promoviert hat sie über Immanuel Kant und habilitiert hat sie sich mit einer Arbeit über Julien Offray de La Mettrie.
Beide Themen sind ihr also bestens vertraut und sie schöpft in ihrem Buch „Friedrichs Tafelrunde & Kants Tischgesellschaft“ aus einem bereits früh erarbeiteten Fundus. Dass sie mit dem Potsdamer Friedrich so gnadenlos umgeht und auch bei Kant ein Einknicken seiner zum Selbstdenken auffordernden Aufklärungsphilosophie vor dem frederizianischen Obrigkeitsdenken diagnostiziert, entspringt einer nicht immer historisch gerechtfertigten Sicht der Dinge und einer Demonstration von Urteilskraft, der manche etwas mehr Bescheidenheit wünschten.
Worum geht es in diesem sich an einen Leserkreis jenseits des historischen oder philosophischen Fachpublikums wendenden Buch? In einem ersten Teil beschreibt Jauch die Potsdamer Tafelrunde um die Mitte des 18. Jahrhunderts als eine an homoerotischen Beziehungen nicht uninteressierte Männerrunde, die Friedrich nach seinem geistig anspruchsvollen Geschmack zusammensetzte.
Die crème der europäischen Geisteswelt versammelte sich am Hofe. In Deutschland ist Voltaire der Berühmteste. Wenn es nach der Autorin ginge, sollte eben jener in St. Malo in der Bretagne geborene Julien Offray de La Mettrie diesen Rang einnehmen, über den sie sich habilitiert hat. Dessen Hauptwerk „Der Mensch als Maschine“ gibt der Autorin das Stichwort, über das geistlose Gehorchen, das während dieser Zeit der „deutschen Aufklärung“ am Hofe Friedrichs des Großen für die nächsten 250 Jahre deutscher Gesellschaftsgeschichte eingeübt worden sei. Er selbst fand sein „discours sur la bonheur“ oder auch seine Abhandlung über die Wollust für wichtiger.
Hier knüpft die Autorin an, wenn sie über die homoerotische Libertinage im Rahmen von Friedrichs Tafelrunde nicht ohne Genuss erzählt. Es stimmt, dass Friedrich launisch war, seine Gunst ebenso gewährte wie auch wieder entziehen konnte, dass sich seine „Gäste“ am Hofe vielfach als Gefangene wiederfanden. Jauch dekliniert mit einer gewissen Freude am Zerstören des tönernen Nimbus des „roi philosophe“ die Fälle durch, in denen es den Teilnehmern der Tafelrunde nicht gut erging. Sie führt diesen Nimbus auf eine propagandistische Meisterleistung des taktisch versierten und auch als Intrigant Großes vollbringenden Königs zurück und übersteigert dann diese Erkenntnis mit der Behauptung, Friedrich habe die erste deutsche Propagandaabteilung vor Goebbels geführt.
Vielleicht geht sie dabei eher Goebbels auf den Leim, der Friedrich ja für die Nazis instrumentalisierte.
Im zweiten Teil gleicht sie Friedrichs Politik an seinen philosophischen Äußerungen, vor allem am „Anti-Machiavel“ ab. Friedrich hat drei völkerrechtswidrige Angriffskriege geführt, die in Deutschland die „Drei Schlesischen Kriege“ heißen. Dabei sind Hunderttausende Menschen umgekommen, ein Land verwüstet und an den Bankrott geführt worden. Als Historikerin bewegt sich Jauch auf für sie etwas unsichererem Terrain. Der Siebenjährige Krieg war ein auf zwei Kontinenten geführter Weltkrieg“. Der Hauptkriegsschauplatz lag nicht ein Europa sondern in Amerika, wo England und Frankreich um die Vorherrschaft kämpften. Die so aufgeklärten Briten zahlten Friedrich hohe Summen, um in Europa Frankreichs Truppen zu binden, und das ebenso aufgeklärt Frankreich führte einen – schließlich verlorenen – Kolonialkrieg in Übersee.
Wer diesen Kontext nicht einmal erwähnt, schreibt eben nur die halbe Wahrheit. Aber es stimmt: der „roi philosophe“ war ein kriegerischer Soldat, während sein verhasster Vater, der „Soldatenkönig“ keinen einzigen Krieg geführt hat. Und dann sprudelt es aus Jauch heraus: „Über Jahrhunderte hat die preußische Legendenschneiderei aus einem rücksichtslosen Kriegsgewinnler eine milde Vaterfigur geschnitzt…Hier und nirgendwo anders liegt die Genese des heutigen deutschen Paternalismus, der hohen Staatsquote, der freiwilligen Selbst-Entmündigung der Bürger in diesem oder jenem vorgeschnürten Sozial-, Bildungs-, Wirtschafts- oder Spar-‚Paket‘“
Der dritte Teil spielt in Königsberg am Tisch von Immanuel Kant. Hier ist die Autorin wieder in ihrem Element und honoriert die frühen Schriften des ja in der Krönungsstadt der preußischen Könige lehrenden Philosophen. Wenn er dagegen im Spätwerk den „kategorischen Imperativ“ erfindet, sieht Jauch darin ein Einknicken gegenüber der in Potsdam eingeübten Gehorsamshaltung. Das „Kategorische“ hält sie für die deutsche Geschichte der nächsten 250 Jahre für bestimmend und den Gehorsam für mörderisch, das hirnlose Mitläufertum bei den Nazis und bis in die DDR fortwirkend. Immerhin gelangt sie zu einem Schlusswort, dem man nur beipflichten kann: „Welche Dramen wären der Menschheit erspart geblieben, hätte Preußen auf den großen Königsberger und nicht auf den großen Fritz gesetzt.“
Harald Loch
Ursula Pia Jauch: Friedrichs Tafelrunde & Kants Tischgesellschaft
Ein Versuch über Preussen zwischen Eros, Philosophie und Propaganda
Matthes & Seitz, Berlin 2014 376 Seiten 24,90 Euro