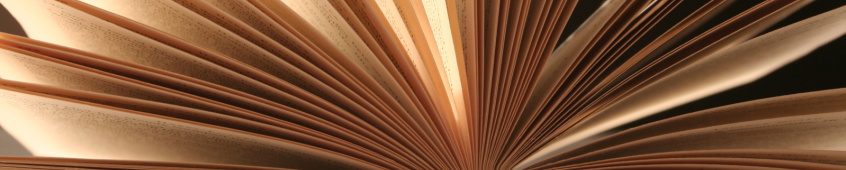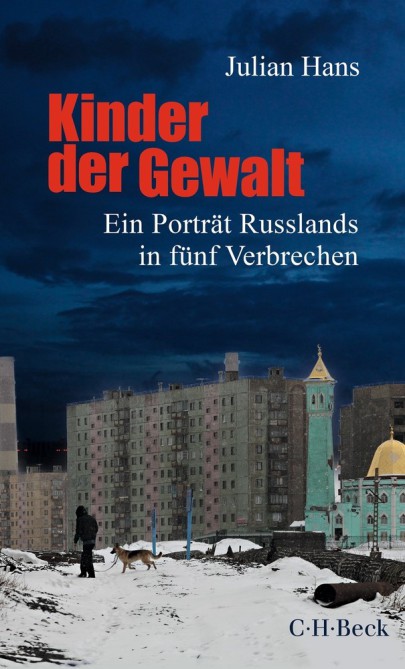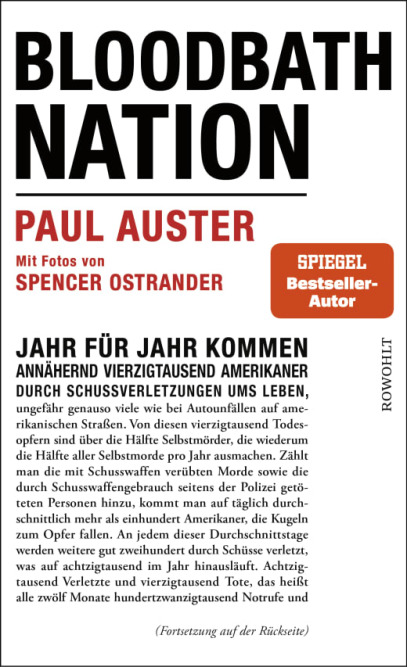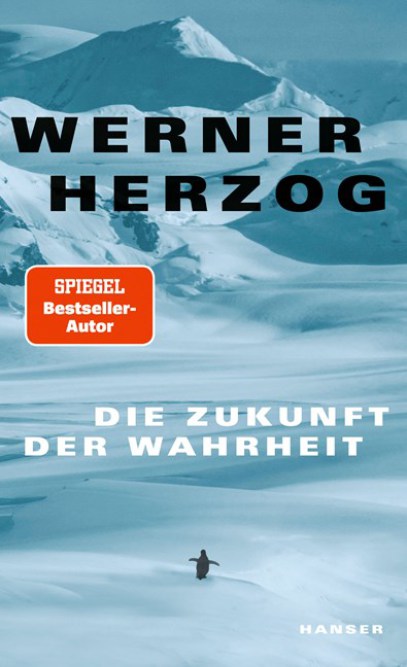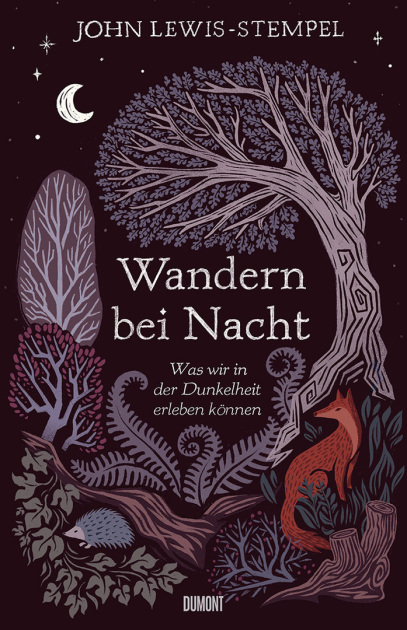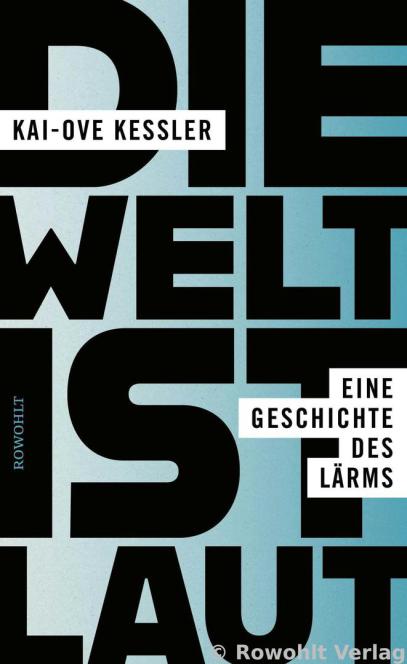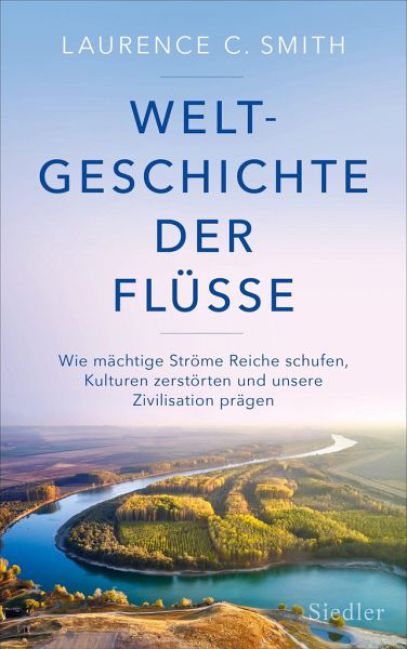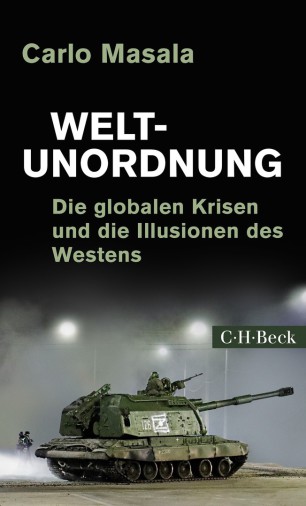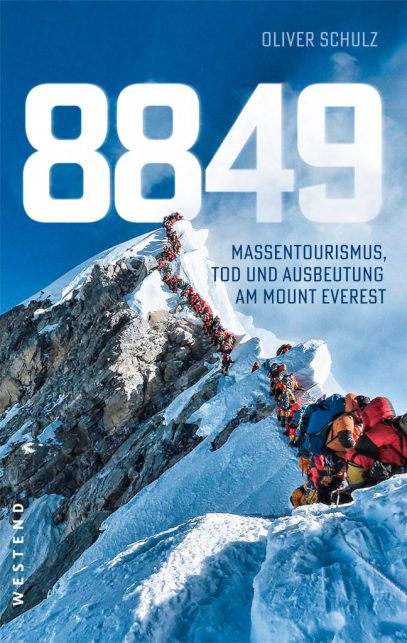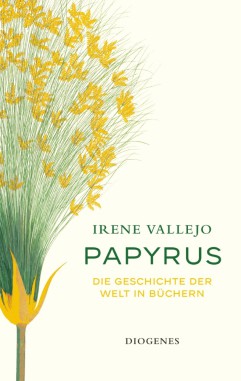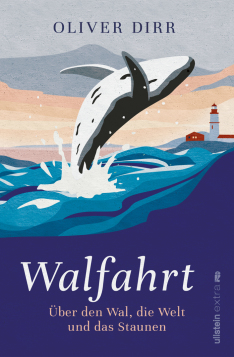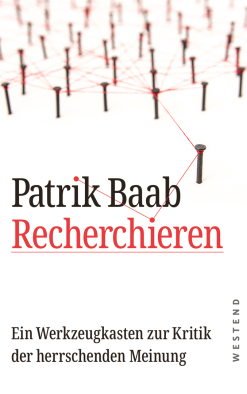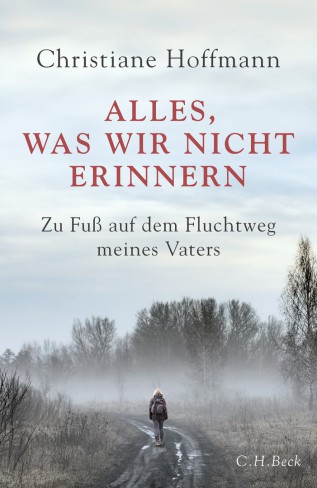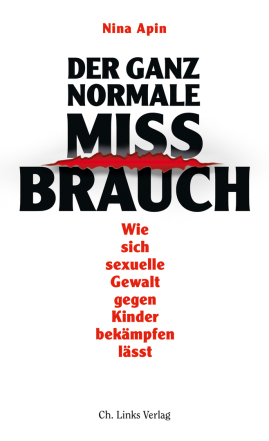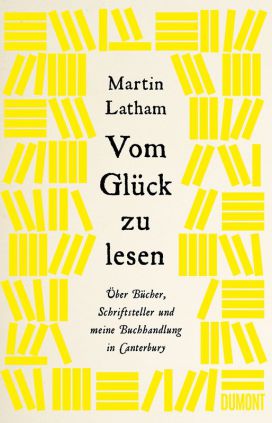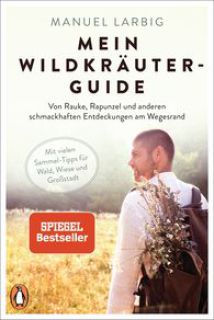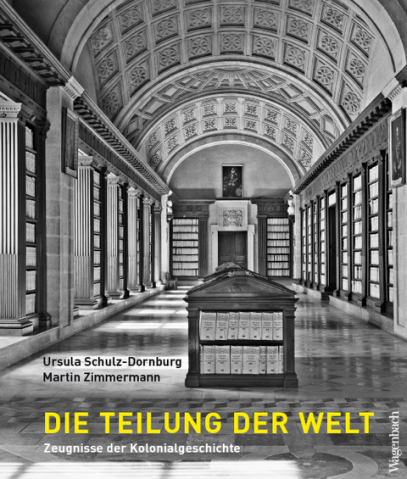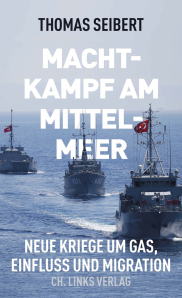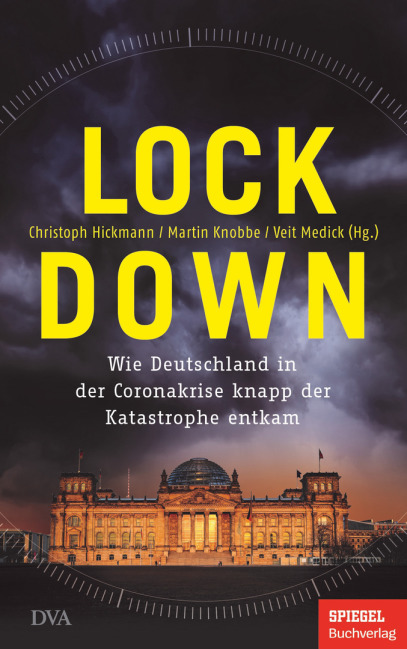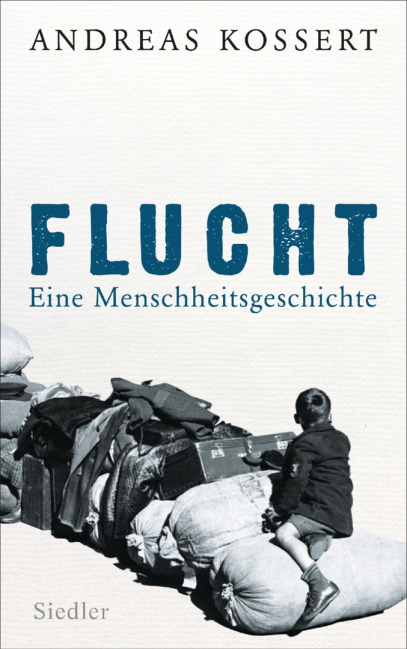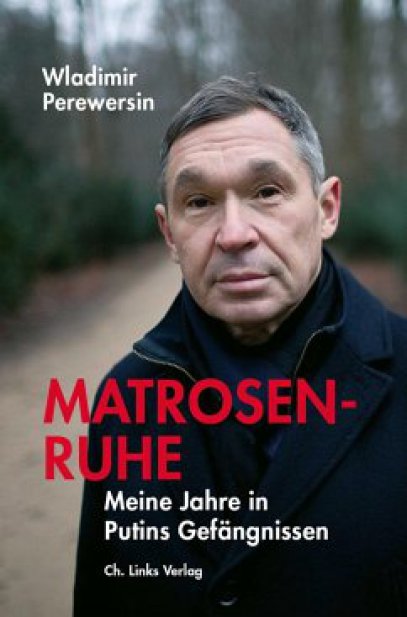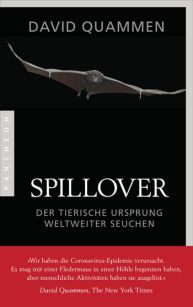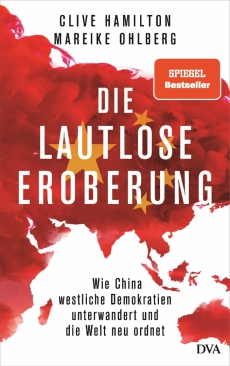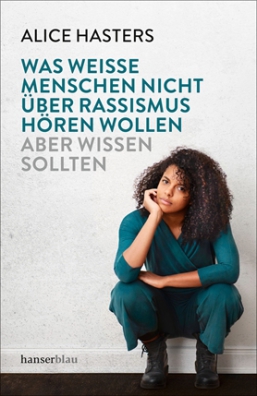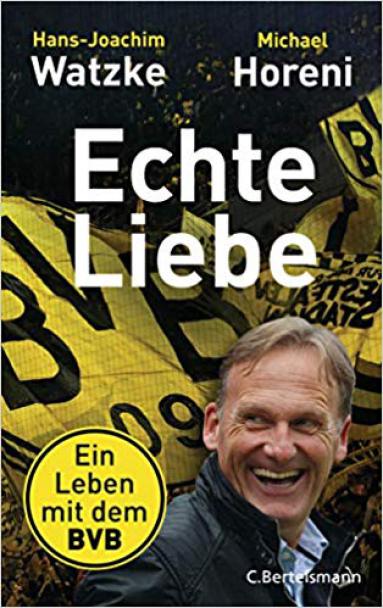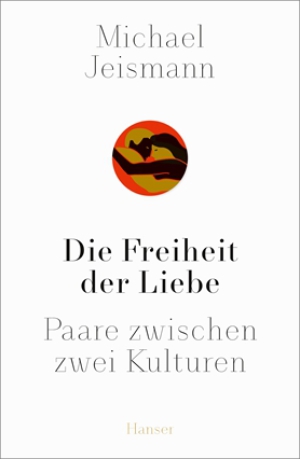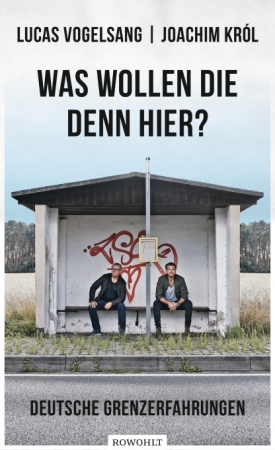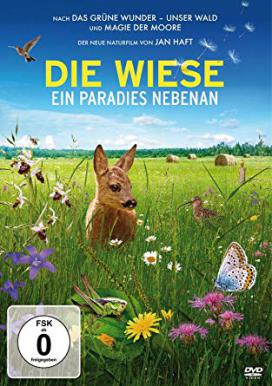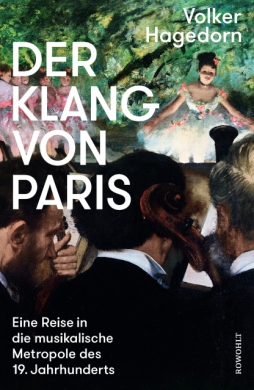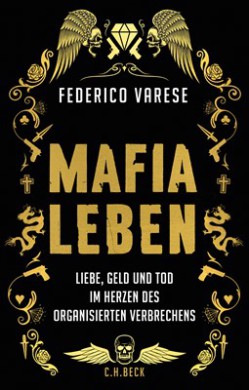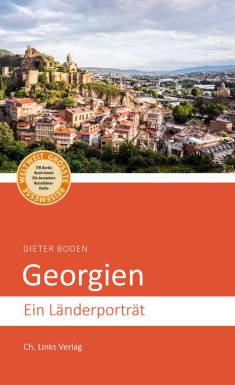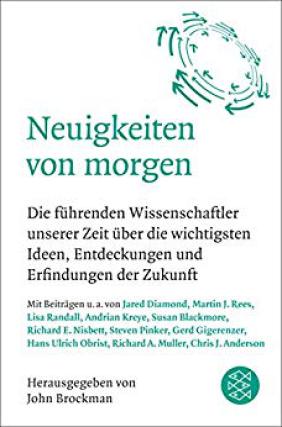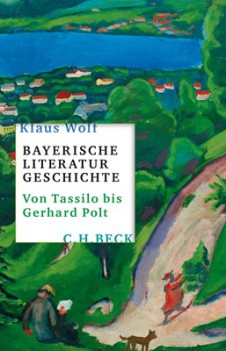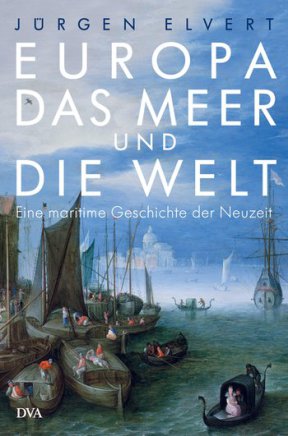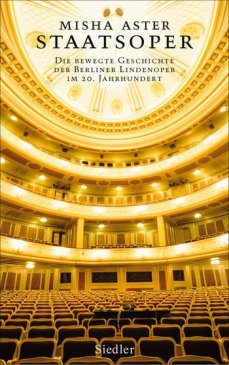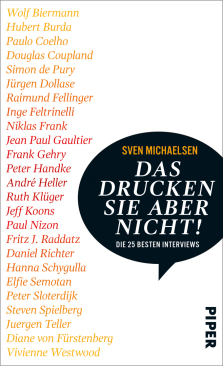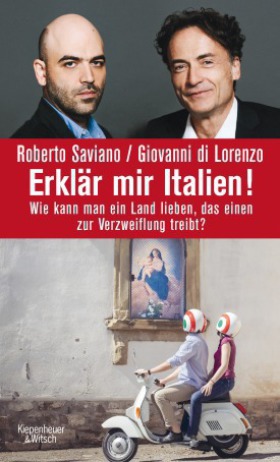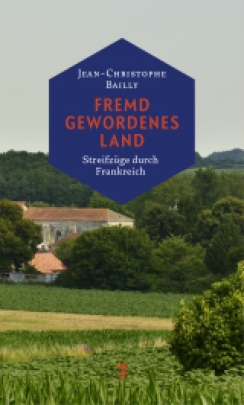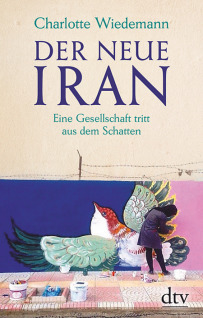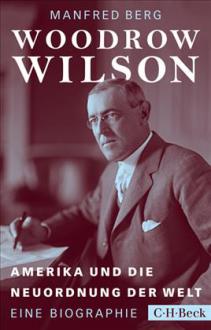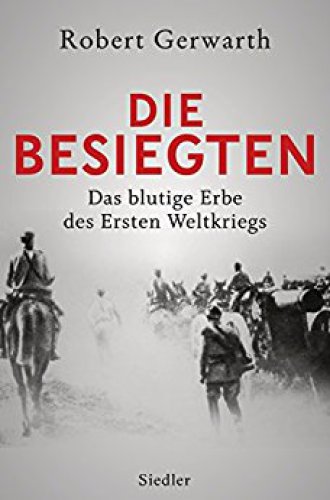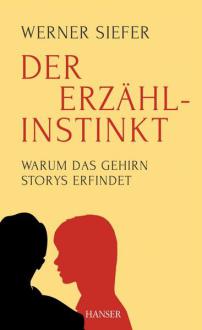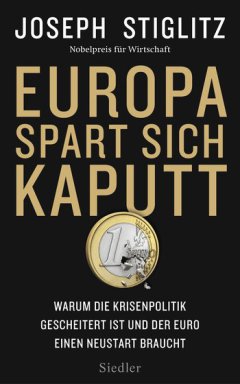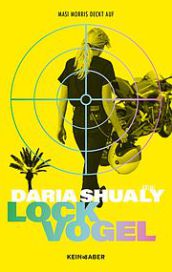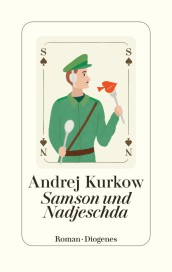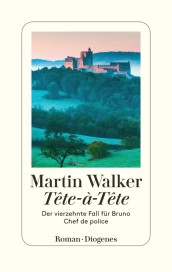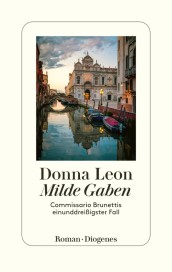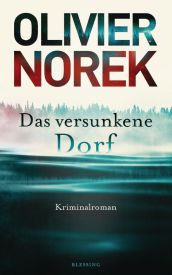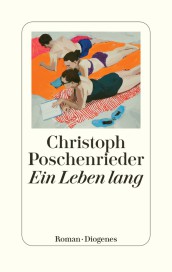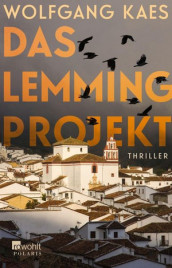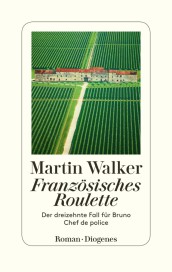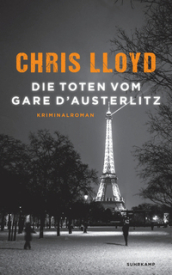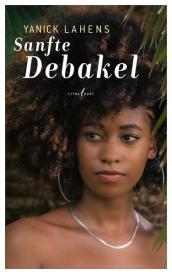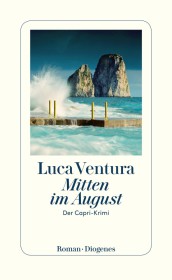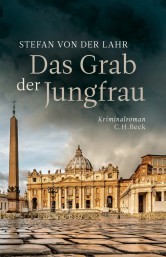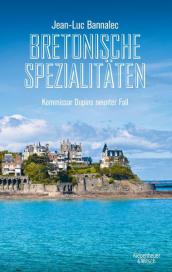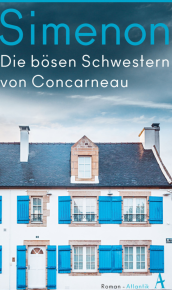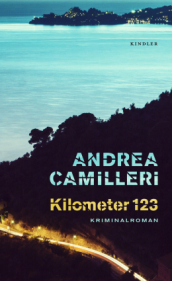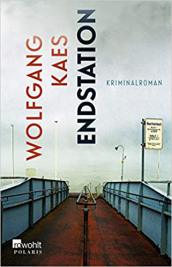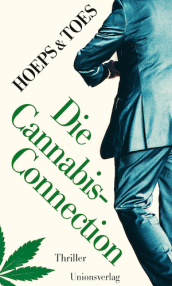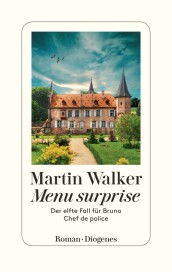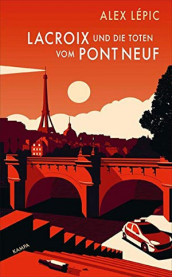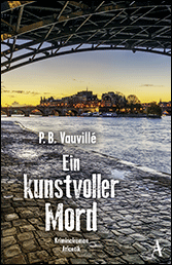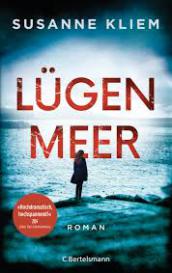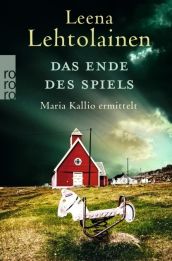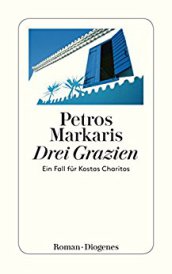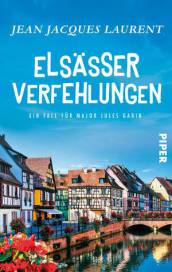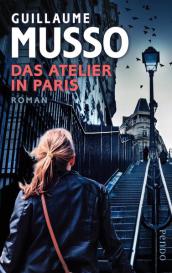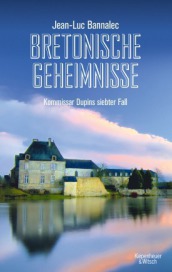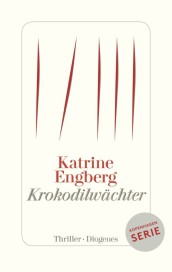Die Gewalt-Nation Russland - fünf Fälle
Wenn von Russland die Rede ist, dann entweder vom Gewaltherrscher Vladimir Putin oder von seinen oppositionellen Kontrahenten, die selten überleben, wie das Beispiel jüngst von Nawalny wieder beweist. Aber was spielt sich in der russischen Gesellschaft ab ganz unten ab, ist die Bevölkerung auf der Seite der Macht oder der Machtlosen? Ist diese Gesellschaft geteilt oder zersplittert? Die Herrschaft beruht in jedem Fall auf der Ausübung von Gewalt und der Beherrschung von Lügen, Täuschung und Betrug. Die rücksichtslose Brutalität, die dabei an den Tag gelegt wird, erschreckt immer wieder. Es ist sehr verdienstvoll, dass der jahrelange Moskau-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, der inzwischen in München als freier Journalist lebt, einmal genauer hinsieht, was sich eigentlich ganz unten in der ehedem sozialistischen, nun russischen Gesellschaft abspielt.
Das Porträt Russlands entsteht aus der Darstellung von fünf einzelnen Verbrechen. In der Einleitung schreibt der Autor aber auch zum Kriegsgeschehen: Warum lassen Russen sich scheinbar
schicksalsergeben für einen Feldzug gegen die Ukraine rekrutieren? Wieso gibt es so wenig Wertschätzung für das Leben an sich? Das Rätsel, das der Autor auflöst, heißt im Ergebnis: Gewalt
Machtmissbrauch und Lüge wirken nicht nur auf die Gesellschaft ein, sondern auch aus ihr heraus mit neuer Gewalt. Hans hat aus vielen Gesprächen, aus Quellen von internationalen und nationalen Medien
in Russland ein Porträt entwickelt, das in seiner Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglässt. Es ist ein Land, in dem es seit Jahrzehnten keine freie öffentliche Debatte gibt, durch dessen Machtelite
sich das Land in Richtung einer totalitären Diktatur bewegt, die Opposition ausschaltet, mit blinder Gewalt vorgeht, die zunehmend auch von der russischen Gesellschaft als ganz und gar normal
hingenommen.
Es sind nicht die großen politischen Fälle, die Hans auswählt, sondern eine Art Alltagskriminalität, die jedoch ihresgleichen in ihrer Nicht-Normalität sucht. So wurde im ersten Fall eine Familie komplett ausgelöscht von Mördern, die nach und nach in einer Region Verbrechen verübt haben, Morde Erpressungen, Vergewaltigungen, ohne dass die offiziellen Behörden eingegriffen hätten; im Gegenteil die Polizisten stellten sich an die Seite der Banden, die Aufklärer waren mit dabei, alles zu vertuschen. Massenmorde blieben erst einmal ungesühnt.
Es geht dem Autor darzustellen, wie Polizei Justiz und Politik in der organisierten Kriminalität miteinander verquickt sind: „Und in einer Welt ohne Regeln zählt nur noch Stärke.“
Da werden Schutzgelder mit Gewalt geworben, Mädchen reihenweise zum Sex gezwungen und vergewaltigt, in einer Stadt in Wowa gibt es einen furchtbaren Rekord elf Anzeigen wegen Vergewaltigung innerhalb von 24 Stunden - erschreckend was Hans zusammengetragen hat. Die Herrschaft dieser Bande dauerte über 20 Jahre, und die meisten Opfer gingen gar nicht erst zu der Polizei. In einer Art von brutalen Land Name übernahm dieser Mafia-Clan einen landwirtschaftlichen Betrieb nach dem anderen. Furchtbar und gesinnungslos, dass Täter sogar Opfer aus einem Sarg herausnehmen und den Sarg mitsamt dem Leichnam auf eine nahe gelegene Fernstraße werfen. Unvorstellbar! Man lässt sich kaufen und macht das Spiel der Machtelite mit. Wer Opfer schützen will, kommt auch schnell mal in die Psychiatrie, so, als wären die alten Sowjetzeiten wieder auferstanden.
Auch die Kriegsgegner werden verräumt. Es gibt schließlich kaum eine Zivilgesellschaft in Russland und dann auch erst recht keine Zivilcourage.
Brutalität ist Alltag, Tod und Zerstörung, daran gewöhnt man sich. Die Mafia tritt auch gern mal als Sponsor der Polizei auf, und es werden Millionen hin und her geschoben, um Ermittlungen zu
behindern, und wenn dann mal Täter in den Knast wandern posieren sie in den Zellen am Schaschlik-Grill und beim Festmahl mit Kaviar und Krabben. Hans schildert Partisanenbewegungen, die aus einer
jugendlichen Protesthaltung heraus sich als Hass auf den Staat gewalttätig gerieren. Kriminelle Banden roden illegal den Wald in der Taiga und verkaufen das Holz an China. Töchter ermorden ihren
Vater, weil der sie jahrzehntelang nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch gewalttätig als brutaler Patriarch erniedrigt und unterdrückt hat. Es ist eine Art
Tyrannenmord.
Hans beschäftigt sich auch ausführlich mit der Arbeit der historisch aufklärerisch wirkenden MEMORIAL-Gruppe, die allerdings in letzter Zeit total behindert und offiziell auch als Agentenorganisation in Russland verboten wurde. Hans schildert das Schicksal von Denis Kaagodin, der den Henkern in der Stalinzeit auf der Spur ist, weil er nach Gerechtigkeit sucht. 40.000 Menschen haben als Mitarbeiter vom NKWD dafür gesorgt, dass der stalinistische Terror so erfolgreich wurde, ohne dass später im Großen und Ganzen eine juristische Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit erfolgte.
„In Russland sind Volk und Führung vereint in Verantwortungslosigkeit“ ist das Fazit von Julian Hans.
Ein Beispiel von staatlicher Gewaltausübung in diesem Buch ist die Unterdrückung von Künstlern, die sich in der oppositionellen Ecke um Aufklärung bemühen und um politische Aktionen. Die Verhörsituation, wie sie in dem Buch minutiös dargestellt wird, ist derart brutal, dass der Menschenrechtsgerichtshof sofort eine Klage einreichen müsste. Wo aber wird Gerechtigkeit sein für solche Fälle demnächst in der Zukunft Russlands. Vergewaltigung, Abschiebung in den Knast, öffentliche Herabwürdigung, Drohungen, Skrupellosigkeit Gewalttätigkeit, Vernichtungsfeldzüge gegen oppositionelle Gruppen, das alles macht das ehemalige sowjetische Reich und nun auch wieder Russland zu einer brutalen Gesellschaft des Eigeninteresses, in der eine Verkehrung von Gut und Böse stattgefunden hat, in der das Verbrechen das Normale wurde. Hans beendet sein Buch mit dem Prinzip Hoffnung, es bleiben ziemlich viel Zweifel. Ein großartiges Recherchebuch.
Julian Hans
Kinder der Gewalt
Ein Portrait Russlands in fünf Verbrechen
CH Beck
Die USA - eine Waffengewalt-Nation
Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Massaker-Schauplätze sind geprägt von einer gespenstischen Stille, ruhige Szenen, unspektakulär und Alltags-Situationen, allerdings ohne Menschen, so als würde die Stadtarchitektur Anklage erheben. Auf den Fotos sind weder Waffen noch Mörder noch Attentäter zu sehen, und Opfer schon gar nicht, aber es sind die Schauplätze, an denen Waffen tragende Menschen Andere in großer Zahl getötet haben.
Der dazugestellte Text von Paul Auster ist eine sehr persönliche Abrechnung mit der amerikanischen Kultur und Gesellschaft, die das Tragen von Waffen seit jeher vergöttert hat. Schon in der
amerikanischen Geschichte ist immer davon die Rede, dass eine Waffe in der Hand des freien Bürgers etwas ganz und gar Normales ist. Nach irgendwelchen Massakern teilt sich die amerikanische
Gesellschaft in folgenden Diskussionen immer wieder in Befürworter und Gegner des Waffen-Tragens. In einem sehr eindrücklichen Text erzählt uns Auster auch von seiner Kindheit, er habe zwar nie eine
echte Schusswaffe besessen, aber als Texaner und kleiner amerikanischer Boy waren Spielzeugwaffen etwas ganz Natürliches, und die Kids drückten beim Spielen einfach ab: „Peng, peng du bist tot!“ Die
so ausgelebten Fantasien waren natürlich aus dem amerikanischen Fernsehen und seinen Gewaltfilmen adaptiert. In dieser Massenware an Filmen trugen die Helden und Schurken natürlich Waffen, jeder Art
und Schusskraft, und wer das ansah, war auf der Suche nach der idealistischen Pseudomännlichkeit, schreibt Auster. Später schoss der Autor auf Tontauben, er traf immer, hatte also unglaubliches
Ziel-Talent. Im Fernsehen liefen damals bis zu 30 Western in der Woche, Töten auf der Mattscheibe als alltägliche Routine.
Auster weist daraufhin, dass wir zwar über die Toten reden, aber die vielen, vielen Verletzten immer wieder vergessen.
Zwischen dem Text des renommierten Autors Paul Auster, der Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia Universität studiert hat und Europa gut kennt, für seine Romane, Essays und Gedichte vielfach preisgekrönt ist, hält ein überzeugendes Plädoyer gegen Waffen. Erschütternde Einzelheiten faszinieren im Text, etwa wenn ein Mensch auf eine Highway Überführung marschiert und von dort aus auf Autos und deren Fahrzeugführer gezielt schießt.
Amerikaner haben nach der Statistik eine 25 mal größere Chance angeschossen zu werden als Bürger in anderen reichen, hoch entwickelten Ländern. Es befinden sich 393 Millionen Schusswaffen im Besitz amerikanischer Staatsbürger, mehr als eine Waffe pro Mann, Frau und Kind.
Pro Jahr kommen annähernd 40.000 Amerikaner durch Schusswaffen ums Leben. Auster weist darauf hin, dass auch ein zwei Tonnen schwerer Chevy, wenn er mit 100 Stundenkilometern auf dem Highway herunterdonnert, eine tödliche Waffe sein kann. Dann ist das Gaspedal quasi der Abzug.
Mit Mordanschlägen auf prominente Politiker haben die USA ja genügend Erfahrung: Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy um nur einige zu nennen.
Waffenbesitz war in den Zeiten der Eroberung Amerikas durch den weißen Mann etwas ganz und gar Normales, egal ob Kurzwarenhändler, Rancher oder Kirchendiener, man war quasi gegen die Indianer automatisch ein Berufssoldat als Siedler, in einer Zeit, in der die Schusswaffen das Mittel der ersten Wahl waren.
Besonders beeindruckend ist eine Liste von Notizen aus einer Notaufnahme im Krankenhaus. Schusswaffenopfer werden dort abgeliefert, und die Ärzte notieren etwa „Unterleib-OP, Bauch öffnen, nach
Loch suchen oder Darm durchbohrt nicht nach Kugel suchen, oder Lunge kollabiert nach Durchschuss, oder Knochen zertrümmert.“
Auster listet auch die sogenannten „Maß-Shootings“ auf, die über die Jahre gerechnet einmal am Tag stattfinden. Gewöhnlich mit mindestens vier Opfern. In den Bildzeilen von Attentats-Schauplätzen
werden die Opferzahlen jeweils dokumentiert. Lakonisch notiert Auster, dass schon nach zwei Wimpern-Schlägen nach solchen Attentaten die Lager der Waffen-Befürworter und Waffengegner übereinander
herfallen und dass trotz allem Rufen nach Reform nach zwei Wochen die Diskussionen und Reform- Bemühungen ganz und gar vergessen sind. Ein Buch, das den Leser packt, sachlich und informativ an das
Thema herangeht, ohne Schaum vor dem Mund aber auch nicht mit der eigenen grundsätzlichen Haltung zurückhält, ein Waffengegner zu sein. Eines ist ganz sicher Trump wird dieses Buch sicher nicht lesen
wollen. Es sei denn er munitioniert sich im Wahlkampf Pro Waffenlobby. Eine große Verbreitung in den Vereinigten Staaten selbst sollte diesem Werk gelingen, wegen des überzeugenden Textes und der
beeindruckenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Schauplätzen der Gewalt.
Paul Auster
mit Fotos von Spencer Ostränder
BLOODBATH NATION
Rowohlt
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University und verbrachte nach dem Studium einige Jahre in Frankreich. International bekannt wurde er mit seinen Romanen Im Land der letzten Dinge und der New-York-Trilogie. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Essays und Gedichte sowie Übersetzungen zeitgenössischer Lyrik.
Filmemacher auf der Suche nach der Wahrheit
Ausgerechnet ein Filmemacher macht sich auf, in einem Buch uns die Wahrheit näher zu bringen, wo doch auf Leinwänden in Cinemascope und in Farbe eher Fiction geboten wird als Wahrheit und Realität, erst recht, wenn derlei aus Hollywood kommt. Herzog, der vom Altverleger Michael Krüger dereinst darauf aufmerksam gemacht worden ist: „Du bist nicht nur Filmemacher eigentlich eher Schriftsteller“ verspricht gleich eingangs: „Ein Buch für alle, die sich wundern können.“ Das Fazit schon mal vorneweg: „Wahrheit scheint mir eher als eine immerwährende Bemühung, sich ihr anzunähern.“ Also kein Zustand, kein Ergebnis, kein Schluss, nein Wahrheit ist ein Annäherungsprozess. Und so stellt Herzog die Frage konkreter: „Gibt es so etwas wie eine Wahrheit im Film? In der Poesie, der Kunst? Der Musik?“ Auch hier nur Wege dorthin, ein Türaufmachen in die Richtung, auch in die Richtung von Freiheit.
Bei der Beantwortung solcher Fragen bleibt Herzog bescheiden, er ist kein Wissenschaftler kein Philosoph sein Text reflektiert nur seine Beobachtungen und persönlichen Erfahrung in der eigenen praktischen Arbeit, und seiner künstlerischen Welterfahrung. Und daraus zieht Herzog dann Schlüsse. So begibt er sich auf die Suche. Zuerst entdeckt er, dass die Erzählung über Wahrheit den Erdball oft schneller umrunden kann als die Wahrheit selbst.
Herzogs zweite Einsicht: „Ich habe mich stets vehement gegen den Irrglauben gestellt, dass Fakten mit Wahrheit identisch sind. “Ich habe Cinema Vérité als die Wahrheit der Buchhalter
bezeichnet.“ Herzog ist eben im Gegensatz zu dieser Fakten-Filmschule der Meinung, dass Stilisierung, Erfindung, Poesie und Phantasie eine tiefere Schicht von Wahrheit erkundet werden kann (…)“
Wirklichkeit ist für Herzog nur eine Illusion, denn hinter der Realität verbergen sich die Träume. Herzog bezieht sich immer wieder auf sein Filmemachen oder Operninszenieren. Ob Hitlertagebücher
oder angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak, die Lüge drängt sich vor der Wirklichkeit in den Vordergrund und die Täuschungsmöglicheiten des Internets tun das ihrige dazu. Lehre daraus: „Wir
müssen kritisches Denken neu eichen.“ Herzog folgert, wir müssen erst einmal alles in Frage stellen, mit einer grundsätzlichen „… Schuldvermutung, ein Misstrauen also, die Annahme von Manipulation,
Propaganda und Lüge. Dies scheint mir die einzige Haltung, mit Fake News umzugehen. Das mag pessimistisch klingen, aber ich sehe keine andere Alternative, sich vor Fake News zu schützen.“ Und dann
wird Herzog zum Erzieher: „Jungen Filmemachern, die mich um Rat fragen, hämmere ich ein: Lest, lest, lest, lest, lest. Lest. Wenn ihr nicht lest, werdet ihr vermutlich trotzdem Filme machen, aber im
besten Fall mittelmäßige. Ohne Lesen werdet ihr nie einen großen Film machen.“ Und wie Handke ist Herzog ein Geher, durch Gehen Erkenntnis schaffen. Die DDR-Grenze ist Herzog entlang spaziert: „Die
Welt eröffnet sich dem, der zu Fuß unterwegs ist.“
Und so folgt eine Ansicht und Einsicht in dem Buch nach der anderen: „Im menschlichen Gehirn gibt es keine Wahrheit.“ Und daraus folgt, „ ... dass unser Gehirn nur ein Modell der Wirklichkeit
erschafft, also nicht die Wirklichkeit selbst abbildet (…) Die Wahrheit hat keine Zukunft, aber Wahrheit hat auch keine Vergangenheit. Wir wollen, wir werden, wir dürfen, wir können die Suche danach
aber nicht aufgeben.“
Es sind nicht gerade die revolutionär neuesten Erkenntnisse, die Herzog da auflistet, aber sie passen im Augenblick gut in die Zeit der FAKE-News, Geheimdienstaktivitäten, Kriegstäuschungen zur einer Art Selbstvergewisserung zwischen Fakten und Fiktion.
Werner Herzog Die Zukunft der Wahrheit (HANSER)
Werner Herzog, 1942 in München geboren, lebt in Los Angeles. Sein Werk mit legendären Filmen wie »Aguirre, der Zorn Gottes«, »Nosferatu«, »Fitzcarraldo«, »Grizzly Man«, »Höhle der vergessenen Träume« oder »Mein liebster Feind« wurde mit allen großen Preisen ausgezeichnet. Bei Hanser erschienen 1978 Vom Gehen im Eis, 2004 Die Eroberung des Nutzlosen, 2021 Das Dämmern der Welt und 2022 die Erinnerungen „Jeder für sich und Gott gegen alle.“
PRESSE
„Ein spannend zu lesender Essay.“ Elke Heidenreich, Kölner Stadt-Anzeiger
„‘Die Zukunft der Wahrheit‘ vereint noch mal jene Grundüberzeugungen, für die Herzog seit jeher steht.“ Knut Cordsen, SWR2 lesenswert
„Werner Herzog ist ein Meister des Erzählens; er assoziiert, mäandert, schlägt Haken, als schlüge er Schneisen in einen Dschungel. Das Schöne an dem Buch: Man kann sich treiben lassen wie auf einer Wanderung… Das kluge Buch ist eine Annäherung.“ Peter Helling, NDR Kultur
„Ein Zwischenruf im Zeitalter der politischen Manipulation – auf der Suche nach der Wahrheit mit einem ‚phänomenalen Erzähler‘“ Washington Post
Natur-Nachtschwärmer
Wenn wir das Buch von John Lewis Stempel mit auf unsere Nachtwanderung nehmen würden, um es in aller Dunkelheit bei unserer Wanderschaft durch die Wälder und die Dunkelheit zu lesen, müssten wir eine Taschenlampe oder mindestens ein Handy mit Taschenlampe mitnehmen, um es in der Finsternis lesen zu können.
Der Autor macht uns neugierig auf dunkle Abenteuer fernab der Zivilisation, wenn wir dem Ruf der Wildnis folgen und uns weniger auf das Auge als vielmehr auf das Ohr konzentrieren. Nachts sind vor allem Tiere unterwegs: Hasen hoppeln über Felder, Fledermäuse segeln durch die Lüfte, Igel schleichen auf Wanderschaft umher, während der Großteil der Menschen in der Regel im Bett liegt, jedoch nicht unser Autor der erforschen will, was wir in der Dunkelheit so alles erleben können.
Der Autor übernimmt Wanderungen in den vier Jahreszeiten, gibt uns nützliche Links und ein Glossar für Nachtwanderungen, zärtliche Natur-Illustrationen machen zusätzlich neugierig auf die Nachtwanderungen, die der Autor einstmals begonnen hat, weil sein Pub etwas weiter weg vom Wohnort war. Wandern in der Dunkelheit ist immer schon das reine Vergnügen des Farmers gewesen, der sich auch literarisch auf Wanderschaften begibt und Gedichte mit in den Text streut. Er hört Waldkäuze schreien, trifft sich mit dem DAX im nächtlichen Wald, entdeckt die Rinden der Buchen, die so glatt sind wie ein Robbenfell, spürt wieder seinen Geruchssinn auf, der in der Dunkelheit besonders sensibel ist, denn jede Blume, jede Wiese und jeder Wald duftet nachts stärker, und die Sterne hängen so tief, dass man sie „pflücken kann wie Diamanten von einer Stoffbahn aus schwarzem Samt“. Solche Formulierungen können dem Leser gefallen. Wir gehen durch Wald, über Flüsse, an Hügeln entlang, über die Felder, in verschiedenen Jahreszeiten. Mit den Schleiereulen hat der Autor einen besonderes Verhältnis, immer wieder tauchen sie in seinen Texten auf, denn sie haben etwas Gespenstisches, sie sind Teufel und Todesboten der ländlichen Gegenden und Legenden.
Füchse kreuzen seinen Weg, er entdeckt das krakelige Luft- Gekritzel der Äste, macht sich nachts Notizen, ist beeindruckt von den schwarzen Silhouetten, die sich auf silbernen Wasseroberflächen spiegeln. Wir werden überrascht vom Gesang der Nachtigall, hören den Waldkauz, das Aufliegen von Enten, die Schreie der Füchsin und dumpfes Tuten der Rohrdommel. Dabei ist die Nachtigall ein besonders beeindruckendes Nachtgespenst, denn sie verfügt, so der Autor über ein Gesangbuch mit 260 Liedern.
Da hört er Trillern und Tirilieren und Gluckern und Rattern und Knarren und Chillen und Flöten, die Tonleiter hoch und runter, und zusätzlich noch das Zirpen der Grillen mechanisch und monoton. Aber auch kraftvoll, die Jazz-Schlagzeuger unter den Insekten, wie der Autor findet, und so kommt am Ende des Buches der Wanderfalke John Lewis Stempel zu dem Fazit: „Ich kann einen Fuchs nachahmen aber ich werde nie einer sein, ich kann an der Nacht teilhaben aber ich werde nie zur Nacht gehören.“
John Lewis Stempel Wandern bei Nacht. Was wir in der Dunkelheit erleben können Dumont
JOHN LEWIS-STEMPEL ist Farmer und Autor zahlreicher hochgelobter Bücher. Er ist zweifacher Preisträger des renommierten Wainwright Prize for Nature Writing. Bei DuMont sind bisher seine Bücher ›Ein Stück Land‹ (2017), ›Mein Jahr als Jäger und Sammler‹ (2019), ›Im Wald‹ (2020) und ›Das geheime Leben der Eule‹ (2022) erschienen. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er in England und Frankreich.
Deutschland bedingt abwehrbereit
Masala behauptet: Es ist längst ein Allgemeinplatz, dass die Bundeswehr gegenwärtig nicht in der Lage ist, ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Hat man sein Buch zu Ende gelesen, muss man
bestätigen: Das ist so!
Masala konstatiert zum Beispiel glasklar, die Bundesregierung habe der Nato Fähigkeiten gemeldet, die die Bundeswehr gar nicht besaß. Da täuscht man die eigenen Verbündeten.
Überhaupt, Deutschland ringt spätestens seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine um sein außen- und sicherheitspolitisches Selbstverständnis. Internationale Politik und Sicherheitspolitik waren in
den vergangenen Jahren ins Abseits gedrängt.
Die Realität aber waren Cyber-Kriegsführung, Desinformation, verwundbare Infrastruktur, nicht vorhandenes Material. Die Aufgaben der Bundeswehr wurden nicht als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen. Aber, so resümiert Masala, der an der Bundeswehrhochschule in München lehrt: “Die Probleme würden nicht verschwinden, wenn man die Augen davor verschließt.”
Seine Analyse ist komplett desillusionierend, was die Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr angeht, die nicht länger als drei Tage oder maximal zweieinhalb Wochen betragen könnte, weil allein schon die Munitionsvorräte für kriegerische Auseinandersetzungen nicht ausreichen.
Allein 300 Kampfpanzern hätten 3000 russischen gegenübergestanden, bei einer direkten Konfrontation mit Russland.
Auch das Verhältnis der Deutschen zu Bundeswehr und Kriegseinsätzen sieht Masala kritisch, die Resilienz und Zähigkeit in der Bevölkerung nicht vorhanden, keine Kampfmoral angesichts dessen, was die Ukrainer tagtäglich beweisen. Verteidigung blieb für uns eine unwirkliche Kategorie.
Wir haben auch viel zu viel outgesourced.
Das Buch ist als Interviewbuch in einer Frage- und Antwortspiel-Struktur aufgebaut. Klare, schlaue und kritische Fragen von Sebastian Ullrich und Matthias Hansl, Cheflektor des C. H. Beck-Verlages und dem Programmleiter der Reihen Paperback und C.H. Beck Wissen.
Klartext-Antworten von Carlo Masala, die in ihrer Deutlichkeit heute ihresgleichen suchen in der “verschwiemelten” und “verschwurbelten” Politsprache heutiger Akteure.
Kurz und knapp wird gesagt, was gesagt werden muss, etwa so: Hier im Augenblick geht es weniger um Aufrüstung als um Ausrüstung der Bundeswehr. Und Rücktritte waren gestern.
Fuhrparks wurden privatisiert, Fachkräfte wanderten ab, die Beschaffung zu kompliziert, erschreckende Befunde.
Und wir hätten uns auch nicht ehrlich gemacht, dass das Militär etwas damit zu tun hat, zu töten und eventuell auch getötet zu werden.
So könne sicherheits- und verteidigungspolitische Kommunikation in einer Gesellschaft nicht gelingen, die Politik müsse vielmehr offensiv für Bundeswehreinsätze kämpfen.
Uns müsse klar werden, dass Jemand auf den Fidschi- Inseln sitzen und dennoch so weit entfernt die Münchner Krankenhäuser lahmlegen kann.
Es würden auch im Verteidigungsministerium Entscheidungen getroffen, die nichts mit dem Militär und seinen Aufgaben zu tun haben. Überbürokratisierung ist hier das entscheidende Stichwort. Das Bundesverteidigungsministerium wurde einmal als Verwaltungsbehörde mit angeschlossenen Streitkräfte bezeichnet. Das sagt alles! Zitat: ”Wir haben eine Truppe mit zu vielen Häuptlingen, die zu wenig Fußvolk befehligen”.
Die deutsche Bürokratie hat mehr Angst vor dem Bundesrechnungshof als vor den Streitkräften der Russischen Föderation.
Und so geht es immer weiter mit der Analyse.
Die Kompetenzaufteilungen seien zwischen den institutionellen Ebenen nicht mehr funktionell. Die Wahrnehmungsfähigkeit hat auch gelitten: Die Fachleute und Russland-Korrespondenten überregionaler
Medien waren weitsichtiger, wurden aber von der Politik ignoriert. Man hätte, so Masala, die Logik, die Putins Verhalten zugrunde liegt, früher erkennen können. Man wollte sie nicht erkennen, weil es
einen dazu gezwungen hätte, die eigene Logik zu ändern.
Im Übrigen, das Schlachtfeld bestimme die Optionen am Verhandlungstisch. Die Partei der Grünen hätte diese Logik eigentlich durch die Bank schnell begriffen. Die Lieferung von Panzern hätte viel früher entschieden werden müssen.
Masala spart auch nicht mit Seitenblicken nach Europa und in die USA. Für die USA konstatiert er, dass die amerikanische Außenpolitik an Glaubwürdigkeit massiv verloren hat. Die USA hätten im Übrigen mit ihrer außenpolitischen Hybris die Gegner der Demokratie auch noch gestärkt.
Und was die russische Seite angeht, fordert der Professor für Internationale Beziehungen, wir müssten selbst dazu bereit sein, den Russen rote Linien zu kommunizieren. Wenn wir Russland in dieser Situation eine fundamentale Revision der Grenzen in Europa zugestehen, sind Tür und Tor für zukünftige Aggressionen geöffnet. Manchmal sei die Sprache der Macht die einzige Macht, die der Gegner versteht. Masala sieht es am Ende so: Der Krieg wird den Russen massiv schaden, selbst wenn sie ihn kurz oder mittelfristig gewinnen.
Ein kluges, analytisches Buch. Mit vielen Erkenntnissen, die zitierfähig sind. Und in die Debatte eingehen. Oder teilweise sogar schon eingegangen sind. Denn der Autor ist oft ein Talkshowgast, weil er wie gesagt Klartext redet.
Masala macht auch sehr viele Vorschläge, wie die Bundeswehr reformiert werden kann, und zwar vor allem dadurch, dass mehr Beschaffungskapazität in die Truppe selbst zurück verlegt wird.
So ändern sich die Zeiten. Der Titel “Bedingt abwehrbereit” löste als SPIEGEL-Artikel 1962 die SPIEGEL-Affäre aus, es war von einem “Abgrund von Landesverrat” die Rede, SPIEGEL-Redakteure wurden verhaftet, Minister traten zurück, wer regt sich heute darüber auf? Wenige!
Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr und gefragter Kommentator für deutsche und ausländische Medien sowie häufiger Gast in den großen Polit-Talkshows. Bei C.H.Beck ist von ihm erschienen: "Weltunordnung" (8. Auflage, 2023).
Carlo Masala Bedingt abwehrbereit Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende C.H.Beck
Was unsere Ohren nervt
Wer am Mittleren Ring in München wohnt weiß, was Lärm ist, auch jene Erdenbewohner, die an der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens ihr Eigenheim besitzen. Kai-Ove Kessler, der Autor der Geschichte des Lärms kennt ihn auch als Schlagzeuger einer Heavy Metal Band und tinnitusgeplagter Radiomensch, weiß er wie laut und gesundheitsschädlich Töne sein können. Nicht umsonst heißt es vor jeder Studiotür: „Ruhe bitte!“.
Neuerdings fliegen wieder Tiefflieger über den Bayerischen Wald und hören sich an als wären es überdimensionierte Knalltüten. Auch der Arnbrucker Cessnapilot, der über den Wäldern des Bayerischen
Waldes regelmäßig seine Runden dreht, kann mit seiner Rattermaschine ganz schön nerven.
Illustrativ, dass diesem Buch QR-Codes beigegeben sind, damit kann während des Lesens die Stille vertrieben werden.
Es geht los im Bauch der Mutter mit den Herzschlägen, vorher schon war der Urknall im Weltall zu hören, muss das ein Lärm gewesen sein? Die Rolling Stones, Metallica und die toten Hosen kamen
später.
Im römischen Circus maximus lärmen die Gladiatorenkämpfe: „Horch gewaltiger Lärm wird aus dem Stadion herübergetragen“, kritisiert Seneca. Was würde er schreiben, stünde er samstags im BVB-Block,
wenn die gelbe Elf im weiß-roten Bayernstadion spielt.
Im Mittelalter schon gings pöbelig zu und derb. Kirchenglocken rufen zum Gottesdienst und nerven die Ungläubigen. Lassen wir den Muezzin mal außen vor. Kircheninneres verstärkt sogar den Flüsterlaut
der Betenden.
Das Schießpulver tut sein Übriges in den Jahrzehnten. Straßenhändler haben eine große Klappe. Jahrmärkte oder die Münchner Wiesn machen lautempfindlich. Die Wiener Philharmoniker spielen zu Sylvester
äußerst gerne die „Unter Donner und Blitz-Polka“ von Johann Strauß, reden wir nicht von den Knalltüten um Mitternacht zum Jahresende, wenn von ihnen das Pulver der Chinesen krachend über uns
kommt.
Die Industrialisierung verursachte ebenso Maschinen-Lärm im 19. Jahrhundert.
Bei Mozart gings zu Hause auch turbulent bei Festivitäten zu. Und dann auch das noch: „Gefurzt wird immer in der Nacht, und immer so, das es schön kracht“, schreibt das „Wolferl“ an seine
Mutter.
Ob Strasse oder Schiene, Flugzeuge oder Traumschiffe, sie sind Lärmquellen.
Heinrich Heine sucht sich für sein Begräbnis den Montmartre-Friedhof aus, „weil es dort ruhiger sei und er weniger gestört werde“. Da bin ich nun lärmtechnisch beruhigt, weil ich dereinst im Bad
Dürkheimer „Ruheforst“ meine letzte Ruhestätte finden werde.
Reden wir nicht von Krieg in neuen Kriegszeiten als ein lautstarkes immer wieder kehrendes Phänomen totaler Sinnlosigkeit.
Mauerer hämmern auf Steine, im Dreissigjährigen Krieg ertönte Kanonendonner, Kafka brauchte Oropax beim Schreiben, in den Ozeanen brüllen die Wale, meine Stereoanlage heißt „Teufel“ und hat 200
Watt.
Kessler bezieht sein Lärmwissen aus Tagebüchern, Zeitungen, benutzt Grafiken, analysiert Konstruktionszeichnungen, denn zu den frühen Zeiten hatte Edison sein Aufzeichnungsgerät noch nicht erfunden.
Da ist also die Phantasie des Autors gefragt.
„Lärm ist jedes unerwünschte Geräusch, etwas, was uns nervt oder krank macht. Es muss nicht laut sein: fallende Wassertropfen, das Summen einer Mücke, die im Wind quietschende Tür – manchen fällt das
gar nicht auf, anderen lässt es keine Ruhe“, sagt der Autor in einem Interview mit der österreichischen Zeitung DIE PRESSE.
Einfallslose Musik in Fahrstühlen, kreischende Sportreporter, brüllende Politiker auf Marktplätzen, Durcheinandergerede in Talkshows können mich entsetzlich nerven.
Ich habe diese Rezension in völliger Stille, in dörflicher Umgebung geschrieben und habe Kai-Ove Kesslers Geschichte des Lärms in aller Ruhe genossen. Jetzt werde ich mal das Radio anmachen, um mich
über den aktuellen Schlachtenlärm zu informieren.
Kai-Ove Kessler Die Welt ist laut. Eine Geschichte des Lärms
Kai-Ove Kessler, geboren 1962, ist Journalist, Historiker und Musiker. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk und hat fast genauso lange zur Geschichte des
Lärms recherchiert. Lärm begleitet ihn seit seiner frühesten Jugend: Er ist Schlagzeuger in einer Hardrock-Band. Kai-Ove Kessler hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Hamburg.
Kai-Ove Kessler Die Welt ist laut Eine Geschichte des Lärms Rowohlt
Alles fließt: Weltgeschichte der Flüsse
Früher durften sie einfach fließen, wie sie wollten. Heute werden sie eingekastelt in Flussläufe, Kanäle, Häfen, Staudämme, Flussdeiche. Gerade war ich wieder einmal an der Donau in der Wachau, eine Traumlandschaft für einen Fluss, der bis ins Schwarze Meer fließt und die Lebensader für viele Regionen darstellt. Das Donau-Delta ein Ökoparadies für Vögel.
Aber an den Donauufern spürt man auch das Trennende, wo keine Brücken sind, müssen Fähren helfen. In Passau, der Dreiflüssestadt von Inn, Ilz und Donau droht fast regelhaft Hochwasser, in Regensburg
führt die älteste Brücke Deutschlands, die Steinerne Brück, 1135 erbaut die Stadtteile zusammen. In Königswinter am Rhein fuhr einst John le Carrés Spion, der aus der Kälte kam, im Nebel mit der
Fähre ins Regierungsviertel in Bonn, wie viele Beschäftigte der Ministerien auch. In der Kälte und im Nebel im Winter. Leben am Fluss und Leben mit dem Fluss.
Unglaublich, fast zwei Drittel aller Menschen haben sich nahe einem Fluss angesiedelt.
Viele nehmen Flüsse als Lebensadern erst dann wahr, wenn Bedrohungsszenarien kommen, tote Fische am Uferstrand anschwemmen, Chemiefarben eingelassen werden, Hochwasser die Seitenränder überschwemmt.
Die Flussufer, zum Beispiel an der Donau und für Radel-Fans besonders sind inzwischen touristische Attraktivität. Halb Holland kommt im Sommer an den Rhein.
Der Autor schifft uns in dem SIEDLER-Buch gute vier Milliarden Jahre zurück in der Geschichte der Menschheit, zeigt die Macht der Flüsse, denn als Erdadern und Handelswege sind sie von hoher
Bedeutung, gleich, ob sie Weinberge bewässern oder Äcker düngen, gestaut werden, um Energie zu erzeugen. Kein Wunder, dass die Metropolen sich an ihren Ufern breitmachten. Dort, wo Ernten möglich
waren, entstanden Strukturen und trieben die industrielle Revolution voran.
Was wäre London ohne Themse, Paris ohne Seine, Berlin ohne Spree, München ohne Isar?
Smith führt uns ausführlich an den Nil, ins Zweistromland, auch an Indus, an den Jangtse und den Gelben Fluss.
Dass Flüsse auch von Kriegen beeinflusst werden, sehen wir jetzt, wo Getreide wieder über die Donau transportiert wird, weil Putin den Schwarzmeer-Zugang kontrolliert. Das Buch ist ein spannendes
naturwissenschaftlich und kulturhistorisch orientiertes Buch und ein Roman über die Gesellschaften vergangener Jahrtausende.
Manchmal wird der so genannte Krimi Lesefluss etwas irritiert, wenn der US-amerikanische Geowissenschaftler Laurence C. Smith die Mäander der Flüsse auch im Text nachvollzieht. Aber das ist zu
verzeihen, wenn der Leser und Flüssefreund die Geduld aufbringt den Flusslauf eben als eine Entdeckung der Langsamkeit zu akzeptieren, denn das Wasser sucht sich seinen Weg, wie Texte übrigens
auch.
Laurence C. Smith Weltgeschichte der Flüsse Siedler
Der Amerikaner Laurence C. Smith ist Professor für Geografie sowie Earth and Space Sciences an der University of California in Los Angeles (UCLA). Der bereits mit mehreren Preisen, u.a. dem renommierten Guggenheim Award, ausgezeichnete Wissenschaftler beriet die US-Regierung in Fragen des Klimawandels und lieferte bedeutende Teile des 4. Uno-Weltklimaberichts 2007.
Die politischen Phantasien des Westens
Die einen sahen schon, dass Geschichte einfach so verschwinden wird, (wohin eigentlich?), andere die Auflösung von Politik in Ost-West-Blöcken, wiederum weitere Experten traten mit ihren Expertisen den weltweiten Siegeszug der Demokratie mit an. Diktatur out - Demokratie in.
In seinem Buch WELTUNORDNUNG, das inzwischen in der siebenten Auflage erschienen ist und im Untertitel die Analyse der globalen Krisen und die Illusionen des Westens annonciert, betreibt Carlo Masala
eine schonungslose Analyse der internationalen Beziehungen in einer unaufgeräumten Weltordnung.
Schon Woody Allan beschreibt das Hauptproblem der Menschheit im Weltall an sich, nämlich dass wir immer irgendwo etwas herumliegen lassen. In diesem Fall der internationalen Beziehungen waren es eben
die vielfältigen Probleme, die wir nicht aufgearbeitet haben, weil wir uns in Illusionen flüchteten. Zuviel geträumt. Probleme liegen gelassen.
Und Masala räumt nun in seiner Traumdeutung mit diesen Hirngespinsten gründlich und fundiert, aber auch provokativ formulierend auf. Stabilität und Frieden waren erhofft, Chaos die Folge.
Machtzusammenballung bei Konzernen, Staatszerfall allüberall, Terrorismus, Institutionen in der Krise, die Demokratisierung als Heilmittel aber gescheitert. Soweit die Anamnese. Die Hauptthese und
Therapie Masalas, wir werden uns an den Zustand der Wirrnisse gewöhnen müssen, Regionen werden ins Chaos abgleiten.
Masala erteilt der liberalen Denkweise eine absolute Absage: „Wenn eine liberale Sicht auf die internationale Politik in Staaten mit großen Machtpotentialen dominiert, dann wird sie gefährlich.“
Dagegen setzt Masala eine realistische Denkweise, internationale Politik sei durch das Streben nach Macht gekennzeichnet, internationale Interessen dominieren das Geschehen, Institutionen, Regeln und
Normen des Völkerrechts spielen bei Masalas knallharter Analyse eine untergeordnete Bedeutung, der Wettbewerb im internationalen politischen Geschäft könne sogar in Kriege münden. Masala hat sein
schon früher erschienenes Buch um ein Kapitel zur Ukraine ergänzt. Putins Rache gibt dem Bundeswehr-Politikwissenschaftler eben sehr recht.
Mit vier Illusions-Vorurteilen räumt Masala auf: Demokratisierung, militärische Interventionen, Institutionalisierung und Verrechtlichung haben keine Ordnung hervorgebracht. Der amerikanische
Niedergang und der Aufstieg neuer Mächte taten ein Übriges. Staatszerfall und Re-Nationalisierung, Flüchtlingsbewegungen und Digitalisierungsanforderungern, die direkten Komunikationsmöglichkeiten
tragen zu Machtdiffussionen in den internationalen Beziehungen bei.
Unberechenbarkeit, Unübersichtlichkeit, Überraschung werden daher zunehmen. Aber Vorsicht, die fehlende Ordnung bedeute nicht zwangsläufig nur Chaos, man müsse sich eben an die gegebenen Bedingungen
anpassen.
Und im Schlusskapitel rechnet Masala mit der liberalen Illusion auf, dass ökonomische Interdependenzen (also wirtschaftliche Abhängigkeiten) eine zivilisierende Wirkung haben, der Ukraine-Krieg zeige
das Gegenteil. Konkreter: Geschäfte statt Geschosse funktioniert also auch nicht. Prognose: Der Kampf um die Vorherrschaft wird zunehmen.
Masala erteilt auch seiner eigenen Profession, was man in Bayern eine Watsche nennt, weil die deutsche Politikwissenschaft sich in ihren Elfenbeinturm zurückgezogen hat. Masala will im Gegenteil
Position beziehen, wissenschaftliche Erkenntnisse fürs Publikum übersetzen, nicht im akademischen Reservat verharren, sondern Kontroversen und Debatten zuspitzen.
Das ist ihm in dem Buch und übrigens Putin auch gründlich gelungen. Es geht um die Sprache der Macht, die wir lernen und verstehen müssen. Künftige Handlungsanleitungen für internationale Politik
daraus abgeleitet, liefert Marsala nicht.
Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik und Leiter des Metis-Instituts für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr München.
Carlo Masala Weltunordnung Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens C.H.Beck
Massentourismus am Everest
Schwarze Löcher und waise Erkenntnisse
Nur 15 Minuten bleiben die Erstbesteiger auf dem Gipfel des Mount Everest, nehmen ein paar Pfefferminzkekse zu sich und steigen nach einer Viertelstunde Rundumsicht wieder ab. So einfach hört sich der Triumph an, den der Gipfelstürmer Sir Hillary und sein Sherpa Norgay auf dem höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest, erleben.
Heute ist der heilige Gipfel zu einem Ziel für einen perversen Massentourismus der Luxusklasse geworden, wie der Autor schreibt, mit schrecklichen Folgen für die Bewohner der Region, die Bergsteiger
selbst und natürlich auch für die faszinierende Natur.
Schon der Südtiroler Reinhold Messner hat auf diese Entwicklung am Berg kritisch in Interviews und Büchern hingewiesen.
Inzwischen säumen mehr als 200 Leichen den Trampelpfad zum Gipfel. Mehrere Hundert Gipfeltouristen wagen trotzdem den Todes-Tripp zum Gipfel. Am Hillary-Anstieg entstehen neuerdings Staus im
Eis.
Anschaulich und spannend beschreibt der Autor Oliver Schulz in 22 Kapiteln die Fehlentwicklungen der Bergsteigerei.
Ist der Mount Everest überhaupt der höchste Berg der Erde? Darüber gab es Streit. Woher kommt sein Name? Götter und Dämonen kreisen um den höchsten Gipfel auf diesem Erdball. Die einheimische
Bevölkerung wird geschildert, das Los der Sherpas, die von dieser Art Tourismus leben. Die Tour Messners ohne Sauerstoffmaske, die Todes-Trips, die Extrembergsteiger, die risiko“reichen“
Millionärs-Touristen, das wachsende Müllproblem, die schreckliche Leichengasse, das alles beschreibt der Autor in einer spannenden, reportagehaften Weise, bis hin zum Thema Covid 19 am
Berg.
Am Schluss bietet Oliver Schulz auch Lösungen für das Problem an. Die Expeditionsgebühren sollen zum Beispiel auf $ 35.000 erhöht werden. Gipfelstürmer sollen ein vernünftiges Training absolviert
haben. Das alles sind einzelne Vorschläge auch von nepalesischer Seite. Ob sie wirklich kommen und Erfolg haben, wird man sehen. Ein verdienstreiches Paperback-Buch, das sein Thema so farbenreich
bewältigt, dass es völlig ohne Bilder auskommt, und unter den Weihnachtsbaum gehört, bei hoffentlich guter Schneelage.
Oliver Schulz, geboren 1968, ist studierter Indologe, Tibetologe und Soziologe und arbeitet als Redakteur bei den "Lübecker Nachrichten" sowie als freier Journalist. Er ist Autor der Sachbücher "Indien zu Fuß" (DVA) und "Die Tibetlüge" (vitolibro) und hat zahlreiche Artikel zur politischen Lage auf dem Subkontinent u. a. in Die Zeit, Zeit online, Spiegel, Welt und Media verfasst. Er lebt in Lübeck.
Oliver Schulz 8849 Massentourismus Tod und Ausbeutung am Mount Everest Westend
Sie brennt und ist trotzdem nützlich
Sie führt in Gärten und auf öffentlichen Flächen ein Schattendasein. Bei Berührung verursacht sie Schmerzen, beim Auftauchen in Gärten beginnt ein Reiß-raus. Sie lebt zwischen Unkraut und Heilkraut so nicht gern geachtet dahin, wenn ihr nicht sogar durch gärtnerische oder chemische Maßnahmen die Existenz vollends genommen wird.
Die Große Brennnessel (Urtica dioica) bietet den Raupen von 36 Schmetterlingsarten die Existenzgrundlage. Manche Tagfalter hängen von ihr buchstäblich ab, weil ihre Blüten die einzige Quelle der
Nahrung sind. Ob Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, oder der große Admiral sie alle lieben das grüne Gewächs. Naturgartenfreunde lassen die Blühpflanze bewusst stehen.
Früher diente sie als Grundmaterial auch zur Papierherstellung oder als Textilfärbemittel. Heute spielt die Brennnessel vor allem im Bereich der Pharmazie und der Kosmetik eine Rolle. Dem Wieser
Verlag in Klagenfurt verdanken wir ein attraktives kulturgeschichtliches Buch, das ein tschechisches Projekt um die heimische Große Brennessel bei uns bekannt macht.
Es rückt das grüne Kraut an einen anderen Platz in der „materiellen und geistigen Kultur“, wie es im Vorwort heißt. Eine Ausstellung widmete sich der grundlegenden Bedeutung der
Brennnesselfasern.
Das Text- und Bilder-Panorama reicht von der Brennnessel als Futter-, Speise- und Heilmittel über die Verarbeitung der Brennnesselfasern hin zu Gegenständen, die aus Brennnesseln gefertigt werden.
Das Buch ist mit seinen über 300 Seiten reich, ja geradezu grandios farbig bebildert.
In meinem Garten lasse ich die Wunderpflanze wachsen, damit die Schmetterlinge des Bayerischen Waldes einen Landeplatz und gleichzeitig einen Futtervorrat haben können, und sie dient auch als
Düngemittel im sogenannten Brennnesselsud.
Eine geachtete Kulturpflanze wurde aus dem grünen Kraut nie, obwohl sie geradezu magische Kräfte hat. Sie wächst dort, wo in größerem Maße Stickstoff, Phosphor und Kalium zur Verfügung stehen.
Das Buch versammelt Aspekte der Mythologie, Anekdoten, Märchengeschichten, Volkstraditionen, Nutzungsverhalten, Materialkunde, macht Ausflüge in außereuropäische Kulturen. In Kriegszeiten diente die
Brennnessel als Ersatzmaterial für Baumwolle.
Der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen verhalf der Brennnessel in einem Märchen - „Die wilden Schwäne“ - dazu, dass die verwunschenen Brüder des jungen Mädchens Anna befreit werden
konnten.
Bei der Brennnessel handelt es sich also - wie im Buch überzeugend demonstriert - um einen wertvollen Rohstoff, der zur Herstellung sehr verschiedener Dinge genutzt werden kann. Es wäre also
sinnvoll, einen neuen modernen Erzähler zu finden, der das „kleidende Unkraut“ geradezu märchenhaft aus seinem Schattendasein herausholt und zu einem nützlichen, allseits geachteten Pflänzlein
macht.
Václav Michalička Die Brennnessel Kleidendes Unkraut Kleine Kulturgeschichte 1 WIESER VERLAG Klagenfurt
Václav Michalička: Der promovierte tschechische Ethnologe leitet das Zentrum traditioneller Technologien im Museum des Gebiets Novojičínsko in Příbor und hält darüber hinaus Vorlesungen an der Masaryk-Universität Brno. Seine Spezialgebiete sind Volkskultur, Anthropologie des Waldes und experimentelle Ethnologie. Mit seinem Team versucht er auf innovative Weise untergegangene Technologien zur Verarbeitung von Naturmaterialien zu rekonstruieren. Seine Aktivitäten im Bereich der archaischen und traditionellen Nutzung wildwachsender Pflanzen finden auch im Ausland Beachtung. Seine Ausstellungen wurden mehrfach preisgekrönt. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Studien und Monographien.
Raija Hauck: Geboren 1962, Dr. phil., Studium in St. Petersburg, Brno, Odessa. Slawistin, Übersetzerin, Lektorin an der Universität Greifswald. Leitet
Übersetzungsworkshops und Kulturaustauschprojekte im In- und Ausland. Zahlreiche Veröffentlichungen.
PAPYRUS - übers Schreiben, Lesen, Drucken
In der Einführung meines Lese-Exemplars richtet sich die Autorin an ihre Buchhändler: Bücher, so schreibt sie, bieten Zuflucht vor Notlagen und Schweigen, Bücher lassen über Balkone und Grenzen hinaus reisen, Bücher zu empfehlen, sei eine mächtige Art der Annäherung und des Austausches, etwas ganz Persönliches. Buchhandlungen empfindet Irene Vallejo als einen wohltuenden Raum für Geborgenheit, Begegnung und für das Wort selbst. Buchhändler hätten sich den Kriegen, den Diktaturen und Epidemien, den Dürren, Krisen und Katastrophen entgegengestemmt.
Im Buch selbst geht es dann in einem Parforceritt durch die Jahrhunderte der Bücherwelt. Länder, Autoren, Leser, Menschen, Abenteuer.
Am ägyptischen Hof suchten fremde Reiter nach Büchern, denn sie waren das bestgehütete Geheimnis des ägyptischen Hofes. Der König träumte in Alexandria von der vollkommenen Bibliothek, einer Sammlung
aller Werke der Welt, sämtliche Autoren seit Anbeginn der Zeitrechnung sollten dort versammelt sein. Ägypten schickte Agenten in der Welt umher, die vor allem alte Bücher aufkaufen sollten.
Bücher sind Langstreckenläufer, ihre Technik genial, vollendete Meisterwerke der Menschheit, so praktisch wie etwa Hammer, Fahrrad oder Schere.
Wann entstanden die ersten Bücher eigentlich, war für die Autorin die Kernfrage. Ihr Streifzug durch den Bücher-Kosmos beginnt in Alexandria, in der Stadt der Freuden und Bücher, ihr Husarenritt
führt nach Makedonien. Sie meint, dass die Idee der Welt-Bibliothek in Alexanders des Großen Kopf entstand. Sie befasst sich auch mit Borges Erzählung „Die Bibliothek von Babel“ und kommt zu der
Erkenntnis, dass das World-Wide-Web im Prinzip eine Kopie der Funktionsweise von Bibliotheken ist, verbunden mit einem schwindelerregenden Gefühl für unermessliche Räume. Allerdings muss man aus
heutiger Sicht hinzufügen, ziemlich unreguliert.
Auf Seite 74 kommt sie zum Kern ihres Buches, zum PAPYRUS, er senkt seine Wurzeln in den Grund des Nils, der Halm erreicht den Durchmesser eines menschlichen Arms und eine Höhe von 3 bis 6 Metern.
Über Hunderte von Jahren schrieben Juden, Griechen und später auch die Römer ihre Literatur auf Papyrusrollen.
Die Erfindung des Buches ist die Geschichte eines Kampfes gegen die Zeit. Es geht darum, greifbare, praktische Aspekte des Trägermediums Buch zu verbessern, es geht um Haltbarkeit, Preis,
Widerstandsfähigkeit und Gewicht, es geht um das Überleben der Worte. Die Autorin berichtet auch über ihre eigenen Leseerfahrungen, ihre Lesezeit, die für sie als kleines, vorläufiges Paradies
empfunden wird, bescheiden und vergänglich. Lesen war ein Zauber.
In Rom entstehen die ersten Buchläden. Es waren Kopisten-Werkstätten. Das Wort librarius bezeichnet sowohl den Kopisten als auch den Buchhändler, es war ein und dasselbe Gewerbe. Die Bücher mussten
einzeln reproduziert, Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort niedergeschrieben werden.
Gerne ging die Autorin mit ihrem Vater in Antiquariate, die er so sehr liebte: „Königreiche der Unordnung“. Sie erwähnt auch, dass das geschriebene Wort über die Jahrhunderte hinweg hartnäckig
verfolgt wurde.
„In all der Bücherflut besteht der Wunsch, sich von der Unrast des Unüberschaubaren auszuruhen.“
Die Autorin vergisst auch nicht zu erwähnen, dass nicht verkaufte Bücher retourniert und im Fegefeuer vernichtet werden. In Spanien waren das 2016 von 224 Millionen Büchern 90 Millionen Exemplare,
die meist verbrannt wurden.
Für Stefan Zweig dienen Bücher dazu, sich über den eigenen Atem hinaus mit anderen Menschen zu verbinden und sich so zu verteidigen gegen den unerbittlichen Widerpart allen Lebens und der
Vergänglichkeit und vergessen zu sein.
Fazit: Ohne die Bücher wären die besten Dinge unserer Welt dem Vergessenwerden anheimgefallen.
„Papyrus“ ist eine kenntnisreiche, angenehme, gut zu lesende Bücherreise durch die Regionen dieser Welt und ihre Vergangenheiten, durch die Geschichte des Buches, durch die eigenen Leseerfahrungen
der Autorin, eine üppige Quelle für die Liebhaber des Lesens, ein phantastisches Buch über Bücher und die menschliche Phantasie und ihr Medium. Lesenswert. Für Leseratten ganz besonders…Warum aber,
fällt mir gerade auf, ist dieses Wort für Leseleidenschaft so hässlich besetzt?!
Irene Vallejo, geboren 1979 in Saragossa, studierte klassische Philologie an der Universität von Saragossa und Florenz. Dabei entdeckte sie ihre Leidenschaft für
die Antike. ›Papyrus‹, ihr erstes Sachbuch, wurde in Spanien ein Bestseller und mit den wichtigsten Literaturpreisen des Landes ausgezeichnet. Auch in ihren zahlreichen Auftritten als Gastrednerin
und wöchentlichen Kolumnen in ›El País Semanal‹ und ›Heraldo de Aragón‹ berichtet sie über ihre Passion für die Antike. Sie ist Autorin von zwei Romanen und einigen Kinderbüchern. Irene Vallejo lebt
mit ihrer Familie in Saragossa.
Irene Vallejo Papyrus Die Geschichte der Welt in Büchern DIOGENES
Über den Wal, die Welt und das Staunen
Spätestens seit Melville und Moby Dick haben wir uns für den Walfang und das Schicksal des schwimmenden Säugetiers interessiert. Ökoorganisationen haben schon seit Jahren auf die Bedrohung der Walpopulationen hingewiesen. Nun gibt es ein neues, von einem Journalisten verfasstes Wal-Buch, das von der Hobbyleidenschaft aus motiviert ist. „Walfahrt“ heißt das Buch von Oliver Dirr, der „Über den Wal, die Welt und das Staunen“ schreibt, über die „mystischen Giganten“, und er schwärmt „vom besonderen Glück, Wale zu beobachten“. Der Autor benimmt sich also auch wie eine Art „Walfänger“, er fängt den Leser ein und will ihn zum Wal-Fan bekehren.
Das gelingt ihm außerordentlich gut, denn seine lebendige wie persönliche „Walfahrt“ macht am Ende aus den Lesern „Gläubige“, wie das ja bei Wallfahrten - mit doppeltem L geschrieben - auch sein
soll.
Gehen wir die anschaulichen Lektionen durch: Man unterscheidet Zahn- und Bartenwale. Die Gesetze des Meeres - so der Autor - begünstigen Tiere, die groß und schwer sind, die ohne Mühe große Distanzen
überwinden können, die fähig sind, viel Energie zu speichern und die auf einen Schlag gewaltige Mengen an Nahrung aufnehmen können. Kopf und Maul der Wale sind eben entsprechend riesig. Die heutigen
Wale sind die größten und schwersten Tiere, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, schreibt Oliver Dirr, der sich mit seiner Tochter auf den Weg macht, um die Wale in den Weltmeeren zu
beobachten.
Wo viel Fisch ist, da sind auch die Wale nicht weit. Aber Wale suchen, heißt Geduld haben. Warten, warten, warten, suchen, Blicke herumschweifen lassen, beste Plätze auf den Beobachtungsschiffen
suchen, die es gar nicht gibt, weil nie vorhergesehen werden kann, wo genau ein Wal an die Oberfläche des Meeres kommt, also weitersuchen, aufs Wasser gucken, schauen, schauen, schauen, ob etwas
passiert.
So nebenbei erfahren wir vom Autor auch etwas über die Unterschiede der Meere und Ozeane oder über Vögel, Seen, Flüsse, Wüsten, Steppen und Savannen.
Die Texte kommen nie oberlehrerhaft daher, sondern sie beweisen glaubhafte Neugierde, und sie wecken beim Leser auch dieselbe.
Die Wale legen die längsten Wegstrecken zurück, viele 10.000 km. Trotzdem tauchen sie immer wieder zur selben Zeit in denselben Buchten wieder auf. Sie navigieren exakt von einer Seite des Ozeans zu
anderen, als hätten sie einen Kompass oder ein Radar eingebaut.
Wir sind in Kanada unterwegs, auf Grönland, Island, Australien, New South Wales und auf den Shetlands. Buckelwale, Blauwale, Finnwale und Orcas lernen wir kennen. Sie tauchen auf, sie tauchen ab, sie
blasen, und sie faszinieren mit ihrem artistischen Können.
Übrigens Wale singen auch: Die Lieder eines Buckelwals können bis zu 30 Minuten dauern, manche Wale singen sogar über viele Stunden oder Tage hinweg.
In einem Extra-Kapitel schildert Oliver Dirr auch die Geschichte des Walfangs und seiner Exzesse. Fazit: Der Walfang endet, weil es nicht mehr ausreichend Wale gibt, um die Jagd rentabel zu machen,
und weil niemand mehr bereit ist, das Schlachten zu subventionieren.
Im Schlusskapitel beschäftigt sich der Autor unter der Überschrift „Alles wird gut“ mit dem Thema, wie wir den Walen einen Platz zum Leben lassen und damit auch uns. Wie sagte schon Melville „ […],
denn es gibt keine Torheit der Tiere auf Erden, welche der Irrsinn der Menschen nicht unendlich weit übertrifft.“
Oliver Dirr Wallfahrt Über den Wal die Welt und das Staunen Ullstein
Oliver Dirr, Jahrgang 1978, war viele Jahre Redaktionsleiter bei den Magazinen Neon und Nido, heute gibt er auf »whaletrips.org« Hunderttausenden Wal-Fans Tipps
für ihre eigene persönliche Walfahrt. Er lebt mit seiner Familie in München und im Allgäu und kann es kaum erwarten, seinem kleinen Sohn endlich den ersten Wal zu zeigen. Walfahrt ist sein erstes
Buch.
Von der "Lügenpresse" und "Wahrheitsfindung"
Dieses Buch ist den Gedanken der journalistischen Aufklärung verpflichtet. Zu ihren Kernaufgaben zählen die Kritik und Kontrolle politischer Macht. In der Praxis jedoch wird die Presse häufig zum Apologeten der Mächtigen und zum publizistischen Verteidiger des Status Quo. Statt Macht- und Gewaltverhältnisse aufzuklären, vernebelt sie oft die Interessen von Machteliten und wird so zum Helfer der Gegenaufklärung. Dieses Buch zeigt, wie Kritik und Kontrolle von Eliten wieder in den Mittelpunkt der Recherche gelangen kann. (WESTEND)
Journalismus steht neuerdings selbst in der Kritik. Die Medien werden von der Öffentlichkeit und in Demonstrationen als „Lügenpresse“ gescholten. Ist Journalismus in Zeiten von
Turbo-Informationswelten überhaupt noch ein demokratisches, kritisches, kontrollierendes Instrumentarium?
Das große Wort von der „Aufklärung“ (Immanuel Kant) steht gleich am Anfang als politisches Bestimmungs-Ziel von Journalismus. Es gehe um die „Einhegung politischer Macht“. Dieses Buch will zeigen,
wie Kritik und Kontrolle von Eliten wieder in den Mittelpunkt von Recherchen rücken können und ja müssen. Ich stelle mir jedoch selbst als Journalist und Rezensent hier sofort die Frage: Kann man
schon eingangs ein einziges Ziel so ausschließlich in den Mittelpunkt rücken und andere Funktionen von Journalismus folglich vernachlässigen oder gar nicht erst behandeln?
Der Autor Patrick Baab lässt sich in seinem Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinungen von Ikonen der linken politischen Theorie wie Marx Horkheimer, Adorno aber auch klassisch von Immanuel
Kant und seinem Aufklärungsbegriff leiten.
Zentraler Satz: „Aufklären - das heißt in der Praxis recherchieren.“ Die Machteliten sieht Baab mit Falschinformationen und Rechtfertigungslügen unterwegs. Deshalb müsse sich Journalismus
investigativ fürs Recherchieren entscheiden, gegen die Interessen und den Widerstand mächtiger gesellschaftlicher Kräfte durchsetzen. Dabei sieht er Ideologiekritik als ein Handwerk.
Aber haben in einem Handwerkskasten Meinungssätze wie „Ablenkung von der sozialen Frage“ „Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit“ etwas zu suchen? Der Werkzeugkasten insinuiert ja schon vom
Begriff her, dass die handwerklichen Tipps das Recherchieren im Praktischen erleichtern und verbessern sollen. Na ja, auch Praktiker-Journalisten wie Egon Erwin Kisch oder Theoretiker-Publizisten wie
Walter Lippmann kommen vor und von Habermas natürlich auch der berühmte „Strukturwandel der Öffentlichkeit“.
Der Autor kritisiert grundsätzlich die Rückkehr der allgemeinen Obrigkeitshörigkeit, bemerkt, dass das Agenda-Setting auch ein Agenda-Cutting ist. Sein Rezept dagegen ist aber eben uralt. Der Autor
appelliert an Journalisten: Aufstehen, rausgehen, sich unbequemen Situationen aussetzen und mit den betroffenen Menschen reden. War das nicht immer schon angeraten? Was soll ein Kriegsreporter
derzeit von solchen Sätzen halten?
Die Tipps sind teilweise sehr klassisch, sich als Journalist ein Informantennetz aufbauen, eine Wiedervorlage nutzen. Für den angehenden Journalisten sind die vielen Einzelteile des Werkzeugkastens
in ihrer Breite systematisch aufgelistet aber schon hilfreich. Sie können von praktischem Nutzen sein, etwa wenn es um den konkreten Umgang mit Quellen oder Informanten geht. Wie schützt man seine
Quelle, zum Beispiel? Da heißt auch ein Tipp, den Informanten nicht im Kollegenkreis nennen oder mit dem Chef diskutieren! Reporter sind zuweilen ja eben auch „Klatschweiber“.
Im Werkzeugkasten sind nicht nur die traditionellen Handwerkszeuge - wie Bleistift, Kugelschreiber und Notizblock - vorhanden., sondern auch modern und computerweltaffin Tipps über Datenträger,
Clouds, Browser, Suchmaschinen, Telefonie und Datensicherheit. Ein Kollege von mir sprach in unserer Redaktion immer auch von Gummistiefeln im Kofferraum des Reporters.
Der fortlaufende Text wird immer wieder unterbrochen durch eine grafische Abhebung des Werkzeugkastens, in dem dann die handwerklichen Tipps sehr übersichtlich aufgelistet sind.
Im Schlusskapitel kommt der Autor noch einmal auf seine theoretischen Grundannahmen zurück und diagnostiziert eine „Fassadendemokratie“ und den Zerfall bürgerlicher Öffentlichkeit, in der
vorauseilende Meinungslenkung stattfindet und die sich wandelt von vernunftgeleiteter Debatte zu einem Ort der Zensur und der Denunziation.
Starker Tobak in der Einseitigkeit, irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen und von der Monothese her Widerspruch auslösend.
Ein Handwerkskasten, mit linkem theoretischem Rüstzeug grundiert, dennoch für Anfänger hilfreich und für alte Hasen mal wieder zum grundsätzlichen Überdenken geeignet. Egal ob sie Hassel, Illner,
Will - Müller, Meier oder Schulze heißen.
Patrik Baab ist Politikwissenschaftler und Journalist und hat u.a. an den ARD-Filmen „Der Tod des Uwe Barschel - Skandal ohne Ende“ (2007), „Der Tod des Uwe
Barschel - Die ganze Geschichte“ (2008) sowie „Uwe Barschel - Das Rätsel“ (2016) mitgewirkt. Er ist Lehrbeauftragter für praktischen Journalismus an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und an
der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin.
Patrick Baab Rechrchieren Ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung WESTEND
Flucht und Vertreibung Auf der Suche nach der neuen Heimat
Die Russen kommen: Also fliehen! 22. Januar 1945 - ein Montag - die Wehrmacht macht sich aus dem Kriegsstaub - der Russe ist da. Die Familie der Christiane Hoffmann macht sich auf den Weg gen Westen.
75 Jahre nach Flucht und Vertreibung der Familie Hoffmann geht die ehemalige SPIEGEL-Journalistin Christiane Hoffmann die Fluchtspur noch einmal entlang, durch das heutige Polen, durch Tschechien
nach Deutschland zu Fuß - auf dem Fluchtweg ihres Vaters. Ausgangspunkt ist der Ort Rosenthal der jetzt Różyna heißt, der in Niederschlesien an der Grenze zu Oberschlesien liegt.
Familienerinnerungen treiben sie an zu dieser 550-Kilometer-Wanderung. Das Buch ist zugleich auch die Suche einer Tochter nach ihrem Vater, erschienen bei C.H.Beck – schwarz- weiß bebildert und am
Buchende mit einer Karte der Fluchtroute versehen, die im Egerland am 2.3.1945 endete.
Christiane Hoffmann, die heute stellvertretende Regierungssprecherin ist, arbeitete lange Jahre als Korrespondentin für den SPIEGEL im Ausland, in Moskau und Teheran. Sie hat Slawistik,
osteuropäische Geschichte und Journalistik in Freiburg, Leningrad und Hamburg studiert. Es ist wie in so vielen Familien, die zur Flucht gezwungen waren, dass der Heimatbegriff eine zentrale Rolle
für Diskussionen am Familientisch sorgte. Die verlorene Heimat – die gefundene – auch angenommene? – Heimat.
Hoffmann mischt im Text selbst Erlebtes, Erinnerungen an ihre eigene Lebensgeschichte, mit Szenen ihres Unterwegsseins, berichtet über Gespräche mit Zeitzeugen, beutet historische Quellen aus und
auch andere Lebenserinnerungsbücher. Das ist im Text manchmal etwas sperrig, aber so sind ja auch die Fluchtwege unterwegs mühsam, verschlungen, unbekannt, neu, düster und eben sperrig.
Hoffmann lässt auch immer wieder die Zeiten lebendig werden, als noch der eiserne Vorhang Grenzzäune und Mauern Ost und West getrennt haben.
Ihr „Fluchtweg“ in Anführungsstrichen führt vor allem durch die Dörfer: Von Rosenthal, Lossen, Schweidnitz, Greiffenberg, Zittau, Aussig an der Elbe, Klein Priesen, Karlsbad bis nach Klinghardt im
Egerland.
Zitate leiten die einzelnen Kapitel ein, zum Beispiel eines von William Faulkner: “ Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen.“ Oder Joseph Beuys: “Biografie ist mehr als
eine rein persönliche Angelegenheit.“
Ihr ist auch bewusst, dass ihr Wandern entlang der Fluchtroute heutzutage etwas anderes ist als eine Flucht vor dem anrückenden Feind: „Ich bin nicht auf der Flucht. Nichts bedroht mich, hinter mir
rollt nicht die Front, kein Drache speit sein Feuer, der Russe sitzt mir nicht im Nacken, kein NSDAP-Bürgermeister spielt sich auf.“
Erkenntnisse ergeben sich Schritt für Schritt: „Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl.“ Und Selbstreflektionen: „Den Hang zum Sentimentalen habe ich von dir geerbt.“
Oder „Ich war ein ängstliches Kind, meine ganze Kindheit hatte ich Angst vor dem Krieg und den Russen.“
Immer wieder spielt auch die Schuldfrage an diesem mörderischen Krieg eine Rolle im Gespräch mit der einheimischen Bevölkerung, die Hoffmann immer wieder anspricht und zur Diskussion
animiert.
Sie stellt auch konkrete Fragen an die Bevölkerung: „Wie denkt ihr über die Vertreibung der Deutschen?“ „Die Vertreibung der Deutschen war ein Unrecht“, sagt ein Tscheche. In Tschechien trifft sie auch auf Vorbehalte gegenüber der Europäischen Union, vor allem auch wegen der dominierenden Rolle Deutschlands. Die EU ist keine Herzenssache, eher die Melkkuh für Förderprogramme.
Immer wieder lesen wir Textpassagen, in denen das Historische, das Politische, das Gesellschaftliche der Vergangenheit thematisiert wird, etwa die Frage von Schuld, die Bewältigung von Verbrechen im
Krieg, die Ausrottung der Juden. Die Nazi-Okkupation des Ostens, die neu aufgeworfenen Vergangenheitsbewältigung, aber auch heutige aktuelle Fragen wie die scheiternde Demokratisierung des Ostens,
der neue Trend zum alten Nationalismus der neuen Formen des politischen Chauvinismus werden ebenso angesprochen.
Das Buch endet mit der Krankengeschichte und dem Tod des Vaters und einem Dialog der Tochter mit ihm. Er fügt sich in sein Schicksal und lässt die Therapien im Krankenhaus beenden, findet seinen
Frieden im Tod. Sein Leben hat ein Ende gefunden, der wieder gefundene Fluchtweg seiner Tochter hat ein Ende, eine neue Generation hat ein anderes Verständnis von Heimat, die nicht mehr im Osten
liegt. Irgendwann wird auch diese Erinnerung an Flucht und Vertreibung blasser werden, weil es nur noch wenige Zeitzeugen gibt. So werden dann Bücher zu „Zeugen“. Eine sehr persönliche Geschichte aus
der Geschichte. Und ein Versuch der Bewältigung von Vergangenheit. Und eigener Vergangenheit.
Christiane Hoffmann Alles, was wir nicht erinnern Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters C.H.Beck
Christiane Hoffmann ist Erste Stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Hoffmann studierte Slawistik, osteuropäische Geschichte und Journalistik in
Freiburg, Leningrad und Hamburg. Sie arbeitete fast 20 Jahre für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und berichtete als Auslandskorrespondentin aus Moskau und Teheran.
Anfang 2013 wechselte sie als stellvertretende Leiterin ins Hauptstadtbüro des «Spiegel». Seit 2018 war sie dort Autorin und häufiger Gast in Rundfunk und Fernsehen. Hoffmann ist die Tochter zweier
Flüchtlingskinder. Ihre Vorfahren väterlicherseits stammen aus Schlesien, die Familie ihrer Mutter aus Ostpreußen.
Schutz vor sexuellem Missbrauch von Kindern
Das war der Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Vergangenheit: Mitgemacht und weggeschaut, munter abwiegeln, gründlich relativieren, vollends vertuschen, das große Schweigen konnte sich ausbreiten, hinzu kam der wissenschaftlich begründete Missbrauch durch Reformpädagogik der 1960er Jahre und die komplette Verharmlosung im Zuge des Übereifers der Bewegung für sexuelle Befreiung.
Klären wir heute genug auf? Nein! Zum Beispiel ist der Sport- und Freizeitbereich auch eine wirkungsvolle Tabuzone, nicht nur die Kirchen verschweigen. Was geschieht in den Sporthallen- und
Schwimmhallen, in den Umkleidekabinen und unter den Duschen? Die Autorin hofft auf künftige „prominente Bekenntnisse“ in der Öffentlichkeit.
Die gesellschaftlichen Bereiche, in denen Missbrauch stattfindet, sind breit gefächert: Es geschieht in Familien, Väter sind die Täter, Stiefväter, Vettern und Onkel, kirchliche Autoritäten, Opfer
finden sich auch in Kinderheimen. Pfadfinder- und Kirchengruppen bieten ein Umfeld, und das Schicksal der DDR-Heimkinder ist ein besonderes. Aber vor allem findet Missbrauch daheim statt, im
vertrauten Familienkreis.
Fast 12.000 Fälle werden pro Jahr insgesamt in allen Bereichen an Kindesmissbrauch registriert. Eine Zahl, die erschüttert, wie auch die neuen Ergebnisse der Missbrauchsstudie in der Katholischen
Kirche beweisen. 3.677 Kinder und Jugendliche wurden in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg von katholischen Geistlichen sexuell missbraucht. 1.670 Priester und Diakone wurden
beschuldigt.
Seit einigen Tagen liegt ein neues Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising vor, das die Öffentlichkeit und die Katholische Kirche und ihre Würdenträger schwer
erschüttert. Weitere Betroffene erheben gravierende Vorwürfe, die Justiz ermittelt, kirchliche Verantwortungsträger sind noch am Leben, und haben sich eventuell strafbar gemacht, gar Papst Benedikt
verwickelt. Die Studie spricht von 41 Fällen.Die Verdächtigen könnten nun auch juristisch noch zur Verantwortung gezogen werden.
„Das Trauma sexueller Gewalt ist tief verankert in unserer Gesellschaft“, schreibt die Autorin in ihrem spannenden Buch. Prominente erzählen Intimes, Medien berichten, Gerichte urteilen, aber wie
steht es wirklich um die Bekämpfung des Missbrauchs von Kindern durch sexuelle Gewalt?
Nun, Apin benennt Zielgruppen, die Eltern, Freundinnen, Verwandte von Kindern. Sie klärt auf, wie betroffene Familien Missbrauch erkennen können, und was man dagegen tun kann. Schon der allgemeine
Begriff Missbrauch ist sehr unscharf, verharmlost gar. Stattdessen benennt sexuelle Gewalt die Straftat genauer. Die Folgen des Missbrauchs für betroffene Kinder sind grausam: Panikattacken,
Schlafstörungen, Depressionen, Flasbacks, Kindheitstraumata, die Opfer für ein Leben gezeichnet.
Man unterscheidet pädophile und nichtpädophile Täter (auch Täterinnen). Die Autorin berichtet im Buch dank langjähriger Beschäftigung mit dem Thema über Untersuchungen, benennt Einzelfälle,
analysiert, ordnet ein, besucht die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kinderpornographie beim BKA, beklagt Personalmangel bei den Behörden und den hinderlichen Dauerstreit im Umgang mit Daten.
Ein Extrakapitel beschäftigt sich mit dem Missbrauch in der Kirche und dem laxen Umgang der Institutionen damit. Die starre Hierarchie und die nicht aufklärerische Kultur des blinden Gehorsams
verhindern da komplette Aufklärung. Auch in der Evangelischen Kirche gibt es seit den 1950er Jahren fast 500 Fälle. Die Missbrauchs-Vergangenheit in den DDR-Heimen ist weitgehend noch eine komplette
Tabuzone.
Eine unglaubliche Zahl erschreckt im Schlusskapitel. Ein Kind muss sich an sieben Erwachsene wenden, bevor geholfen wird. Missbrauch geschieht vor allem im Familienkreis, jahrelang bleibt er
buchstäblich „unter der Decke“.
Es geht vor allem um vertrauenswürdige Ansprechpersonen und Beschwerdestellen, Schulung von Personal, Entwicklung von Schutzkonzepten, Verankerung des Themas in Lehrplänen, Ausbildung der Lehrer,
mehr Achtsamkeit in der familiären Umgebung. Längerfristige Strategien bietet da das Internetportal www.hilfeportal-missbrauch.de an.
Übrigens das Klischee vom bösen Mann, der vorbeikommt und die Kinder missbraucht, ist ein Klischee: Fremdtäter sind statistisch gesehen eine Ausnahme.
Hinzu kommt neuerdings die sexuelle Belästigung via Internet. 45 Prozent der Mädchen und 14 Prozent der Jungen zwischen neun und fünfzehn Jahren haben bereits sexuelle Belästigung im Internet
erfahren. Eltern wissen zu wenig darüber, wo ihre Kinder im Netz online sind.
Übergriffe traumatisieren Kinder auch, wenn keine konkrete brutale Gewalt angewendet worden ist.
Es bedarf also einer aufmerksamen Kultur der langfristigen Aufarbeitung und konkreten Erinnerung der Opfer, die zu lange mit ihrer Bedrängnis und ihrem Leiden nicht wahrgenommen werden. Ein Problem
ist auch, die kommerzielle Inszenierung von Kindern als kleine Erwachsene durch modische Trends.
Ein klares, faktenbasiertes, analytisches und in seinen Beispielen sehr anschauliches Buch über ein nach wie vor schwelendes Problem in vielen Gesellschaften, nicht nur in unserer.
Das Buch endet damit, dass die Autorin ein Paradoxon aufzeigt: Einerseits müssen die Kinder durch Eingriffe besser geschützt werden, andererseits müssen Eltern sie aber auch in Ruhe lassen, ihnen
Freiräume gewähren, damit eine ungestörte – auch sexuelle Entwicklung – zum Erwachsenwerden möglich ist.
Kindesmissbrauch – das Fazit der Autorin: eine „stille Epidemie“. Ich füge als Analogie hinzu, wir brauchen dafür dringend „Impfstoffe“. Dieses Buch ist ein Vakzin.
Pressestimmen
„Unaufgeregt und klar analysiert Apin und fordert dringlich besseren Kinderschutz.“ Caroline Fetscher, Der Tagesspiegel
„Dieses Buch tut weh, natürlich. Aber es ist notwendig. Und dass es der taz-Journalistin Apin gelingt, die Pflichtlektüre fast leicht erscheinen zu lassen, ist ein großer Verdienst der Autorin. Chapeau!“ Philipp Gessler, zeitzeichen
NINA APIN Jahrgang 1974, leitet das Meinungsressort der taz. Sie hat in Passau, Aberdeen, Leipzig und Berlin studiert, für ein Internet-Start-up und als freie
Autorin gearbeitet, unter anderem für RBB-Kulturradio, Die Zeit, dpa und Dummy. 2013 erschien ihr Buch „Das Ende der EGO-Gesellschaft. Wie die Engagierten unser Land retten“ (Berlin Verlag).
Nina Apin Der ganz normale Missbrauch Wie sich sexuelle Gewalt gegen Kinder bekämpfen lässt CH.Links Verlag
Lesen und Lesen lassen
Martin Latham ist seit fünfunddreißig Jahren Buchhändler. Er ist promovierter Indologe und lehrte an der Universität von Hertfordshire, bevor er sich entschied, Buchhändler zu werden, beschreibt DUMONT das Leben und Wirken des Autors kurz und knapp.
Dabei hat der Autor unglaublich viel an Sachkenntnis zu bieten, mehr als diese kurze Lebensbeschreibung des Verlags verspricht. Er blättert in seinem rasanten Rundumblick in die fabelhafte Welt der
Bücher eine Vielfalt von Themen auf, die ihresgleichen sucht.
Er entdeckt Trostbücher zum Beispiel aus der Kindheit oder der Zeit des unglücklich Verliebt-seins. Oder Trostbücher, die Kriegskameraden in den Schützengräben unter sich austauschten. Latham
berichtet über lesende Arbeiter und Frauen, über Zensurmaßnahmen und die Macht der Männer durch die Jahrhunderte. Er spürt Autoren nach und bietet Zitate aus den umfangreich aufgelisteten
Beispielbüchern. Rousseau weiß etwa, dass Bücher Selbstbewusstsein fördern können.
Selbst Groschenromanen mit ihrem eigentümlichen Reiz weist der Autor eine Sinnhaftigkeit zu. Die kleinen Büchlein („chapbooks“) mit Gespenster- und Kriminalgeschichten, Texten zu Ritterzügen, von
Prinzessinnen und der Liebe und vielem anderem mehr sind Lesekost durch alle Zeiten. Der Geist der Groschenromane findet heute sogar seine Kunstform in der Graphic Novel, schreibt der Autor.
Ob Straßenmarkt oder Kleinbuchhandlung, ob Amazon oder Bouquinisten am Seineufer in Paris, Lantham bezieht sie alle ein und lässt uns auch teilhaben an manchem Kundengespräch in seiner oder in
Buchhandlungen von Kollegen. Bibliotheken sind für ihn ein Traum. Ein Traum zwischen Welten, die es immer wieder neu zu entdecken gilt. Dabei geht seine Traumdeutung vom 7. Jahrhundert vor Christi im
Reich des assyrischen Königs, über die Badehäuser im Mittelalter bis zur British Library, die den Lesern abverlangt: „Führen Sie keine Stichwaffen mit sich und blättern Sie leise um.“
Lantham, der Prototyp des Bücherwurms gräbt vieles aus und bringt Ordnung ins Chaos. Er analysiert die stille Leidenschaft der Sammler und beschreibt leidenschaftlich die lohnenswerte Stille beim
Lesen und „Das-sich-selbst- Finden“ dabei in irgendeiner selbst gewählten Leseecke.
Wir bekommen sogar mitgeteilt, wann und wo Mick Jagger, Van Morrison oder Madonna den Buchladen betraten und was sie dort suchten und fanden.
Bücher sind Türen zu anderen Welten schreibt der Büchernarr, der weiß, was mittelalterliche Marginalien wert sind, der als Autor einen unglaublich breiten kulturgeschichtlichen und
literaturhistorischen Hintergrund aufweist und dabei nicht vergisst, auch darauf hinzuweisen, dass Bücher auch Gebrauchsspuren aufweisen können und dürfen, ob Eselsohren, Fett auf Covern oder
Reingekritzeltes, alles das findet Lantham auch erwähnenswert. Kernsatz: „Wir sollten unsere Bücher mit unserer DNA versehen. Sie könnte eines Tages das
Einzige sein, was wir hinterlassen.“
Nun werden Sie sich vielleicht wundern, warum ich in dieser Rezension nicht einen einzigen erwähnten Buchtitel benenne oder Autor empfehle. Der einzige Grund ist, kaufen Sie dieses Buch und lassen Sie sich selbst inspirieren und zum Lesen verführen.
Jedem ist ein Kraut gewachsen
Also, das Bild aus meiner Schülerzeit – verdammt lang her - habe ich immer noch im Kopf, unser schlanker, schon etwas älterer Biolehrer turnte mit von der freien Natur gegerbter Haut flink durch Felder und Wiesen, schwang mit einem Kächer-Netz durch die Lüfte, fing Schmetterlinge und bewies uns damit die Naturvielfalt. Meist ließ er sie wieder frei. Oder aber auch zum Nutzen der Naturwissenschaft mit einer Nadel aufgespießt.
Am Wegesrande zeigte er uns dann beiläufig die Wildkräuter-Vielfalt, erzählte etwas von Gottes schöner Natur, aber vom Essen war nicht die Rede.
Das tut Manuel Larbig in seinem Wildkräuter Guide um so lieber, denn Rauke, Rapunzel, Klee oder Klette, Knöterich oder Franzosenkraut wachsen im Wald, auf der Wiese und am Wegesrand, und dürfen als
gesunde Wildlinge verzehrt werden.
Das auffallend schön und attraktiv und farbig aufgemachte Buch, bei Penguin erschienen, bietet Begründungen, warum wir Wildkräuter sammeln sollen, unterscheidet gesunde und giftige Kräuter, weist auf
Umweltgefahren wie Autogase oder den Fuchsbandwurm hin, widmet ein ganzes Extrakapitel dem Thema Schwangerschaft und Stillzeit und serviert am Ende einen Schnellkurs im Bestimmen von Pflanzen.
Pflanzen-Steckbriefe zeigen uns zusätzlich in Text und Bild, um welche Wildlinge es sich in der Natur handelt und wozu sie nütze sind, versehen mit kulinarischen Hinweisen, in welchen Menüs sie wie
verwendet werden können.
Meinem alten Bio-Lehrer hätte das Buch sicher gefallen (mir gefällt es übrigens auch sehr), aber von ihm käme dann der konstruktive Vorschlag, lieber Herr Larbig, machen Sie jetzt ein Buch über Schmetterlinge. Das sehe ich auch so.
Manuel Larbig, Jahrgang 1987, ist Biologe, Wildkräuternarr und Outdoorexperte. Im Raum Berlin führt er Wildkräuterworkshops und Survivalkurse durch. Sein Hang zu Naturerlebnissen mit Minimalausrüstung brachten ihn dazu, ohne Zelt und Schlafsack einmal quer durch Deutschland zu wandern, worüber er in seinem Buch berichtet, um noch mehr Menschen für die Natur zu begeistern.
Manuel Larbig Mein Wildkräuter-Guide Von Rauke, Rapunzel und anderen schmackhaften Entdeckungen am Wegesrand. Mit vielen Sammel-Tipps für Wald, Wiese und Großstadt
Penguin
Ursula Schulz-Dornburg/Martin Zimmermann: Die Teilung der Welt Zeugnisse der Kolonialgeschichte
Was hat der weiße Elefant mit der NASA zu tun? Und was um des Himmels Willen mit dem hinreißend schönen Renaissancegebäude, dessen Abbild den Deckel eines neugierig machenden Buches ziert? Ursula
Schulz-Dornburg hat das Foto hierzu beigesteuert und viele andere künstlerisch wertvolle Lichtbilder von dem Archivo General de Indias in Sevilla. Seit 1785 sind hier 300 Jahre spanische
Kolonialgeschichte in Amerika archiviert. Es enthält neben etwa 90 Millionen Dokumente auch 8000 Karten. Die Fotos zeigen ein prächtiges zweigeschossiges Gebäude, dessen Proportionen traumhaft in die
plaza davor passen. Das Archiv in Sevilla ist ein Monument der längst vergangenen Macht.
Vom Inneren des Archivgebäudes, das zuvor als glanzvolle Börse der Kolonialhändler genutzt wurde, zeigen die Fotos langgestreckte Räume mit reich verzierten Tonnengewölben, mit Regalen für die
Dokumentenmappen und Sichttruhen von handwerklicher Meisterhand. In kleine Erker fällt von außen helles Leselicht. Dann wirft die begnadete Fotografin einen Blick in die Regale, auf die beschrifteten
Rücken der Mappen: „Audiencia Mexico“, „Contratacio“ oder „Buenos Aires“, „Cuba“ oder „Santa Fe“. Hier ist alles gesammelt, was von der ebenso glanzvollen wie grausamen Kolonialgeschichte Spaniens
zeugt. Die begann mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, dessen Bordbuch hier aufbewahrt ist. Auch der berühmte Vertrag von Tordesillas aus dem Jahre 1494 liegt hier. In ihm einigten sich die
Könige Portugals und Spaniens unter Vermittlung des Papstes auf die titelgebende „Teilung der Welt“ durch eine Linie durch den Atlantik.
Hier kommt Martin Zimmermann, der Mitautor des Buches, ins Spiel, der nicht nur die wechselvolle Geschichte dieses Vertrages nachzeichnet, sondern in kleineren Essays Wissenswertes über solche
„Teilungen“ in der Antike und der Neuzeit mitteilt. Sie handeln von der Vermessung der Welt – und der Vermessenheit der Herrschenden, sie unter sich aufzuteilen. Die Berliner Kongokonferenz von
1884/85 teilte Afrika unter den Kolonialmächten auf, die die Afrikaner natürlich nicht an den Verhandlungen beteiligten und das Sykes -Picot Abkommen von 1916, das die Interessensphären Englands und
Frankreichs im Orient absteckte, sind Beispiele, wie lange und verheerend solche Hybris nachwirken kann.
Zimmermann ruft im Kontrast zu diesen Aufteilungen der Erde den Freudenausruf des NASA Astronauten William Anders vom 24. Dezember 1968 auf, als hinter dem Mond plötzlich die Erde zu sehen war: „Oh,
my God! Look at that picture over there. Here’s the earth coming up! Wow, is that pretty!” Es entstand das berühmte NASA Foto AS8-14-2383HR. Ungeteilt – wie schön! Zimmermann wendet sich wieder dem
Archiv, der Aufteilung der Welt und der spanischen Kolonialgeschichte zu. Er berichtet über die Grausamkeiten der Kolonisierung aus der Perspektive des zeitgenössischen Kolonialkritikers, des
Dominikaners Bartolomé de las Casas, des ersten Bischofs von Mexico, der für die Rechte der Indios eintrat. Zimmermann ist Althistoriker an der LMU München und 2021 Sprecher des Deutschen
Historikertags.
Er hat auch die Rolle des Papstes in der Weiterentwicklung des zu ungenauen Vertrages von Tordesillas untersucht. König Manuel I. der kolonialen Konkurrenzmacht Portugal ließ Papst Leo X. im Jahre
1514 kostbare Geschenke überbringen, um ihn für die Vermittlung im Streit mit Spanien geneigt zu stimmen. Zimmermann beschreibt dann sehr unterhaltsam das Aufsehen, das das Paradestück unter den
Geschenken erregte: Es war ein vierjähriger weißer Elefant aus den indischen Kolonien Portugals, der durch die Entdeckung des Seeweges um das Kap der Guten Hoffnung durch Vasco da Gama per Schiff
nach Portugal gekommen war. Etwa gleichzeitig entdeckte Ferdinand Magellan im Auftrag der spanischen Krone den Seeweg um Südamerika. Beide Kolonial- und Seemächte trafen also nicht nur im Atlantik
sondern auch im Pazifik und im Indischen Ozean aufeinander und bedurften der päpstlichen Schlichtung.
Das gut gestaltete Buch mit den schönen Fotos Ursula Schulz-Dornburgs und den das Thema „Aufteilung der Welt“ großzügig in den Blick nehmenden Essays Martin Zimmermanns lädt zum Nachdenken über eine
Zeit nach, die bis heute nachwirkt.
Harald Loch
Ursula Schulz-Dornburg/Martin Zimmermann:
Die Teilung der Welt Zeugnisse der Kolonialgeschichte
Wagenbach, Berlin 2020 153 Seiten zahlr. s/w Fotos 28 Eur
Erdgas-Ansprüche im Mittelmeer
Am Mittelmeer liegen die Wiegen von Kulturen und Religionen. Sein östlicher Teil ist das Scharnier zwischen drei Kontinenten: Europa, Asien und Afrika. Der in Istanbul ansässige Nahostexperte Thomas
Seibert beobachtet von seinem Logenplatz den aktuellen Machkampf, in den nicht nur die Anrainer sondern auch Großmächte verwickelt sind. Was in den Küstenländern passiert, findet im Meer seine
Fortsetzung. Zwei „gescheiterte Länder“ (der Libanon und Libyen) wecken Begehrlichkeiten, zwei NATO-Mitglieder (Griechenland und die Türkei) pflegen ihren seit den 1920er Jahren gewachsenen
Erbkonflikt. Eine Hälfte Zyperns gehört zur EU, die andere eher zur Türkei. Drei regionale Schwergewichte (Ägypten. Der Iran und die Türkei) versuchen eigene Akzente der Hegemonie zu setzen. In
Syrien und Libyen toben von Außenstehenden geschürte Bürgerkriege. Zwischen Israel und Palästina wie dem Großteil der arabischen Welt herrscht der kriegsähnliche Dauerkonflikt. Hier sieht Seibert
nach dem noch von Trump eingefädelten Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten allerdings eine grundlegende Wende zum Besseren für Israel und einen Rückschlag für die
Palästinenser.
Über das Mittelmeer führen seit der Eröffnung des Suezkanals wichtige Schiffsrouten und kreuzen die prekären Flüchtlingswege. Dieses Pulverfass beschreibt der Autor kenntnisreich im zeitgeschichtlichen Kontext. Er nimmt den schon vor Trump einsetzenden Rückzug der USA wie die unter Putin erfolgte Rückmeldung Russlands wahr. Seibert beklagt die Zerstrittenheit und Perspektivlosigkeit der Europäischen Union. Er fordert angesichts der hilflos anmutenden Nahost-Politik der EU bzw. ihrer Mitgliedsländer den dringenden Bedarf einer einheitlichen Außen- und Militärpolitik Europas. Als Beispiel nennt er Frankreichs und Italiens von widerstreitenden nationalen (Öl-)Interessen im Libyen-Konflikt bestimmte Politik.
Wie sich das alles auf die seerechtlichen Verhältnisse in dem wegen der zahlreichen Inseln sehr engen östlichen Mittelmeer auswirkt, machen zwei Karten anschaulich. Die eine zeigt beiden
Mittelmeerrouten der nach Europa strömenden Flüchtlinge. Die andere zeigt die seerechtlichen Gebietsansprüche Griechenlands, der beiden Staaten auf Zypern und der Türkei sowie die Grenzen eines
libysch-türkischen und eines griechisch-ägyptischen Seerechtsabkommens.
Alle beanspruchten Meeresflächen überschneiden sich mehrfach, sind nicht kompatibel. Flottenmanöver der Kontrahenten weisen auf den Ernst der Lage. Auslöser dieser unvereinbaren Begehrlichkeiten sind vermutete bzw. bereits entdeckte Erdgaslagerstätten unter dem Meeresboden. Betroffen sind Griechenland, die Türkei, zweimal Zypern, Libyen, Israel, der Libanon und Ägypten. Solange diese Energieträger die Weltwirtschaft treiben, sind friedliche Lösungen in den aufgeladenen nationalistischen Rivalitäten unwahrscheinlich. Erschwert wird eine Lösung, weil die Türkei dem internationalen Seerechtsübereinkommen im Gegensatz zu Griechenland nicht beigetreten ist. Es bleibt beim Machtkampf am und im Mittelmeer. In ihm bilden sich z.T. widersprüchliche Koalitionen. In Libyen unterstützen die Türkei, Russland und Italien die Regierung in Tripoli, während Frankreich und die Vereinigten Arabischen Emirate die Aufständischen unterstützen. In Syrien helfen Russland und der Iran dem Machthaber Assad, die Türkei steht hier – auch weil es gegen die Kurden geht – auf der Gegenseite.
Im Libanon ist alles noch verwirrender. Neben die staatlichen Rivalitäten treten die religiösen, vor allem die zwischen Schiiten (Iran) und Sunniten (Saudi Arabien). Deren terroristische Ableger wie Hisbollah oder Hamas, aber auch der weitgehend zurückgedrängte sogenannte Islamische Staat führen z.T. auf eigene Faust Kriege, meist gegen Israel. Mit einer gewissen Bewunderung blickt Seibert auf Russland: „Putin kann hier mit jedem reden“. Die USA haben sich viel verscherzt und wollen mit „Middle East“ nichts mehr zu tun haben. Europa hüllt sich meist in perspektivloses Schweigen. Ein alarmierendes Buch!
Harald Loch
Thomas Seibert:
Machtkampf am Mittelmeer. Neue Kriege um Gas, Einfluss und Migration
Ch. Links Verlag, Berlin 2021 239 Seiten 2 Karten 18 Euro
Chronik eines angekündigten Todes
Nach SPIEGEL-Methode sind wir als Leser an der Seite der Journalisten, erleben Recherche und Interviews, Demonstrationen und Beschlusshandeln mit, hören Bürger und Politiker, nehmen an Demos teil, vernehmen die Argumente der Leugner und Grundrechtsbeschützer.
Kurzum es ist ein farbiges, detailreiches, interpretatorisches Panorama einer Pandemie und ihrer Wirkungen entstanden, deren letztes Kapitel noch nicht geschrieben ist.
So ist die Unterschlagzeile auf dem Buchcover derzeit falsch: Wie Deutschland knapp der Katastrophe entkam. Die aktuelle Lage sieht nicht danach aus.
Was bilanzieren die Autoren: Die Grundrechte wurden auf die Schnelle außer Kraft gesetzt. In der Vorbereitung auf die Pandemie haben die Politiker geschlampt, verzögert, verschleppt. Lange haben sie am Parlament vorbei regiert. Bei der föderalen Ordnung überwiegen die Vor- statt die Nachteile, aber sie erzeugt auch Länder-Durcheinander. Die Digitalisierung hat Deutschland verschlafen Die Politik entwickelte nach und nach ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Am Ende stehen fehlende Gewissheiten, ja es taucht gar die Frage auf, ob wir uns auf das Ende eines aufgeklärten Zeitalters zubewegen. Die Menschen suchen sich ihre eigenen Erklärungen und Erzählungen. Die Wahrheit, das Objektive bleibt auf der Strecke. Der Staat agiert als zentraler Wirtschaftslenker. Und was die Europadimension angeht, stehen dem gemeinschaftlichen Krisenmanagement die nationalen Eigeninteressen im Wege. Corona decouvriert auch die Schieflagen im deutschen Bildungssystem.
Das Buch ist also eine vorläufige Corona-Pandemie-Bilanz, in SPIEGEL-Manier flott geschrieben, faktengesättigt, meinungserprobt, solides journalistisches Handwerk, mit dem einzigen Nachteil: Das Ende fehlt, das Schlusskapitel, es kann halt noch nicht geschrieben werden, erst recht nicht, wenn sich die Lage erneut wie derzeit sehr zuspitzt.
Fazit der SPIEGEL-Reporter: In der ersten Welle haben wir die Bewährungsprobe bestanden, das System war flexibel genug, um die Bürger zu schützen - bei allen Schwächen, Versäumnissen und Irrtümern.
Fazit des Virologen Christian Drosten über diese erste Phase: „There is no glory in prevention.“ Was werden wir dereinst über die zweite Welle urteilen, in der wir gerade stecken. „Shame and blame and no prevention!“ ???
Schlusssatz: „Das Virus hinterlässt Verheerungen, tötet Menschen, vernichtet Existenzen, es spaltet die Gesellschaft. Eigentlich aber könnte es das Zeug zu einer Art neuem Gründungsmythos haben.“
Christoph Hickmann/Martin Knobbe/ Veit Medicke (Hg)LOCK DOWN Wie Deutschland in der Coronakrise knapp der Katastrophe entkam SPIEGEL Buchverlag dva
Flüchtlinge, das sind wir alle
Das ist die große Stärke des Autors Andreas Kossert, die Nähe zu seinem Thema, er lässt viele Flüchtlinge aus allen Regionen dieser Welt zu Wort kommen, er versteht es außerordentlich, lebensnah und spannend zu formulieren. Doch was aus all den Flüchtlingsströmen weltweit politisch zu folgern ist, da verhält Kossert sich als Historiker zurückhaltend, widmet dem kein einzelnes Kapitel, sondern nur ein paar Sätze, und weil sie dennoch wichtig sind, sollen sie hier in einem ausführlichen Zitat erwähnt werden: „In jedem Menschen, sagt Rupert Neudeck, steckt ein Flüchtling, viele tragen eine Fluchtgeschichte in sich.
Das Flüchtlingsschicksal ist in vielen Gesellschaften Teil der kollektiven Erfahrung. Das könnte Anlass für mehr Mitgefühl und andere Verhaltensweisen sein. Flucht und Vertreibung als Geißel der Menschheit zu ächten, könnte bewirken, sie bereits im Entstehen zu unterbinden und ihre Ursachen zu bekämpfen, statt immer nur noch höhere Zäune und Mauern zu errichten. Am Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben. Tag für Tag offenbaren sie, wie es wirklich um unseren Planeten bestellt ist. Wieviel Ablehnung Flüchtlinge erfahren, lässt Rückschlüsse zu auf die tiefsitzende Angst der Aufnehmenden, selbst einmal entwurzelt zu werden. Flüchtlinge und ihre Geschichten stehen deshalb für eine alternative Erzählung, die die bislang dominierenden Deutungsmonopole sesshafter Gesellschaften zumindest ergänzen kann. Flüchtlinge und das, was sie erleben und erleiden, führen uns vor Augen, wie zerbrechlich unsere scheinbar so sichere Existenz ist. Sie verschieben die Sicht auf die Welt, weil sich mit jeder Fluchtgeschichte und jedem einzelnen Flüchtling die Frage stellt, wie fest wir wurzeln.“
Kossert schlägt inhaltlich den großen Bogen, vom Flüchtenden in der Menschheitsgeschichte bis zum Flüchtling der Moderne. Er bietet Begriffsklärungen, schildert das Weggehen, Ankommen und Weiterleben
an vielen Beispielen, in vielen Regionen und historischen Zusammenhängen. Und dabei bleibt eine Tatsache immer gleich: „Flüchtlinge, ganz gleich, ob es sich um Fremde oder Landsleute handelt, sind
gewöhnlich nicht willkommen. Daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte nichts geändert.“
Die Ansässigen, die Sesshaften, fühlen sich in ihrer geordneten Welt gestört, entwickeln Abwehrgefühle, beschimpfen die Eindringlinge als Illegale und Asoziale. Die Flüchtlinge werden nicht als
einzelne Person, als Individuum wahrgenommen, sondern als Repräsentant eines anonymen Kollektivs.
Rupert Neudeck, selbst Flüchtling und Retter der Boat-People aus Vietnam und Journalistenkollege beim Deutschlandfunk bringt es auf den Punkt: „… in uns allen steckt ein Flüchtling.“ Auch
Auslandsdeutsche, die deutsche Familienwurzeln haben, etwa die aus Russland, Ostpreußen oder Pommern werden als Fremde wahrgenommen. Vierzehn Millionen deutsche Vertriebene sind nach dem Kriegsende
zu integrieren. Erfolgreich!
Kossert sammelt Zeitzeugnisse, wertet Gespräche aus, zitiert auch aus der Literatur Flüchtlingserfahrungen vielfältigster Art.
Wir erkennen beim Lesen dieses Buches eine Art Flüchtlingstypologie: Was das Typische, das Immergleiche an Flüchtlingsströmen?
Einige seien hier als Beispiele genannt: „Der Flüchtling ist ein Entwurzelter, den der Schatten der Erinnerung niemals verlässt …“
„Es kann jeden treffen, deshalb gehen die Geschichten von Flucht und Vertreibung alle an.“
„Flüchtlinge verlieren ihre Heimat meistens für immer. Sofern sie die Strapazen der Flucht überleben, retten sie sehr oft kaum mehr als das nackte Leben. Dass Überleben möglich ist, ist der
entscheidende Unterschied zwischen Vertreibung und Genozid.“
Es beginnt mit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies, pardon von Eva und Adam, führt über Eroberungszüge, Pogrome, Religionskriege, Hugenottenflucht, Versklavung afrikanischer Völker,
ethnische Säuberungen, Massenvertreibungen, Kriegsszenarien, Rassegesetze, Armutsflucht bis hin zu Massenbombardements und zum Genozid heutiger Tage.
Kossert diskutiert den Heimatbegriff, die Herkunftssituation. Trotz ultramobiler Gesellschaft per Flugzeug, Auto und Bahnverkehr wandern 2015 Flüchtlinge zu Fuß durch ganz Europa, wie einst das Volk
Israel nach der Flucht aus Ägypten. (Navid Kermani) mit Angst, Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung im Gepäck.
Kossert fällt auch auf, dass Frauen oft die Hauptlast der Flucht tragen - physisch und emotional. Immer gehört auch sexuelle Gewalt zum Flüchtlingsgeschehen, ob nach den Vertreibungen Deutscher aus
dem Osten, ob im Jugoslawienkrieg, in Ruanda oder in Libyen, aber auch an den jesidischen Frauen. Sogar in Lagern wird die sexuelle Erniedrigung des Gegners als Gewalt- und Machtmittel
eingesetzt.
Während Urlauber an die Strände des Mittelmeers jetten, sieht es auf dem Meer so aus: „Hier retten wir Leben. Auf See ist jedes Leben heilig. Wenn jemand Hilfe braucht, retten wir ihn. Hautfarbe,
Rasse, Religion – völlig egal. Das ist das Gesetz des Meeres“, schreibt der Autor Davide Enia in „Schiffbruch vor Lampedusa“.
In der Biographie des armenisch-französischen Chansonnier Charles Aznavour heißt es: „Wenn man ein Kind von Emigranten oder Staatenlosen ist, hat man nur einen Wunsch: die Wurzeln, die aus der Heimat
gerissen wurden, in die Erde zu pflanzen, auf die es uns verschlagen hat, und hier zu neuer Blüte zu bringen. Auf neuem Boden gedeihen, ohne die eigene Kultur und Vergangenheit zu verleugnen – das
nenne ich Integration.“
Ein umfangreiches, bewegendes, aufrüttelndes, aufklärerisches Zeitzeugen-Buch, das beweist, Flüchtlingsströme waren auf dem Globus immer schon unterwegs. Nicht alle kommen an.
Andreas Kossert, geboren 1970, studierte Geschichte, Slawistik und Politik. Der promovierte Historiker arbeitete am Deutschen Historischen Institut
in Warschau und lebt seit 2010 als Historiker und Autor in Berlin. Auf seine historischen Darstellungen Masurens (2001) und Ostpreußens (2005) erhielt er begeisterte Reaktionen. Zuletzt erschienen
von ihm der Bestseller »Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945« (2008) sowie »Ostpreußen. Geschichte einer historischen Landschaft« (2014). Für seine Arbeit wurde ihm der
Georg Dehio-Buchpreis verliehen.
Andreas Kossert Flucht – Eine Menschheitsgeschichte SIEDLER
Deutschlandfunk
Lesetermine
15. Okt. 2020
ONLINE: Andreas Kossert zu Gast auf dem Blauen Sofa
17:00 Uhr | Berlin | Lesungen
Andreas Kossert
Flucht – Eine Menschheitsgeschichte
26. Okt. 2020
Andreas Kossert zu Gast in der Villa Quandt
20:00 Uhr | Potsdam | Lesungen
Andreas Kossert
Flucht – Eine Menschheitsgeschichte
Russlands Rechtsstaatlichkeit
Machen wir zunächst eine Begriffsklärung: „Matrosenruhe“ heißt das „Untersuchungsgefängnis Nr. 1 des Föderalen Strafvollzugsdienstes Russlands in der Stadt Moskau“ in der Knastsprache. „Telefonrecht“ bedeutet, dass die Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz in Russland nur auf dem Verfassungspapier steht. In Wirklichkeit ist es so: Hohe staatliche Instanzen wollen wissen, wie Gerichtsverfahren ausgehen, und teilen dies am Telefon mit. Die Zimmer der Geschworenen werden abgehört. Es werden absichtlich formale Fehler in den Prozeßverlauf eingebaut, damit es später Anfechtungsgründe gibt, um ein nicht erwünschtes Urteil aufzuheben.
„Seine Beschreibung des Gerichtsalltags und der brutalen Haftbedingungen gerieten zu einem erschütternden Dokument über den russischen Unrechtsstaat“, schreibt Manfred Quiring im Vorwort. Er war
langjähriger Korrespondent deutscher Tageszeitungen in Moskau.
Es wurden 700.000 Fälle in Russland registriert, bei denen Unternehmen illegal übernommen oder ausgeplündert wurden. Wladimir Perewersin wird im Jukos-Verfahren gegen Chodorkowski zum „Bauernopfer“,
weil er nicht gegen Chodorkowski aussagen will, sich nicht zum gekauften Zeugen machen lässt. Er bezahlt das mit einer zugesprochenen Strafe von mehr als elf Jahren Freiheitsentzug in einer
„Besserungskolonie mit strengem Vollzug“, Straferlasse durch Änderung der Gesetze bewirken jedoch, dass er „nur“ sieben Jahre und zwei Monate in russischen Gefängnissen absitzen muss.
Während seiner Gefangenschaft stirbt sein Vater, sein Sohn wächst ohne ihn auf. „Mein Leben wurde zerstört, meine Gesundheit ist ramponiert, die Karriere ruiniert.“ „Es klingt absurd, aber es hätte
jeden beliebigen Mitarbeiter der Gesellschaft statt meiner treffen können. Doch die Wahl fiel auf mich.“ Seine innerliche Stärke lässt ihn überleben.
Wladimir Perewersin baute eine Filiale des Ölunternehmens in Zypern auf. Er war zuständig für die Auslandsschulden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete, über Tochterfirmen Rohöl für einen zu
niedrigen Preis aufgekauft und dann wieder teuer weiter verkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft interpretierte den Jukos-Fall so: Das Öl wurde bei den erdölfördernden Gesellschaften gestohlen, und
zwar genau in dem Moment als es an die Handelsgesellschaft verkauft wurde. Wladimir Perewersin bestritt vor Gericht, Finanztransaktionen getätigt zu haben.
Für das Gericht war das klar Betrug. In den „wilden“ 1990er Jahren gingen jedoch russische Ölfirmen genauso vor, um Steuern zu sparen. Perewersin behauptete in dem Verfahren, er hätte gar keinen
Kontozugriff gehabt.
Wladimir Perewersin erleidet disziplinarische Strafen, wird in Einzelzellen geschafft, muss Isolationszellen erdulden, in denen man nicht einmal sitzen kann. Er erlebt den alltäglichen Terror unter
Dieben und Mördern. Die Menschen in den Zellen wechseln ständig, schikaneartige Durchsuchungen sind an der Tagesordnung, Psychoterror und Schläge mit dem Gummiknüppel drohen jederzeit. Einmal pro
Woche duschen und in Schichten schlafen, weil Betten fehlen. Wer Rechte einfordert gilt als aufsässig, es folgt die „Erziehung“ durch Exerzieren.
Perewersin zeigt auch seine soziale Seite in Haft, hilft den Häftlingen, Klagen oder Gesuche zu formulieren oder spielt nach Aufforderung der Gefängnisleitung „Kabarett“ im Knast.
Man lernt hinter Gittern vorzüglich zu lügen, zu betrügen und zu heucheln, schreibt Perewersin.
In Russland findet sein Sohn keinen Job, die Frau wird vom Arbeitgeber gekündigt: Sippenhaft!
Ein eindringliches, mit schreiberischem Talent geschriebenes Buch, das minutiös seinen tristen, grauen, Kraft fordernden Gefängnisalltag hinter dicken, allerdings von außen betrachtet, buchstäblich
bröckelnden Mauern schildert.
Die Yukos-Zusammenhänge kommen jedoch kaum vor; seine „Biznes-Zeit“ bei dem Ölunternehmen streift Perewersin nur. Da hätte man gerne mehr gelesen. Seit 2014 lebt Perewersin in Berlin.
PRESSESTIMMEN
„Eindrucksvoll wie erschütternd“
Richard Herzinger, Die Welt
„Wladimir Perewersin verdanken wir einen schonungslosen Einblick in die Welt der postsowjetischen Lager.“
Jan Claas Behrends, Der Tagesspiegel
„Ein wichtiges und gut geschriebenes Buch.“
Mario Pschera, Neues Deutschland
„Ein Buch, über das Olga Romanowa, die Leiterin einer Selbsthilfegruppe von Ehefrauen von Häftlingen, im Vorwort schreibt, es sei das Beste, was sie jemals über Gefängnisse gelesen habe. Gut
möglich, dass sie Recht hat.“
Deutschlandfunk, Andruck
Wladimir Perewersin Matrosenruhe. Meine Jahre in Putins Gefängnissen Ch. Links Verlag
SPILLOVER - der tierische Ursprung weltweiter Seuchen
Begriffsbestimmung
Zunächst müssen zwei Fachbegriffe geklärt werden: SPILLOVER kann als ein Übertragungseffekt bezeichnet werden. „Spill over“ kommt aus dem Englischen und bezeichnet
einen Zustand oder ein Ereignis, wenn etwas überläuft, also quasi verschüttet wird.
Der Begriff ZOONOSE bezeichnet eine Krankheit, die ursprünglich in Wildtieren zuhause ist und auf den Menschen überspringt. Zoonosen sind Infektionskrankheiten,
die auf natürliche Weise von Wirbeltieren auf Menschen übertragen werden können und umgekehrt.
Zoonosen können von Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten und Prionen verursacht werden. 60 Prozent aller Infektionskrankheiten sind Zoonosen, und 72 Prozent sind durch Wildtiere verursacht.
Methode
David Quammen interviewte Ärzte und Forscher, besuchte Labore, wissenschaftliche Institutionen und Gesellschaften. Er begleitete Wildführer und Wissenschaftler im Dschungel, er besuchte
Wildtiermärkte in China und heilige Orte in Bangladesch. Er trug die vorhandene Literatur zum Thema zusammen, und er ist dabei, wenn Flughunde gefangen werden und wenn Affen in Fallen laufen. Quammen
ist nah dran am Thema und zugleich früh – schon vor 2012 hat er das Thema bearbeitet.
Buchaufbau
Die Buchidee entstand im Regenwald von Gabun. Dort hörte der Autor von einheimischen Männern von der Ebola-Epidemie in einem Dorf. In der Nähe lagen 13 tote Gorillas. Seine Buchrecherche fand da
ihren Anfang. Das englische Original „Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic“ erschien übrigens schon 2013. In neun Kapiteln entfaltet Quammen sein Thema, ausgebreitet auf
detaillierten, umfänglichen aber zu jedem Zeitpunkt spannenden 557 Seiten – ein Mammut-Buch über ein Mammut-Thema, die Virologie.
Virenkunde
Schon in der Bibel steht als Offenbarung, dass uns der Tod bevorstehe, weil Hunger und Pest über uns kommen „durch die wilden Tiere auf Erden“.
Zoonotische Erreger können sich verstecken, sind deshalb so interessant, so kompliziert und so problematisch schreibt Quammen. Zoonose - ein Wort der Zukunft für das 21. Jahrhundert, es beschreibt
ein dringliches Zukunftsthema.
Viren und Bakterien
Zunächst sind Viren von Bakterien zu unterscheiden: Ein Virus ist keine Zelle, dringt aber in eine Zelle ein, funktioniert den biochemischen Apparat der Zelle um und vermehrt sich dadurch. Ein
Bakterium ist größer als ein Virus, ist selbst eine Zelle, dringt jedoch nicht in andere menschliche Zellen ein, um sich zu vermehren, sondern vermehrt sich durch Teilung. In der Regel kann es durch
Antibiotika abgetötet werden.
Viren sind unendlich klein, mit optischen Mikroskopen sind sie nicht zu entdecken. „Sie sind Parasiten.“ Das Virus hat keinen eigenen Vermehrungsapparat: „Es schnorrt. Es stiehlt.“ Der britische
Biologe Sir Peter Medawar bezeichnete ein Virus einmal als „schlechte Nachrichten, in Protein verpackt“. RNA-Viren mutieren wie wild, aber zufällig. Dabei entstehen Kombinationen, die sich an einen
neuen Wirt anpassen können. Dieser Anpassungsprozess wird als Evolution verstanden.
Zoonosen
Die zoonotischen Erreger sind unter anderem Viren, Bakterien, Pilze. Sie kommen aus Wäldern, Sümpfen, Äckern, alten Gemäuern, Kläranlagen, Höhlen oder Pferdekoppeln.
Das sind Zoonosen konkret: Ebola, die Pest, die Spanische Grippe, die von Wasservögeln kam, alle Formen der Grippe, Affenpocken, Rindertuberkulose, Borreliose, West-Nil-Fieber, Marburgvirus, Tollwut,
Hantavirus-Pneumonie, Milzbrand, Lassafieber, Rift-Valley-Fieber, larva miograns der Augen, Tsutsugamushi-Fieber, bolivianisches hämorrhagisches Fieber, Kyasanur-Wald-Fieber, Nipa-Enzyphalitis und
Aids HIV-1 (das von Schimpansen kommt) und HIV-2.
6O Prozent aller Infektionskrankheiten, die wir heute kennen, wechseln zwischen anderen Tierarten hin und her oder haben kürzlich Artgrenzen überschritten. Mal verschwinden sie für Jahre, mal kehren
sie irgendwann wieder zurück. Ökologische Störungen macht der Autor für ihr Auftreten verantwortlich. Mal sind mehr, mal weniger Opfer zu beklagen,
Ursachen von Epidemien
Ob Marburgvirus oder Ebola, Hendra oder Vogelgrippe, Sars oder Schweinegrippe, der Virenüberfall ist keine „höhere Gewalt“, kein Unglücksfall, wie etwa Erdbeben, Vulkanausbrüche oder
Meteoriteneinschläge, es sind die menschlichen Aktivitäten, die die natürlichen Ökosysteme mit katastrophaler Geschwindigkeit zerfallen lassen: Der Autor macht Abholzung, Straßenbau, Brandrodung,
Jagd und Verzehr wilder Tiere als Ursachen aus. Die neuen Infektionskrankheiten dringen in neue Populationen von Wirten ein, und sie kehren wieder. Sie tauchen neu auf (emerging) oder springen über
(spillover): Hendra zum Beispiel von einem Flughund aufs dasPferd und dann auf den Menschen. Das Nipah-Virus vom Flughund auf das Schwein und von dort auf den Menschen.
Der Autor zieht mit den Virenforschern durch den Dschungel, beobachtet sumpfige Gewässer. Auf Einbäumen schippern sie durch dichte Urwälder, sie nehmen Blutproben von Affen und Gorillas, immer auf
der Suche nach Erregern und mit der Frage im Gepäck: „In welchen Lebewesen versteckt es sich? Welches Tier ist der Reservoirwirt? (ökologische Frage), und wie verteilt sich der Erreger in einer
Landschaft? (geographische Frage).
Viren können Gewinner und Verlierer der Evolution sein. Finden sie den richtigen Wirt, verbreiten sie sich stark. Treffen sie den falschen überleben sie nicht. Sie sind dann auch einfacher
medizinisch zu bekämpfen etwa durch Isolation der Infizierten und Vorsorgemassnahmen in der Medizin, etwa ausgetauschte Ärztekittel und Gesichtsmasken, Einmalkanülen und Einmalspritzen.
Das EBOLA-Virus
Ebola trat im Südsudan, in Gabun, Uganda, Elfenbeinküste im Kongo und auf den Philippinen auf.
Das Ebolavirus schädigt zunächst das Immunsystem, unterdrückt die Produktion der Interferone und setzt dann Blutgerinnungsstörungen in Gang. Leberversagen, Nierenversagen, Atembeschwerden und
Durchfall treten auf.
Der erste Ebolafall: Eine Schweizerin hatte tote Schimpansen untersucht und sich infiziert. (Sie überlebte.) In England kam es in einem mikrobiologischen Institut zu einem Laborunfall, bei dem sich
Mitarbeiter Verletzungen zuzogen. (Auch der Engländer überlebte.)
Eine russische Wissenschaftlerin, die an einer Ebola-Therapie arbeitete und mit dem Blutserum eines Ebola-infizierten Pferdes hantierte, infizierte sich, als eine Nadel zwei Handschuhschichten
durchstieß und in die linke Handfläche eindrang. Nach zwei Wochen war sie tot. Der Fall wird bis heute verheimlicht.
Minutiös schildert Quammen den Fall der amerikanischen Forscherin Kelly L. Warfield, die Ebola-Experimente mit Mäusen durchführte und sich mit einer Injektionsspritze in den linken Handballen stach.
Das bösartige Ebola-Virus, so klein, so einfach strukturiert, so brandgefährlich, dass die Forscherin fasziniert, tötete die Wissenschaftlerin nicht, sie überlebte und forscht weiter im gefährlichen
Hochsicherheitslabor.
Flughunde wurden als Reservoirwirte identifiziert. Ob sie übertragen können, ist noch unklar, sicher ist nur, der Erreger kann von toten Menschenaffen auf den Menschen übergehen. Bisher sind etwa
1.500 Menschen am Ebola-Virus gestorben. Auch Gorillas sterben an dem Erreger Ebola. Das Ebolavirus bleibt ein in vielerlei Hinsicht „undurchschaubarer Erreger“, sagen die Wissenschaftler
unisono.
EPIDEMIEN
Warum aber werden Virenkrankheiten unter bestimmten Voraussetzungen zu Epidemien?
Der englische Arzt W. H. Hamer fand heraus, dass die Masernepedemie immer dann im Sand verlief, wenn nicht mehr genügend anfällige, das heißt nicht immune Menschen vorhanden waren.
Das Massenwirkungsprinzip spielt eine Rolle. Ob eine Epidemie sich fortsetzt, hängt davon ab, wie häufig sich Menschen, die ansteckend sind, Menschen treffen, die sich anstecken können.
Englische Forscher fanden dagegen heraus, dass nicht die Eigenschaften der menschlichen Bevölkerung ausschlaggebend sind, sondern der Zustand der Keime für den Verlauf und das Ende der Epidemie. Es
handelt sich um den Verlust der Infektivität.
Ob jemand überlebt oder stirbt, hängt nicht mit der Virusmenge zusammen, sondern davon, ob die Blutzellen des Patienten nach der Infektion schnell Antikörper bilden.
Der Malariaforscher Ronald Ross, der sich mit mathematischen Ansätzen zur epidemiologischen Forschung befasst, kam zu dem Ergebnis, Epidemien klingen dann aus, wenn und weil die Dichte anfälliger Personen in der Bevölkerung unter einen bestimmten Schwellenwert fallen.
Zwei englische Forscher, Kermack und McKendrick, stellten die drei Faktoren Infektionsrate, Genesungsrate und Sterblichkeit in den Mittelpunkt ihrer Forschungen. Hinzu
kommt die so genannte „Schwellendichte“. Dieser Wert beschreibt, wie viele Menschen auf relativ engem Raum beieinander sein müssen, um bei einer bestimmten Infektiosität, Genesungsquote und
Sterblichkeit eine Epidemie zu ermöglichen.
Wichtig auch der Hinweis des Autors David Quammen, dass Wissenschaft in den Labors, im Freiland, aber auch im Austausch in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften stattfindet.
Das SARS-Corona-Virus
Ebola, Hendra und Nipah sind Viren, SARS ist als schweres akutes Atemwegssyndrom ein Krankheitsbild. Der Erreger von SARS ist ein Coronavirus, den man inzwischen als „SARS-Coronavirus“ (SARS-CoV-1)
bezeichnet.
Die Symptome sind Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, schwerer hartnäckiger Husten, blutiger Auswurf und fortschreitende Zerstörung der Lunge, die sich mit Blut füllt und
mit folgendem Sauerstoffmangel zum Organversagen und schließlich zum Tod führt.
Die Lungenentzündung war anormal, aggressiv Furcht einflößend, schreibt Quammen.
Ein infizierter Koch hatte Schlangen, Füchse, Zibetkatzen und Ratten verzehrt.
Hier tauchten auch zum ersten Mal so genannte „Superspreader“ auf, Patienten, die aus irgendeinem Grund viel mehr Menschen anstecken als ein typischer Kranker. Das SARS-Virus verbreitete sich mit
hoher Mobilität in Flugzeugen und machte deutlich, dass insbesondere auch das Krankenhauspersonal viren-bedroht ist. Im Fall der Sarsinfektion wurde entdeckt, dass Viren auch über die
Beatmungsschläuche verbreitet werden, die Intubation war die Gelegenheit zur Übertragung.
Wildtiermärkte als Problem
Betreiben wir mit David Quammen weiter Ursachenforschung. Allein in der chinesischen Stadt Guangzhou gibt es 200 Restaurants mit „Wildspezialitäten“. Das „Zeitalter der wilden Aromen“ ist in Mode,
der Verzehr von Tierarten, die auf den Wildtiermärkten gehandelt werden - Säugetiere, Vögel, Frösche, Schildkröten, Schlangen, der Larvenroller, der chinesische Sonnendachs und der
Schweinsdachs.
Die Fledermaus mit dem Namen „Hufeisennase“ trägt das Coronavirus in sich. In Südchina finden sich solche Fledermäuse auf den Speisekarten.
Auf den so genannten „nassen Märkten“ kann man Störche, Möwen, Reiher, Kraniche, Hirsche, Alligatoren, Krokodile, Wildschweine, Marderhunde, Flughörnchen, Schlangen, Schildkröten, Frösche, Haushunde
und Katzen im Angebot finden.
Auf Seite 210 des Buches SPILLOVER steht der prophetische Satz im Kapitel über SARS-CoV: “Wir können davon ausgehen, dass die nächste große Epidemie der gleichen perversen Gesetzmäßigkeit unterliegen
wird wie die Spanische Grippe: hohe Ansteckungsgefahr und erst später erkennbare Symptome. Das wird ihr helfen, wie ein Todesengel durch die Großstädte und über Flughäfen zu wandern.“ Durch
epidemiologische Schutzmaßnahmen starben „nur“ 774 Menschen, eine „kleine Epidemie“, keine Pandemie wie derzeit.
NPV-Viren
NPV-Viren (Kernpolyederviren) lassen Insekten nicht explodieren, sondern „schmelzen“, die Zellstruktur löst sich auf. Schwammspinner larven, die Blätter von Bäumen fressen, verschwinden völlig und
zurück bleiben nur die Viren, die eben überleben. Eine apokalyptische Vision, ein Virus, vom Tier auf den Menschen übertragen, fähig, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden mit der Folge der
Zellauflösung und damit der Auflösung der Menschheit.
Meinung zum Buch
Das Buch ist eine kluge, aufschlussreiche Mischung aus Reportage, Medizingeschichte, Forschungsgeschichte und Virologie, vermeidet jedoch Fachbegriffe und Fachsprache. Es ist aber auch nicht
populärwissenschaftlich flach gehalten, informiert ausführlich genau, aber eben nicht staubtrocken, sondern sehr realitätsnah. Es ist Wissenschaftsberichterstattung, wie sie im englischsprachigen
Raum gang und gäbe ist, in Deutschland jedoch kaum vorkommt.
SPILLOVER ist anschaulich und spannend geschrieben. Quammen trägt die relevante Literatur zusammen. Allein das Literaturverzeichnis macht 26 Druckseiten aus. Er berichtet über eigene Erfahrungen,
besucht Labore und Wissenschaftler, forscht im Freifeld selbst nach, ist in Fledermaushöhlen im Dschungel und in Sümpfen unterwegs.
Das heutige Coronavirus spielt nur andeutungsweise am Rande eine Rolle. Es konnte den derzeit wütenden Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid 19) genannt, noch nicht berücksichtigen. Doch die Gefahr einer
weltweiten Pandemie wird unterschwellig an jeder Stelle des Buches klar ebenso wie die ökologischen Gründe dafür: "Wo Bäume gefällt und Wildtiere getötet werden, fliegen die lokalen Keime wie
Staub umher, der aus den Trümmern aufsteigt."
Und wir halten uns dort auf, wo wir eigentlich nicht hingehören: In fernen Regionen dieser Welt, um auf Kamelen zu reiten, Höhlen und Tempel zu besuchen, im Dschungel nach Wildtieren
schauen.
In der New York Times schreibt der Buchautor zur derzeitigen Lage: „Wir haben die Coronavirus-Epidemie verursacht. Es mag mit einer Fledermaus in einer Höhle begonnen haben, aber menschliche
Aktivitäten haben sie ausgelöst“.
David Quammen SPILLOVER Der tierische Ursprung weltweiter Seuchen PANTHEON
David Quammen, geboren 1948, ist ein amerikanischer Schriftsteller und Wissenschaftsjournalist. Er studierte Literatur an der Yale University und in Oxford. Für
seine populärwissenschaftlichen Werke zu Naturgeschichte und Evolution wie »Der Gesang des Dodo« wurde er vielfach ausgezeichnet.
Ist die chinesische Gefahr noch "gelb"?
Das bevölkerungsreichste Land der Erde wird von einer kommunistischen Partei geführt und betreibt einen erfolgreichen Kapitalismus. Das Land ist auf dem Wege, den USA den Rang der Führungsnation streitig zu machen. Entsprechend sind die Konflikte – angeheizt von dem undiplomatischen Präsidenten in Washington.
Aber strebt das Land, strebt die KPCh die Weltherrschaft an? Das suggeriert eine Kampfschrift des australischen Ethik-Professors Clive Hamilton und der deutschen Chinaexpertin Mareike Ohlberg. Unter dem Titel „Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet“ zeichnen sie ein Bild, das Furcht vor der geballten Organisation und den großen finanziellen Mitteln erregen kann, die China auf dem Pfad dahin einsetzt.
Noch größere Furcht müsste nach Ansicht der Autoren die angebliche Naivität des Westens einflößen. In ihrem Buch, das auf Vor- und Nachsatz ein Organigramm der KPCh und der nachgeordneten Institutionen enthält, gehen sie der Reihe nach die Einflussnahme auf die USA und Europa, die Ideologie der „Neuen Seidenstraße“ und ihr wirtschaftliches Erpressungspotential durch, behandeln die politische, militärische und industrielle Spionage und gehen vor allem von einer einheitlichen ideologischen Willensbildung in der KPCh und einer immer stärkeren Abschirmung vor westlichen Einflüssen aus.
Hunderttausende chinesische Studenten an die besten amerikanischen und europäischen Universitäten werden als zukünftige Eliten des Landes mit großem finanziellen Aufwand herangebildet und – fernab ihrer chinesischen Heimat – durch ein raffiniertes System bei der ideologischen Stange gehalten.
Soweit die Kampfschrift, bei der weniger beeinflussbare Leser die Feder der CIA mitlesen könnten. Für Deutschland, das in einem Europa gewidmeten Kapitel behandelt wird, ergibt sich aus dieser
Perspektive, dass der Sündenfall schon vor Jahrzehnten vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt begangen wurde, als er die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu China veranlasste.
In Frankreich ist nach dieser Lesart die ganze politische Elite der letzten Jahrzehnte den chinesischen Annäherungen auf den Leim gegangen, in Großbritannien selbst der gegenwärtige Ministerpräsident, in den anderen Ländern sieht es ähnlich aus.
Das Hohelied der Meinungs- und Pressefreiheit singt sich natürlich gut von Autoren, die nicht auf eine Übersetzung ihres Werkes ins Chinesische hoffen. Dafür werden andere Werke z.B. der westlichen Geistesgeschichte ins Chinesische übersetzt, die für die ideologische Festigung der Leser – meist Studenten an den chinesischen Universitäten – nichts beitragen können.
In dem zeitgleich mit der Kampfschrift erschienenen aktuellen, Hegel gewidmeten Heft der Zeitschrift für Ideengeschichte wird von zwei monumentalen Hegelübersetzungen die gegenwärtig laufen, berichtet, von einer fünfbändigen Ausgabe der Werke Fichtes und von einer 22-bändigen Schelling-Gesamtausgabe. Alles Philosophen des Deutschen Idealismus, aus dem für die KPCh kein ideologischer Honig zu saugen ist. Den deutschen Anlagen-, Auto- und Maschinenbauern, die in China gute Geschäfte machen, wird man kaum vorwerfen können, dass sie den Expansionskurs Chinas finanzieren – eher doch die bundesrepublikanische Sonderstellung innerhalb der EU.
Und ob Hunderttausende im Westen studierende Studenten die hierzulande herrschenden Freiheiten nach ihrer Rückkehr in ihrer Heimat nicht vermissen werden, diskutieren die Autoren nicht einmal. Jeden Kulturaustaus, jede Konferenz, an der das offizielle China teilnimmt, behandeln die Autoren als Baustein zur Errichtung einer neuen, von China dominierten Weltordnung.
Wer nicht miteinander spricht, wird irgendwann einmal aufeinander schießen. Die Neue Seidenstraße ist sicher kein uneigennütziges Entwicklungsprojekt, das den beteiligten Staaten nur Vorteile bringt. Der Westen hat kein vergleichbares Projekt aufgelegt und die klassische westliche Entwicklungshilfe gilt seit langem als verfehlt.
Kampfschriften, wie das Buch von Hamilton und Ohlberg, die keinen Zwischenton, keine Spur von Zweifel erkennen lassen, die jede andere Meinung als chinesisch beeinflusst diffamieren, ein solches Buch
wirkt wie ein Rohrkrepierer und ist der hilflose Versuch, einer durchdachten chinesischen Strategie mit bornierter Einseitigkeit zu begegnen. Den in dieser Strategie sicher innewohnenden Gefahren
wird diese Kampfschrift nicht im Geringsten gerecht.
Harald Loch
Clive Hamilton und Mareike Ohlberg: Die lautlose Eroberung
Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer-Lippert
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2020
Der alltägliche Rassismus in Deutschland
Meinung
Es ist eine sehr persönliche, eindringliche, alltägliche Geschichte über den Rassismus in unserem Land, der mitten aus der Gesellschaft kommt und es selbst nicht wahrhaben will, dass sein Gebaren
rassistisch ist. Ist doch normal, dass man einem schwarzen Kind über die Kräuselhaare streicht und fragt, ja wo kommst denn Du her? Als erwachsene Frau hat Alice Hasters ähnliche Erlebnisse, denn sie
hat einen weißen und einen schwarzen Elternteil. Schon im Kindesalter machte sie solche Erfahrungen, wenn Menschen ihr ins wuschelige Haar gegriffen haben und neugierig nach ihrer Herkunft
fragten.
Auf die Frage: Wer bist Du? Woher kommst Du? Was machst Du? antwortete die Autorin auf der Internetplattform POSITIV/NEGATIV die Frage so: „Ich bin Alice Haruko Hasters. Ich wurde 1989 in Köln
geboren, und wenn die Leute fragen, wo ich herkomme, dann sage ich, woher meine Eltern kommen. Mein Vater ist zusammengefasst Deutscher und meine Mutter ist zusammengefasst, was man unter den Begriff
Afro-Amerikanisch fassen würde. Meine Mama hat indianisch/karibische und mein Vater holländische Einflüsse. Zurzeit studiere ich Sport und werde ab Oktober Journalismus studieren.“ Immer wieder muss
sie die Herkunftsfrage vorbeten.
Die Hauptthese ihres Buches lautet: „Wir sprechen falsch über Rassismus.“ Es gehe in der heutigen Diskussion alleine darum, was man in der öffentlichen Diskussion politisch korrekt noch sagen dürfe
und was nicht.
Sie macht transparent, was es im Alltag für schlimme Erlebnisse, irritierende Gefühle, maßlose Enttäuschungen, heftige Boshaftigkeiten gibt, und wie ein schwarzer Mensch darauf reagiert.
Ihre Behauptung: Rassismus steckt überall in der Gesellschaft.
In fünf Kapiteln deklariert die junge Journalistin an Beispielen durch, was Rassismus im Alltag, in der Schule, in der Körperlichkeit in den Liebesbeziehungen und in der Familie bedeutet. Sie zählt
nicht nur auf, sie analysiert, sie kommentiert, nie aufdringlich belehrend, nein behutsam, auch fragend, nie allwissend. Ihr Buch ist gut geschrieben, flott zu lesen, ohne jugendlich anbiedernd zu
wirken. Es ist aber eher eine beschreibende Studie mit Selbsterfahrungen als eine Politanalyse, wie Rassismus bekämpft werden könnte.
Das Thema RECHTS wird bewusst ausgeblendet. Rassismus war schon vor der AfD da, sagt sie in einem Interview. Im Buch behandelt sie die Partei also nicht, um den Leser nicht auf falsche Fährten zu
locken, ihr geht es rein um Alltagsrassismus.
Ein Glossar und ein Literaturverzeichnis ergänzen das Buch am Ende.
Alice Hasters wurde 1989 in Köln geboren. Sie studierte Journalismus in München und arbeitet u. a. für die Tagesschau und den rbb. Mit Maxi Häcke spricht sie im monatlichen Podcast
Feuer&Brot über Feminismus und Popkultur. Alice Hasters lebt in Berlin.
Alice Hasters Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten hanserblau
Echte Liebe BVB
„Aki“ Watzke ist Alpha-Tier, würde man ihn mit Ulli Hoeneß, na sagen wir nicht in eine Zelle, nein, in einen Käfig sperren, man könnte nicht prognostizieren, wer überlebt, sie sind Konkurrenten, sie bleiben Konkurrenten, sie lieben sich nicht. „Für eine Freundschaft zwischen uns wird es nie reichen.“ Watzke liebt den BVB, und das ist echte Liebe. Im Spiel mit Hoeneß ist und bleibt Watzke kampfeslustig, nicht bayern-devot.
Der Sportjournalist Michael Horeni, seit 1989 in der Sportredaktion der FAZ, kommt seinem Interviewpartner, den Spielen und der Fußball-Philosophie sehr, sehr nahe. Aber kommen wir zuerst zum Wesentlichen, zum Tore schießen. Fängt man eines, dann ist das Tor, „… ein Stich, ein tiefer Stich“. Gehen wir gemeinsam ins BVB-Stadion, in die Höhle des Löwen, dann wird es lauter als laut: Die Wand „…ein einziger Schrei: kehlig, animalisch“.
Horeni hat Politologie, Philosophie und Geschichte studiert, und das merkt man seinem Buch auch an, das nicht an der Oberfläche dahin plappert, sondern ans Eingemachte geht.
Watzke ist der BVB, der BVB ist Watzke.
Seit dem 3:2-Sieg gegen Bayern, die sechs Jahre lang die Bundesliga als Spitzenmeistermannschaft anführten, ist der BVB wiederbelebt und im Konkurrenzgeschäft mit dem FC Bayern meist auf Augenhöhe, aber eben nicht immer.
Watzke ist die Seele des BVB. Während für Horeni die Bayern-Granden „… aus der Zeit gefallen“ sind, braucht Watzke zum Beispiel auch Hinweise, wie „… jüngere Leute die Dinge sehen.“
Horeni montiert Interviewpassagen mit seinem eigenen Text, und er bleibt nicht nur sportlich „im Netz hängen“, er schürft tiefer, wird politisch, diskutiert Wirtschafts-Perspektiven, lotet die Zukunft des Fußballs und der Ligen aus.
Watzke ist kein Merkel-Freund, kein Anhänger der Flüchtlingspolitik, hält das für einen „schweren Fehler“. Sein Bekenntnis: „Ich bin immer ein politischer Mensch geblieben. Die CDU ist seine Partei, Watzke ist schon seit 40 Jahren Mitglied. Er wollte Merz als CDU-Vorsitzenden und Merkel-Nachfolger durchsetzen, scheiterte jedoch.
Watzke liebt Rituale, liebe Gewohnheiten, klare Strukturen.
Er ist heimat- und erdverbunden, Ruhrpottler und Sauerländer zugleich. Sein Heimatort Erlinghausen: „Das ist der einzige Ort, an dem ich komplett ich sein kann.“
Im Interviewbuch kommt Watzke als Betriebswirtschaftler und Unternehmer zu Wort, wird als Konservativer und seit den 1990ern als Mitglied des BVB zunächst Schatzmeister und später als Boss des Ganzen porträtiert.
Kohle, Stahl, Fußball und Bier gehören zusammen, das ist die DNA des Ruhrgebiets. Das Selbstbewusstsein des Reviers wird immer aus der Arbeit mit den Händen bezogen. Das hat Generationen geprägt. Das Ruhrgebiet, die Kumpel hatten das Wirtschaftswunder aufgebaut, später zogen die Wirtschaftskarrieristen an den Arbeitnehmern vorbei, in die schicken Büros der oberen Etagen, der „Pott“ und seine Bewohner abgehängt.
Die anderen Städte haben Attraktionen: „Aber Dortmund hat noch nicht mal einen großen Fluss.“ Eben nur den BVB und seine Spieler. Und die “… müssen sich für den BVB zerreißen“. Watzke legt das wirtschaftliche Fundament für den BVB.
„AKI“ & Kloppo, natürlich darf die Beziehungskiste zwischen den beiden nicht fehlen.
Den Wechsel nach Liverpool schildert Horeni, als sei ein Ehepartner verlassen worden: “Jetzt lieben ihn die Menschen in Liverpool.“ Watzke lobt Kloppos hohe Suggestivkraft, seine physische Präsenz. Sie konnten sich blind aufeinander verlassen, sagt Watzke.
Horeni lässt Spiele Revue passieren, Niederlagen, grandiose Siege, leuchtet die wirtschaftlichen Hintergründe aus, lässt lange Interviewpassagen zu, bei denen Atmosphärisches und Persönliches sehr gut rüberkommen, in Höhen und Tiefen der Erfolgsgeschichte BVB.
Horeni dreht den Spiegel um, lässt Watzke ausführlich über Jürgen Klopp berichten, und dann folgt das Kapitel: Jürgen Klopp über Watzke.
Das Kapitel hat Newswert, denn Kloppo schließt aus, zum BVB Dortmund zurück zu kommen, er will nichts aufwärmen: „Es muss immer etwas Neues kommen.“
Das Kapitel Attentat ist sehr spannend, auch wenn Watzke den klassischen Satz sagt: „Was in der Kabine besprochen wird, soll in der Kabine bleiben.“ Es kommt zum Bruch mit Trainer Tuchel über die Frage, ob die Mannschaft unmittelbar nach dem Attentat weiter spielen soll oder nicht.
Am Endes des Buches, das übrigens 12 und nicht elf Kapitel hat, beschäftigt Horeni sich mit der Rettung des Fußballs und den Fans.
In der Krise des modernen Fußballs spürt er eine Entfremdung vieler Fans von ihrem „Herzenssport“. Finanzinvestoren haben die Mannschaften gekapert.
Horeni lässt jedoch zuerst Watzke mit einem eigenen Kapitel zu Wort kommen: „Fußball in Zeiten des Turbokapitalismus - Eine Zukunftsvision“ von Hans-Joachim Watzke, die in dem allgemeinen Satz gipfelt: „Wir müssen versuchen, den Hunger der jungen Spieler auf den absoluten Erfolg wieder zu fördern und zu stärken. Aber wir müssen ehrlich sein: Das ist leichter gesagt als getan.“ Vorher stehen einige klassische wichtige Kernsätze, die der Leser selbst interpretieren sollte.
Im Fazit-Kapitel fragt Horeni nach den Fehlern Watzkes. Da beißt der Autor eher auf Granit und gerät etwas ins Abseits. „… Man macht ja immer Fehler“, verteidigt sich Watzke. Ja, wer schießt schon gern ein Eigentor im Fußball?
Ein farbiger Bildinnenteil leuchtet die Person Watzkes zusätzlich aus.
Ein leidenschaftliches, tiefer schürfendes Sportbuch über die schönste Nebensache der Welt. Das zeigt, dass man als Autor und Interviewpartner klüger, leidenschaftlicher und verbal präziser über den Rasensport reden kann, als es die Wort-Plattitüden mancher Spieler vor Fernsehkameras am Platz, von Medienexperten geschult, befürchten lassen.
Hans Joachim Watzke/Michael Horeni Echte Liebe. Ein Leben mit dem BVB (C.Bertelsmann)
Michael Jeismann: Die Freiheit der Liebe Paare zwischen zwei Kulturen
Liebe ist eines der kostbarsten Güter der Menschheit. Überschreitet sie Grenzen, wird sie seit Jahrtausenden mit Zöllen belegt, oft mit Verboten. Gesellschaften, Religionen, Ethnien, Länder wollen
unter sich bleiben, vertreten eine Autarkie-Haltung in Sachen Liebe, machen die oder den Fremden schlecht und halten Vermischung für verderbt. Wenn Mann und Frau unterschiedlichen Kulturen,
Gesellschaftsschichten, unterschiedlicher Hautfarbe sind oder anders glauben, werden Hürden errichtet, wenn sie sich lieben und eine Familie bilden wollen. Beide leiden darunter, vor allem aber ihre
Kinder. Hiervon handelt das weit ausholende Buch „Die Freiheit der Liebe“ des an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrenden Historikers Michael Jeismann.
Seine „Weltgeschichte“ der gemischten Paare schöpft aus ältesten literarischen Quellen, nennt aktuelle Beispiele, erzählt Geschichten aus der Geschichte neu. Immer geht es um Abwehr und Neugier, um
Frau und Mann, um das Höchstpersönliche der Liebe versus übergeordneter „Raison“. Es geht um das individuelle, manchmal inzwischen auch das kollektive Durchsetzen dessen, was der Autor als von Hannah
Arendt formuliertes Motto seinem Buch voranstellt: „Das Recht zu heiraten, wen man will, ist ein elementares Menschenrecht.“ Das wechselseitige Begehren „gemischter“ Paare ist viel älter als die
Formulierung der Menschenrechte, es ist offenbar als anthropologische Variante gewissermassen natürlich. Inzwischen ist das „gemischte Paar“ - befindet Jeismann wohl zu recht - „eine Sonde mitten ins
Herz unserer emotionalen und politischen Verfasstheit“.
Jeismann geht im ersten Teil seines Buches den Heiratsverboten von frühester Zeit bis zur Gegenwart anhand ausgewählter Beispiele nach. Manchen werden hier die strikten Heiratsregeln im klassischen
Athen irritieren. Wer nicht zum innersten Kreis gehörte, durfte nicht in ihn hineinheiraten, wer dazugehörte nicht aus diesem Kreis heraus. Die Sanktionen waren drakonisch, wurden aber in
privilegierten Einzelfällen virtuos vermieden. Die „Mutter der Demokratie“ war jedenfalls kein Vorbild für das Menschenrecht auf grenzüberschreitende Liebe. Und die Athener Grenzen waren sehr eng
gezogen. Die Rassengesetze der Nazis setzten eine lange Tradition in mörderischer Weise fort. Ganz anders müssen die Schwierigkeiten jüdisch-palästinensischer Paare heute in Israel beurteilt werden -
auch hier sind die Hürden verständlicher Weise hoch.
Im zweiten Teil geht es Jeismann um „politisch forcierrte und ideologisch erwünschte Paarbildungen, ihre Wahrheiten und Lügen. Sein Paradebeispiel war der Wunsch Alexanders des Großen, der in den
eroberten Gebieten selbst „fremd“ heiratete. Er legte seinen Soldaten und Offizieren nahe, einheimische, zumeist persische Frauen zu heiraten. Er fördete diese „Mischehen“ mit großzügigen Prämien.
Nach ihm zerfiel nicht nur sein Reich, sondern auch der Gedanke an die segensreiche Vermischung. Später handelten auch die spanischen Eroberer Südamerikas nach diesem Motto und schufen eine bis heute
weitgehend „gemischte“ Gesellschaft. Die dynastischen grenzüberschreitenden Eheschließungen im Mittelalter bis in die Neuzeit wirkten nicht immer, wie sich die Anstifter das vorstellten. Immerhin gab
es, von Jeismann sehr schön beschrieben, Beispiele erfolgreicher gemischter Ehen zwischen den Herrscherhäusern.
In einem dritten Teil wendet sich Jeismann dem Schicksal der Kinder solcher „gemischten Paare“ zu, die vor allem in Kriegs- und Besatzungszeiten gezeugt wurden, aber selten in einer intakten Familie
aufwachsen konnten. Besonders krass ging Norwegen mit den etwa 12000 Kindern deutscher Wehrmachtsangehöriger und ihren norwegischen Müttern um, so dass sich der frühere norwegische Staatsminister
Bondevik bei den Betroffenen im Jahre 1998 im Namen Norwegens für die erlittene Diskriminierung entschuldigt. Inzwischen sind auch Entschädigungen gezahlt worden. Die über 70 000 "Besatzungskinder",
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zur Welt kamen, wissen auch ein Lieb davon zu singen.
Migration, neuer Nationalismus und erwachter religiöser Regorismus, ja selbst der bevorstehende Brexit schaffen neue Hürden, neues Leid, ändern aber nichts an der alle solche Grenzen überwindenden
Liebe einzelner Paare. Das Menschenrecht, zu heiraten, wen man will, ist längst keine Selbstverständlichkeit. Michael Jeismann hat in seinem faktenreichen und glänzend geschriebenen Buch den Finger
auf diese Wunde gelegt, die seit dem Gilgamesch-Epos schwärt. Er zitiert als weiteres Motto für sein Buch Rainer Werner Fassbiner aus Angst essen Seele auf: „Das Glück ist nicht immer lustig“.
Harald Loch
Michael Jeismann: a
Die Freiheit der Liebe. Paare zwischen zwei Kulturen
Eine Weltgeschichte bis heute
Carl Hanser Verlag, München 2019 350 Seiten 26 Euro
Deutsche Grenzerfahrungen
Es begann alles nach einer Lesung des Schauspielers Joachim Król. Der Journalist und Buchautor Lucas Vogelsang, für seine Reportagen vielfach mit Preisen ausgezeichnet, kommt auf den Mimen zu, schwärmt von dessen früheren Filmen, beide kommen beim Thema Fußball zusammen, und schon steht der Plan, als Schnapslaune geboren: Wir wollen in die ehemalige DDR zurück, gemeinsame Grenzerfahrungen machen: Erfahrungen ohne Grenzzaun, Erinnerungserfahrungen, Erfahrungen aus heutiger Sicht. So wie es in dem Film von Joachim Król und Horst Krause WIR KÖNNEN AUCH ANDERS von Detlev Buck zu sehen war, ist das kein Western-„Film“, vielmehr ein EASTERN-Streifen: „ (…) da lauern die Geschichten“.
Tief im Westen geht es los, dort, wo der Ruhrpott sein Kohlerevier verlieren wird, dort, wo man den Herzschlag aus Stahl noch hört, wie Grönemeyer singt. „Eine Landschaft, die Kette raucht.“ „Die DDR ein Haufen Lumpen, längst aus der Mode. Altkader wie Altkleider“. „Dies ist nicht der Ort, um in Ruhe rückwärts zu denken“.
Es ist diese Formulierungsgabe von Vogelsang, die das Buch und seine Texte so farbig macht, obwohl es keine Bilder enthält, die, sowohl in Farbe und auch nur in einfach Schwarzweiß, das Buch sicher noch attraktiver gemacht hätten.
Beide besuchen DDR-Devotionalien-Sammlungen und DDR-Museen in Ost und West, DDR-Flüchtlinge, die in letzter geschichtlicher Sekunde das „gelobte“ Sozialismusland fluchtartig, nein in Wahrheit flüchtend, hinter sich gelassen haben.
Król gibt seine Kommentare zu Vogelsangs Beobachtungen, berichtet aus frühen Tagen der Grenzerfahrungen, beide treffen Menschen, die am Grenzzaun wohnten, am Zonenrand, wo die Mauerblümchen mit Zinszuschüssen oder Investitionszulagen kräftig „gegossen“ wurden.
Die beiden „Streifzügler“ baggern die Menschen im Braunkohlerevier an, legen östliche Befindlichkeiten bloß, konservieren Alltagserfahrungen, hängen aus westdeutscher Sicht Ossi-Träumen nach.
Der Grenzschützer in Marienborn, dort, wo heute das DDR-Museum zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet hat, trug in der Schule das verordnete FDJ-Hemd, zuhause kopierte er illegal die Schallplatten von Iron Maiden und Black Sabbath „Ich war, sagt er, sogar linienbestätigt. Er lacht. Er trägt dieses Wort wie einen Orden. Linienbestätigt, sagt er, waren nur wenige.“ Das waren die ausgesuchten Soldaten, die an der Grenze alleine stehen und laufen durften, weil man ihnen zutraute, dass sie nicht gleich abhauen würden.
Wir lesen einen Film, es ist eine Kamerafahrt in den Osten, ein Road-Movie in Buch-Form, es geht immer weiter, weiter, weiter ostwärts. Joachim Król findet beleuchtete Radwege, die er in seinem Ruhrgebiet nicht gefunden hat, aber beide entdecken auch Dunkeldeutschland, fahren die Transitautobahnen ab, sind in Brandenburg und Sachsen unterwegs, fragen den Aufsichtsratschef des Berliner Flughafens Rainer Bretschneider aus, der sich als West-Verwalter, im Osten kaserniert wie ein „tatsächlicher Besatzer“ empfand. Es waren Menschen in grauen Anzügen, die kapitalistischen West-Werte im Kopf, die man heute noch unterscheiden könne, weil sie kein Lächeln im Gesicht tragen. Der Kampf der Systeme war gewonnen, da kann man sich wie Hund benehmen, da wird man zum Typ mit der Abrissbirne. Eben Besser-Wessi.
Potsdam wird mondän, weil die Fernsehgrößen und die Medien-Promis sich dort eingenistet haben und in Gelsenkirchen, dort wo alles kaputt, grau und verlebt ist, werden heute Ost-Filme gedreht.
Eben verdrehte, verkehrte Welt nach der Wiedervereinigung.
Auch eine Fußball-Geschichte steht in dem Buch, von Andreas Thom, dem Stürmertrainer bei Hertha BSC, der in der Wendezeit sein Fußballtalent im Westen entwickeln konnte.
Die Balltreter aus dem Osten, die Filmschauspieler aus Babelsberg standen plötzlich auf dem Spielfeld oder vor der Kamera und machten als Neu-Wessis den Alt-Wessis Konkurrenz.
Horst Krause, der Polizeiruf-Kommissar, bringt die deutsch-deutsche Geschichte auf den Punkt. Die einen hatten Glück, die anderen hatten Pech, die einen schwammen im Süßwasser, die anderen im Salzwasser, und beide mussten strampeln. Das ist die große „Lotterie des Lebens“.
Und ein Touristenführer mit dem Ost-Auge stellt fest: „(da) …haben wir gelernt, dass nicht alle Wessis gute Menschen sind. Und dieses Gefühl, der Dumme zu sein, das ist geblieben.“
Das Buch eine keine tiefschürfende, kapitalistisch-sozialistisch kritische Politanalyse, kein detailgenauer Systemvergleich, kein nostalgieverliebtes Museumsbuch, keine Inventur-Bestandsaufnahme über blühende Landschaften, es ist vielmehr eine lebendige, durch Personen und intensive Gespräche, durch wechselnde Landschaften erzeugte WORT-Welt und BILDER- Welt, ehrlich bis auf die Haut, nichts beschönigend, eine aufrichtige Bestandsaufnahme, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, so dass man guten Gewissens sagen kann: Der frühere Satz: GEHEN SIE DOCH RÜBER ist bei Joachim Król und Lucas Vogelsang auf fruchtbaren Boden gefallen.
Lucas Vogelsang/Jochaim Król Was wollen die denn hier. Deutsche Grenzerfahrungen ROWOHLT
Die Wiese
Der Bucheinband fühlt sich so an, als würde man mit den Handunterflächen über Wiesenhalme streichen, das Hardcover-Buch liegt so soft in einem Buchumschlag, dass der Leser sich schon auf diesem Wege beim In-die-Hand-Nehmen des Buches mitten in die Wiese hinein gesetzt fühlt.
Ich bin als Kritiker dieses Naturbuches von Haus aus befangen, denn schaue ich aus dem Fenster in meinen Garten, sehe ich meine private Wiese, auf der sich vor allem bei Sonnenschein mitten im Wald viele Insekten tummeln. Wir tun auch einiges für die Vielfalt. Mein Blick auf das Buch ist zudem beeinflusst durch den Film von Jan Haft, den ich im Kino bereits sehen konnte und der durch seine natürliche Vielfarbigkeit, Schönheit und Dramaturgie schwer beeindruckt.
Gerade fliegt auch eine Wespe durch mein Dachfenster, die ich in früheren Zeiten als Allergiker getötet hätte, heute locke ich sie irgendwie wieder ins Freie. Insekten-Überlebensstrategien meinerseits, denn auch ich habe das Volksbegehren RETTET DIE BIENEN unterschrieben.
Bei all diesen Vorbedingungen wird es den Leser dieser Rezension kaum wundern, dass ich auch das Buch loben muss. Ich begründe auch begründet warum: Erstens gelingt es dem Autor, der Biologe und mehrfach ausgezeichneter Tier- und Naturfilmer ist, in einer – ich sage es buchstäblich – natürlichen Sprache der Wiese ein Denkmal zu setzen. Da ist nichts Gekünsteltes, Übergescheites, Moralinsaures, Jan Haft findet die richtigen Worte, ordnet die passenden Kapitel, dokumentiert die farbigen Seiten der Wiese, zeigt die Artenvielfalt und deren Bedrohungen, er analysiert die Zusammenhänge, kann sogar Neuigkeiten aufbieten und macht auch die Landwirte mit ihren Überdüngungsstrategien als „Schuldige“ aus, bleibt jedoch nicht nur beim Kritisieren, sondern weist Wege auf, wie Biodiversität erreicht werden kann.
Tierfilmer zeigen gerne Elefanten, Tiger, Löwen, Bären, Nashörner, Antilopen und Giraffen oder Eisbären und neuerdings auch wieder den Wolf. Aber, wer hat den Mut, sich filmisch der Heuschrecke zu nähern? Jan Haft tut es, er zeigt das Spannende in der Wiesen-Natur-Normalität. Wildbienen, Fliegen, Heuschrecken, kämpfende Hirschkäfer und Schmetterlingsraupen können genauso spannend sein wie Rachen aufreißende Alligatoren. Man muss sich als Leser oder Filmzuschauer nur darauf einlassen. Haft hofft, dass das momentane Interesse, das Insektensterben zu bremsen, nicht nur einen kurzen Artensterben-Aufschrei darstellt, sondern nachhaltig bleibt.
Der Autor zeigt auch das Paradoxe in der Natur, dass Harvester-Holz-Ernter zwar tiefe Gräben in den Waldboden ziehen und den Boden verdichten, dass aber in den Fahrspuren Minitümpel einstehen, in denen Gelbbauchunken, Wasserkäfer und Wasserwanzen, Krebse, Moose und Pilze ihren Lebensraum finden. Da ist es, das Widersprüchliche in der Natur.
Wussten Sie auch, dass es in Deutschland 80 unterschiedliche Heuschreckenarten gibt und in manchem Krimi auf der Film-Tonspur sich amerikanische Exemplare davon tummeln, die im deutschen Tatort gar nicht vorkommen dürften. Irrtümer der Tonmeister beim Abmischen des Films.
600 Zikadenarten allein zählt der Naturschützer.
Biodiversität muss zum Agrarprodukt werden, fordert der Autor. Es sollte sich lohnen, auf Gift und Gülle zu verzichten, die Grenzen zwischen Schutzgebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen müssten unscharf werden.
Wie sagte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“ Und deshalb gehört dieses Buch in den Biologie-Unterricht.
Der Klang von Paris
Titel Volker Hagedorn: „Der Klang von Paris – Reise in die musikalische Metropole des 19. Jahrhunderts“ Rowohlt-Verlag
„Aber Paris ist wirklich ein Ozean“, schreibt Honoré de Balzac, dessen Worte als Einleitungszitat auf der ersten Seite des Buches von Volker Hagedorn über den Klang von Paris stehen. Bleiben wir erst einmal bei diesem Bild, hier wird das Meer mit einer Hauptstadt verglichen.
Eine solche Kombination zweier Sphären - Ozean und Paris - ist so weitreichend, wie eine Stadt mit KLANG in Verbindung zu bringen. Es ist ein breiter, vieles möglich machender, reizvoller Ansatz, zugleich birgt er jedoch die Gefahr, beliebig oder ausufernd zu werden.
In einer ausgesprochen visuell dominierten Videoclipzeit verspricht dieses Buch von Volker Hagedorn, spannend zu werden, weil es das Akustische hervorhebt. Und doch gelingt es ihm auch, mit diesem Buch Bilder einer Stadt zu erzeugen. Der Klang einer musikalischen Epoche, der Klang einer Stadt, Melodie und Rhythmus von Paris schwingen mit. Das 19. Jahrhundert in Paris, das ist rapides Wachstum einer Millionenmetropole, Reichtum und Elend zugleich, Revolution und Reformation, Vergangenheit und Utopie, Nationalismus und Antisemitismus.
Wir lernen die Musiker Berlioz, Meyerbeer, Rossini, Offenbach, Paganini und Wagner kennen, auch Chopin und Liszt. Ob Chopins Geliebte George Sand, Heinrich Heine oder Victor Hugo, der Maler Delacroix und die Schriftsteller Baudelaire, Balzac, Flaubert, sie alle treten auf dieser Buch-Bühne des 19. Jahrhunderts in wechselnden Rollen, Geschehnissen und musikalischen Szenarien auf.
Musikalische Vorbildung hilft, das Buch besser zu verstehen. Es ist anspruchsvoll und zugleich lesbar. Hagedorn ist seinen gewählten Figuren sehr nah, sein Beobachten ist sehr, sehr genau. Berlioz sollte eigentlich Arzt werden, wir erfahren warum! Rossini, der Komponistenstar jener Zeit, liebt Frauen und gute Küche gleich stark. („Man löffelt nun Austern in Kräutersud“), Paganini verspielt seine Honorare in Casinos. Die Cholera wütet in Paris, wir erfahren Einzelheiten: Baron Rothschild kündigt deshalb seine Opernloge. Heine streift durch die Straßen und schreibt darüber. Heine bleibt, um “auf dem Schlachtfelde selbst“ zu schreiben. Über den rastlosen Offenbach sagen die Menschen jener Zeit, er wäre der Richtige, den Fahrplan zu vertonen. Richard Wagner zahlt 4000 Francs für drei Jahresmieten im Voraus.
Hagedorn fängt Klang und Missklang der Epoche ein, instrumentiert Paris als großartiges Orchesterwerk, in dem Dur und Moll zu hören sind, in dem Pauken und Trompeten die neue Zeit ankündigen und Streicher auch die leisen Töne des Lebens anstimmen. Ein Buch, wie eine Symphonie, nicht nur in vier, in vielen Sätzen…
Der Autor Autor Volker Hagedorn, Jahrgang 1961, lebt als Buchautor, Journalist und Musiker in Norddeutschland. Er studierte Viola in Hannover, war Feuilletonredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung und arbeitet seit 1996 frei für DIE ZEIT, verschiedene Rundfunksender, Tageszeitungen und Magazine. Als Barockbratscher hat er besonders mit Cantus Cölln Aufnahmen gemacht und weltweit konzertiert.
Links
Bei Mord: Dreimal schießen - MAFIA LEBEN
Wenn ein Wissenschaftler, Journalist, Romanschriftsteller die Idee hat, ein Mafiabuch zu schreiben, geraten Lektoren in Panik und Verleger suchen das Weite, soviel ist über die Mafia schon geschrieben, philosophiert, untersucht und phantasiert worden, dass es auf keine Kuhhaut, pardon Buchseite mehr geht.
Weit gefehlt, wie so oft in der Buchbranche, Frederico Varese hat mit seinem MAFIA LEBEN ein Buch vorgelegt, in dem es um Liebe, Geld und Tod im Herzen des
organisierten Verbrechens geht. Und tatsächlich gewinnt er dem Dauerthema Mafia eine neue Seite, vielmehr genauer gesagt 335 neue Seiten ab, indem er die vergleichende Methode anwendet, ins Innere
der Mafia vordringt, wissenschaftliche Methoden mit Reportagehaftem kombiniert. Eine neue Sachlichkeit bringt er ins Thema ein, liefert unzählige Fakten, die sich in der vergleichenden Methode
manchmal wiederholen, aber dies zwangsläufig müssen, weil an bestimmten Stellen der Vergleich es an sich erfordert.
Und er beantwortet viele Fragen, historischer Art, gegenwärtiger Themen, kultureller Differenzen und lokaler Eigenheiten, er hat den breiten und den fokussierten Blick, er schaut nach Italien, in
die USA, nach Russland, Japan und China, nie leidenschaftlich, immer reserviert und distanziert, auch wenn es um die brutalsten Methoden der Mörder geht. Varese ist eben Kriminologe, er
blättert in polizeilichen und Justizakten, zitiert aus Interviews mit Mafiagrößen, kennt die bisherigen Veröffentlichungen und zieht interessante Vergleiche: Wie entstehen Mafiastrukturen? Wie gehen
die Mafiosi mit Geld um? Wie werden die Geschäfte der Mafia geführt? Im Kapitel Arbeit spielt die Finanzkrise und deren Folgen für die Mafia die Hauptrolle. Im Kapitel Liebe geht es um die
Sozialbeziehungen und auch um Partnerschaftsprobleme oder die Liebe unter den männlichen und weiblichen Mafiosi.
Selbstbilder thematisiert Varese - sehr stark dargestellt – am Beispiel, wie Imitationsverhalten dazu führt, sich an Filmdarstellern in Mafiafamilien auch in der Realität zu orientieren.
Im Kapitel Politik wagt Varese, „… auf einer allgemeineren Ebene (zu erörtern), wie eine Mafiaorganisation zum Staat werden kann und wie Staaten oft einer Mafia ähneln“.
Im Kapitel Tod geht es um die Tötungstechniken der Mafia. Dreimal schießen und nicht zu nah rangehen, lautete ein konkreter Hinweis zu einem Mordauftrag, und die Latexhandschuhe vorher
ausprobieren.
Zitat: „Mafiosi müssen bereit sein zu töten, und sie müssen es relativ gut können.“
Sie scheuen sich auch nicht, Flammenwerfer und Sprengstoff einzusetzen. Männer in den eigenen Reihen und auch Verwandte können vor allem aus Rache getötet werden.
Die Entsorgungsmethoden sind so menschenverachtend, dass ich sie hier nicht zitieren will.
Aus all den vorherigen Überlegungen leitet der Kriminologe Methoden im Kampf gegen die Mafia. Lesen Sie selbst!
Das Buch ist bebildert und hat einen umfangreichen Anhang. Es findet sich am Ende des Buches auch eine interessante synoptische Tafel der Mafiaregeln und der Mafiastrukturen im Überblick, um sie
zwischen fünf Mafiaorganisationen zu vergleichen.
Die ausführliche Danksagung des Au
tors bezieht sich auf die einzelnen Kapitel, hinzu kommt ein umfangreicher Anmerkungsapparat, sowie Bildnachweis und Personenregister.
Wir lernen Mafiapersonen und Mafiastrukturen kennen aus soziologischer, politischer und kriminologischer Sicht, einzelne Fälle wie Gesamt-Strukturen betrachtend. Ein sehr erhellendes Buch!
Federico Varese ist Professor für Kriminologie an der Universität Oxford und ein Experte für das organisierte Verbrechen. Seine Arbeiten über die russische Mafia
und über die Erschließung neuer krimineller „Märkte“ im Zeitalter der Globalisierung sind Standardwerke. Er hat John Le Carré mehrfach mit seinen Kenntnissen beraten.
Frederico Varese Mafia Leben CHBeck
Länderauskunft: GEORGIEN
Das Christentum ist hier in seiner orthodoxen Variante viel länger herrschende Religion als in den meisten Ländern der Europäischen Union, mit der das Land ein Assoziierungsabkommen geschlossen hat. Wie verträgt sich das mit der Diskussion, ob Georgien als „sicheres Herkunftsland“ anzusehen ist? Fliehen die Menschen aus dem Land oder wandern sie einfach aus? Seit der Unabhängigkeit im Zuge der Auflösung der Sowjetunion haben annähernd eine Million das Land verlassen.
Ein Land also voller Widersprüche zwischen Asien und Europa, zwischen jahrhundertelangen Besetzungen von Türken, Persern, Russen und neuer, stolzer Unabhängigkeit. Ein solches Land zu porträtieren
bedarf genauer Kenntnis der Zustände vor Ort und genauer Recherchen.
Kann man sich einen kompetenteren Porträtisten vorstellen als den 1940 geborenen Slawisten und Politologen Dieter Boden? Er absolvierte im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik mehrere Einsätze in
diplomatischen Vertretungen in Osteuropa und im Kaukasus. 1995/96 und 1999 – 2002 leitete er OSZE- und UN-Missionen in Georgien. Er beteiligt sich bis heute an zivilgesellschaftlicher Projektarbeit
im Kaukasus. In seinem Buch beschreibt er auf knappem Raum mit allen wichtigen Details Geschichte und Landschaft, Menschen und Kultur, Religion und die Konflikte mit dem übermächtigen Nachbarn um die
abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien. Dabei verfällt er nicht in einen Jargon des Kalten Krieges sondern pflegt einen diplomatischen Ton. Die beiden hierzulande berühmtesten
Persönlichkeiten Georgiens könnten unterschiedlicher kaum sein: Stalin und Schewardnadse, dessen zehn Jahre währende, heute in Georgien kritisch betrachtete Präsidentschaft Boden mit objetivem Blick
von außen angemessen würdigt.
Die multiethnische Bevölkerung lebt seit Jahrhunderten friedlich miteinander. Trotz der Land und Gesellschaft dominierenden orthodoxen Kirche herrscht religiöse Toleranz. Die wohl einzige Moschee in der ganzen Welt, die Sunniten und Schiiten gemeinsam als Gotteshaus benutzen, steht in Tbilissi, unweit des jüdischen Viertels mit zwei Synagogen. Allerdings ist ein großer Teil der bis vor wenigen Jahrzehnten über 100.000 Mitglieder zählenden Jüdischen Gemeinde nach Israel ausgewandert.
Die ausgezeichnete georgische Küche lobt der Autor aus eigener jahrelanger Kenntnis und die hervorragenden Weine hat er selbst verkostet. Der georgische Weißwein wird übrigens nicht wie bei uns
gekeltert sondern mit „Haut und Haaren“ vergoren, was ihm seine besondere Farbe und seinen eigenen Geschmack verleiht. Man erfährt etwas über die früheren Beiträge von Deutschen zur Kultur und
Entwicklung des Landes, über deutsche Siedlungen und die deutschen Kriegsgefangenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige Aufbauarbeiten durchführten. Detailreich beschreibt Boden die leider
häufig dem Verfall preisgegebene Jugendstilarchitektur des historischen Tbilissi das um 1900 ein Traumziel von Intellektuellen und der Boheme aus ganz Europa war. Das schöne restaurierte Stadtpalais,
das ein deutscher Architekt für einen georgischen Brandy-Fabrikanten errichten ließ, beherbergt heute den georgischen Schriftstellerverband. Der jahrundertealten Literatur, dem Stolz des ganzen
Landes, widmet er mehr als nur Fußnoten und auch den anderen Künsten mehr als nur Pflichtbeiträge. Wer weiß schon, daß der große Choreograph des New Yorks City Balletts, George Balanchine, Georgier
war? Oder auf einem anderen Gebiet: Wer erinnert sich daran, daß der georgische Fußballmeister Dynamo Tiflis 1981 im Europapokal der Landesmeister Carl-Zeiss Jena aus der DDR mit 2:1 besiegte?
Ein solches Land auf 200 Seiten zu porträtieren ist eine Kunst. Dieter Boden informiert über wirklich viel in sehr gut lesbarer Form. Für alle, die das „Fest Georgien“ in diesem Sommer und Herbst
miterleben wollen, ist es eine Festschrift im besten Sinne des Wortes.
Harald Loch
Dieter Boden: Georgien. Ein Länderporträt
Ch. Links Verlag, Berlin 2018 200 Seiten 18 Euro
Auch morgen wird eine Zukunft sein
Das Fenster zum Blick nach vorn, ob auf das Paradies auf Erden oder apokalyptische Zustände, jedenfalls auf mehr Wissen und Erkenntnis ist seit mehr als 25 Jahren durch die sogenannte „Edge“-Frage, die der 77 jährige Visionär John Brockman aus Bosten gelegentlich stellt, sperrangelweit geöffnet. Er richtet an führende Wissenschaftler vor allem aus den USA folgende Frage: „Was halten Sie für die interessanteste wissenschaftliche Neuigkeit unserer Zeit? Was macht die Bedeutung dieser Neuigkeit aus?“ Knapp 200 Antworten sind 2017 bei Brockman eingegangen. Jetzt liegt die hervorragende deutsche Übersetzung in einer erfreulich erschwinglichen Taschenbuch-Erstausgabe vor. Science Fiction ist langweilig gegenüber diesem tour d’horizon durch die pipelines der Wissenschaft.
Er zeichnet kein ganz genaues Bild von den Ideen, Entdeckungen und Erfindungen der Zukunft, aber er lässt nicht nur ahnen, wo die Reise hingeht oder wo sie hingehen sollte - wie in einem Zug, in dem die folgenden Stationen schon angekündigt sind, aber niemand weiß, ob die Bahn sie auch tatsächlich erreichen wird.
Die aufregende Lektüre der bis zu drei oder vier Seiten umfassenden Antworten muss nicht der Anordnung des Buches folgen. Wer zufällig eine Seite aufschlägt, landet immer intellektuelle Volltreffer.
Die Details versteht manchmal nur der Spezialist. Aber der an Wissenschaft Interessierte wird in jedem der Beiträge nicht nur auf den Kern zukünftiger Erkenntnis oder Erfindung stossen sondern deren
Bedeutung andeutungsweise ermessen können. Ein paar Beispiele: Der theoretische Physiker Sean Carroll vom Caltech schreibt: „Wir kennen alle Teilchen seit der Entdeckung des Higgs-Bosons.
Sie ist eine der größten Errungenschaften des menschlichen Geistes. Herauszufinden, wie diese einfachen Bausteine zusammenwirken und unsere komplexe Welt hervorbringen, ist eine Aufgabe, an der noch viele Generationen arbeiten werden.“ Oder: Der Begründer der evolutionären Psychologie John Tooby aus Santa Barbara beschreibt den andauerneden „Wettlauf zwischen genetischer Kernschmelze und gentechnischen Eingriffen in die Keimbahn.“ Der Kognitionswissenschaftler Joshua Bach vom MIT behauptet: „Alles ist Rechnen. Rechnen ist etwas anderes als Mathematik. Immer mehr Physiker erkennen, dass unser Universum nicht mathematischen, sondern rechnerischen Charakters ist und die Physik die Aufgabe hat, einen Algorithmus zu finden, der unsere Beobachtungen zu reproduzieren vermag.“
In eine ähnliche Kerbe haut der Physiker Alexander Wissner-Gross, ebenfalls vom MIT, der schreibt: „Datensätze sind wichtiger als Algorithmen!“ Die Anthropologin Nina Jablonski von der Penn State University fast ihren Beitrag wie folgt zusammen: „Lassen Sie uns unseren Körper nicht länger als Tempel aus Sehnen und einem Gehirn begreifen, sondern als sich weiterentwickelndes Ökosystem voller Bakterien, die unsere Gesundheit auf sehr viel mehr Arten und Weisen steuern, als wir uns je vorstellen können.“ Der Sozialpsychologe Richard Nisbett aus Michigan beschreibt die Desillusionierung und Unzufriedenheit armer weißer US-Amerikaner (eine Ursache des nicht verstandenen Trump-Erfolgs). Er fordert, „die Wissenschaft muss noch mit überzeugenden Theorien aufwarten, die aufzeigen, wie das Schicksal armer Weißer am unteren Ende der sozialen Leiter verbessert weden kann“. Die Pholosphin Rebecca Newberger Goldstein aus New York schreibt über „Genderisierung der Genialität“.
Sie hält die Unterschätzung des kreativen Potentials mehr als der Hälfte (der weiblichen) unserer Bevölkerung für so wichtig, dass ihre Überwindung einen großen Segen für die Menschheit bringen
würde. Manche Beiträge desillusionieren die Propheten der KI, indem sie die Geschwindigkeit der Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz auf mehrere menschliche Lebensspannen reduzieren.
Ein anderes wichtiges Thema behandelt der Evolutionsforscher Michael McCullough, der unter dem Titel “Die religiöse Moral schlägt meist unter der Gürtellinie zu“ das Phänomen beschreibt, dass
religiöser Eifer und Fanatismus sich meist an Fragen der Sexualität entzünden „mit dem netten kleinen Extra, Gott auf seiner Seit zu wähnen“.
Mathematik und Informatik, Umweltschutz und Wirtschaftswissenschaften, Astronomie und Mikrobiologie – Bereiche der Wissenschaft, in denen in absehbarer Zukunft grundlegen Neues zu erwarten oder zu
erhoffen ist. Fast 200 Beiträge renommierter Wissenschaftler geben einen durchaus auch unterhaltsamenVorgeschmack auf morgen, der nicht immer bitter aber auch nicht nur angenehm ist. Ein sehr
interessantes Buch, das aufzeigt, wie entscheidend Wissenschaft die Welt von gestern und heute in eine von morgen verwandeln wird.
Harald Loch
John Brockman (Hrsg.): Neuigkeiten von morgen
Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über die wichtigsten Ideen, Entdeckungen und Erfindungen der Zukunft
Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff und Jürgen Schröder
Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2018 635 Seiten 15 Euro
Bayern leuchtet literarisch
Ist es möglich, 1300 Jahre Literaturgeschichte in einem Buch zusammenzufassen? Ja, es ist möglich! Ist es zulässig, regionale Literaturgeschichte, eine bayerische Literaturgeschichte für sich alleine zusammenzutragen. Ja, sagt Klaus Wolf, Professor für Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit an der Universität Augsburg!
Zumal Bayern als Staat älter ist als Deutschland. Mangelnde territoriale Kontinuität in der Geschichte gilt ja für ganz Europa im allgemeinen, und Literaturgeschichte kann sich ja nicht allein nur an
Städten orientieren, das wäre ein zu schmaler Focus.
Sich an Stämmen und Landschaften zu orientieren, wäre genauso fragwürdig. Die regionale Geschichtsschreibung hat immens zugenommen, doch in der Literaturgeschichte stellt man blinde Flecken
fest.
Der literarische Regionalismus animiert also den Autor. Ebenso wäre es fahrlässig sich allein auf die urbanen Zentren zu stürzen. Auch wollte der Autor kein Nachschlagewerk erstellen.
Die Methode, die Wolf anwendet, ist, übergreifend historisch-gesellschaftliche Interessen zu benennen, die spezifische Literaturtypen und Traditionen hervorgebracht hat.
Dabei spielten Kunst und Kirchengeschichte, Geschichte überhaupt mit, übergreifende Themen also, die nicht allein an Epochen orientiert sind und eine reine Chronologie verbieten.
Der Autor bietet eine Gesamtschau wichtiger Gattungen, Werke und Autoren, also eine fundierte Gesamtdarstellung, die von der Literatur des 8. Jahrhunderts bis hinein in die heutigen Tage zu Django
Asül und Gerhard Polt reicht.
Von den Agilofingern und Karolingern führt uns Wolf zu den Wittelsbachern, vom literarischen Leben um Ludwig den Bayern zu Universitätsstädten in Bayern und Meistersingern um Hans Sachs, von der
Türkenmode bis zur Prinzregentenzeit, von den Literaten im I.Weltkrieg über die Nazizeit und bis zur Gruppe 47 und den Münchner Turmschreibern. Ja sogar Film- und Fernsehen, das Kabarett und München
als Filmschauplatz werden mit berücksichtigt.
Die Literaturgeschichte beansprucht keine Vollständigkeit, sie ist ausführlich, fundiert, setzt besondere Akzente und geht exemplarisch vor. In Abwandlung von Thomas Mann möchte man formulieren - in
diesem Buch: Bayern leuchtet literarisch!
Mehr vom Meer
Geschichte spielt sich an Land ab, vieles entscheidet sich aber auf dem Meer. Eine Historiographie, die von beidem erzählt, wird keine bloße Geschichte der Seefahrt sein, aber die Perspektive wird
sich auf die Entwicklungen auf den Meeren und deren Einfluss auf den festen Teil der Erde richten, auf dem die Menschen leben. Der Historiker Jürgen Elvert nimmt in seinem Buch „Europa, das Meer und
die Welt“ die Neuzeit des Kontinents in seinen Blick, der mit seiner riesigen Küstenlänge wie kein anderer von einer „maritimen“ Geschichte bestimmt wird. Dazu muss der Autor nicht die ganze
Entwicklung Europas nacherzählen, ohne sie bei allen Lesern als bekannt vorauszusetzen. Er beschränkt sich auf die Wechselbeziehungen zwischen Land und Meer, vertieft an wichtigen Stellen bis ins
Detail und streift großzügig über andere Ereignisse, die für sein Narrativ eine geringere Bedeutung haben. Der Autor ist 1955 in Eckernförde geboren, ist also mit Ostseewasser getauft, in einer
kleinen Hafenstadt aufgewachsen. Sein Buch ist aus einem Forschungsprojekt an der Universität zu Köln hervorgegangen, das von der Europäischen Union im Rahmen der Jean-Monnet-Förderlinie unterstützt
wird. Parallel zum Buch wurde die Sonderausstellung des Deutschen Historischen Museum in Berlin zum Thema „Europa und das Meer“ (13.6.2018 – 9.1.2019) entwickelt. Ein dritter Teil des
Jean-Monnet-Projekts wird derzeit vorbereitet, in dem es um die Rolle von Häfen geht.
Seine Grundgedanken beschreibt Elvert in einem leidenschaftlichen Prolog: „Das Meer ist der rote Faden in diesem Buch, denn über das Meer veränderten die Europäer die Welt. Diese wiederum veränderte
daraufhin – ebenso über das Meer – die Europäer. Die Hafenstädte, in denen die Wechselwirkungen zwischen Europa und der Welt zuerst, unmittelbar und ungefiltert ihre ganze Dynamik entfalten konnten,
waren gewissermaßen Laboratorien der europäischen Moderne, weil in ihnen – bildlich gesprochen – großangelegte Experimente stattfanden, welche die Entwicklung auch der Gesellschaften im Hinterland
des Kontinents stark und nachhaltig beeinflussten.“ Diesem Entwurf seiner Geschichtserzählung folgt der Autor auf erstaunlich vielen Teilgebieten. Die Entwicklung der maritimen Hard- und Software,
also von Schiffen und Hafenanlagen wie Karten und Navigationsmitteln beschreibt Elvert ebenso sachkundig und detailreich wie die Fahrten der Entdecker, die Lebensschicksale einzelner Pioniere, die
volks- und betriebswirtschaftlichen Aspekte der Welterschließung über die Meere, den Einfluss von religiöser Missionsarbeit, den europäischen Sklavenhandel oder die Entwicklung des Seevölkerrechts
wie die überseeische Migration. Er betrachtet die sich geradezu revolutionäre Entwicklung der Konsumgewohnheiten durch bislang unbekannte Pflanzen wie Kartoffel oder Tomate und von Genussmitteln wie
Tee, Kaffee oder Tabak, die alle erst von Übersee nach Europa kamen und ihren Einfluss auf die Gesellschaft.
Zahlreiche Abbildungen vermitteln eine schöne Ergänzung des ohnehin sehr plastisch erzählten Textes. Zwei große Karten im Vor- bzw. Nachsatz zeigen die Entdeckungsfahren über die drei Weltmeere und
werden durch ausführliche Erläuterungen intelligent erschlossen. Dadurch wird das Buch zum Nachlagewerk mit Bestand. Es wendet sich an ein historisch interessiertes Publikum, das sich von dieser
neuen, maritimen Perspektive der europäischen Geschichte überraschen lassen will und bei der Lektüre viel erfahren wird, was bisher nur Spezialisten unter den Historikern bekannt war. In der
Einschätzung und Gewichtung mancher Ereignisse beweist der Autor keine ungestüme aber behutsame Urteilskraft. Entstanden ist eine in Stil und Inhalt überzeugende neue Geschichtserzählung von Europa
in der sich über das Meer erweiternden Welt.
Harald Loch
Jürgen Elvert: Europa, das Meer und die Welt
Eine maritime Geschichte der Neuzeit
Deutsche Verlagsanstalt, München 2018 591 Seiten 45 Euro
Oper zwischen Diktatur und Demokratie
Titel Misha Aster STAATSOPER Die bewegte Geschichte der Berliner Lindenoper im 20. Jahrhundert Mit einem Vorwort von Daniel Barenboim SIEDLER
Autor Misha Aster, geboren 1978 in Kanada, ist Historiker, Musikwissenschaftler und Dramaturg.
Inhalt Die bewegte Geschichte der Berliner Lindenoper in einem breiten Geschichtspanorama im 20. Jahrhundert
Gestaltung 540 Seiten, Hardcover mit Fotos im Text integriert inklusive Vorwort von Daniel Barenboim. Aus dem Englischen von Martin Richter
Vorwort, Einleitung, 9 Kapitel, Epilog, Dank und umfangreicher Anhang mit Anmerkungen, Quellen- und Literaturverzeichnis, Personenregister und Bildnachweis
Cover Blick in die Stuhlreihen und auf den Balkon
Zitat „Die Geschichte der Berliner Staatsoper verzeichnet Tradition und Schmerz, Tragödie und Mut, große Erfolge und tiefes Scheitern - Begleitung und Taktschlag für die unermüdliche Suche nach seiner Identität“.
Meinung Meine Güte, was für ein detailreiches, tiefgründiges, ausführliches Geschichtspanorama, das der kanadische Historiker, Musikwissenschaftler und Dramaturg da zeichnet. Es ist nicht weniger, als ein deutsches Opernhaus in einem deutschen Jahrhundert darzustellen, das linke und rechtsradikale Revolutionen, also Diktaturen und Demokratien, miterlebt hat, das – wie Barenboim im Vorwort schreibt – „ … hinsichtlich ihrer Historie“ einzigartig dasteht.
Die Chronik der Oper ist parallellaufend zur Geschichte des 20. Jahrhunderts bis 1989, von Hofoper der Hohenzollern, über die Deutsche Staatsoper bis zur Staatsoper Unter den Linden, der Daniel
Barenboim nun schon seit 25 Jahren vorsteht. Es eine Geschichtsdarstellung durch die handelnden Personen der Staatsoperngemeinschaft betrachtet, wie der Autor eingangs schreibt.
In der Hyperinflation kostete ein Opernplatz hunderte Millionen, in der Nazizeit trat die Oper im Gleichschritt und unter Görings Schutz auch nicht, die Oper erlebt Klemperer und Richard Strauss,
Staatsakte mit Führerloge, Goebbels war stets für ein aktives Eingreifen der Regierung in die Kultur.
Karajan startet seine Karriere und wird zum Herausforderer für Furtwängler. Wir erleben die Oper im Nachkriegsberlin einer Trümmerstadt, die geteilt war in Ost und West. Und plötzlich lag die Oper
hinter der Mauer im Osten, und es stellte sich die Frage: Wer kann in der DDR dirigieren, und das war erst mal nicht politisch, sondern musikalisch gemeint, und dürfen Westkünstler in Ost-Opern
auftreten?
Die DDR entschied sich für den dogmatischen Kurs. Auf der Bühne und im Orchestergraben treten auch IMs auf, die das Verhalten der Staatsopernbediensteten zu Westbesuchern auskundschaften.
Ausführlich beschäftigt sich der Autor mit der Staatsoper in der Wendezeit und dem Antritt Daniel Barenboims in turbulenten Zeiten der Wiedervereinigungsproblematiken. Und am Ende steht die
Erkenntnis, dass Geschichte keine Ansammlung positivistischer Art von stetigem Lernen und Wachstum ist, sondern ein gefährlicher Hindernislauf voller Versuche und Irrtümer. Die aktuellen Zeiten
kommen etwas zu kurz, aber mit der Gegenwart fremdeln Historiker naturgemäß, weil sie sich in die Geschichte vertiefen. Und in diesem Fall sehr tief.
Leser Eher nur für Opernfans und Geschichtsinteressierte – ein Buch mit großem Personaltableau und historischer Breite
Pressestimmen
„Misha Aster hat die verschlungenen Wege der Berliner ‚Staatsoper‘ mit dem emotionalen Elan des findigen, die historischen Quellen virtuos ausschöpfenden Geschichtsschreibers erzählt.“ Süddeutsche
Zeitung (07.12.2017
AUDIOS
Audio BR-Klassik https://www.br-klassik.de/aktuell/br-klassik-empfiehlt/buecher/buch-misha-aster-staatsoper-berlin-100.html
Interview mit dem Autor RBB DOWNLOAD (MP3, 6 MB)
WDR 3 https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-buchrezension/buchrezensionen112.podcast
Zwangsgeräumt - Armut in den USA
Vor zehn Jahren erschütterte die Finanzkrise die Welt. Sie hatte in den USA als Immobilienkrise begonnen und riesige Verluste bei Banken, Versicherungen und Privatpersonen verursacht. In den meisten Fällen mussten die Steuerzahler die Sünden der Zocker im Finanzkapitalismus bezahlen. Dabei gerieten die Verluste derjenigen aus dem Blick, die keine Steuern zahlen – nicht, weil sie sie raffiniert vermeiden, sondern weil sie zu arm sind, über kein steuerpflichtiges Einkommen verfügen. Auf dem Höhepunkt der Krise hat der amerikanische Soziologe Matthew Desmond von Mai 2008 bis Dezember 2009 eine bemerkenswerte Feldforschung unternommen, über die er jetzt nach einem Prozess des Nachdenkens in einem bemerkenswerten Buch Zeugnis ablegt: „Zwangsgeräumt“. Die New York Times urteilte beim Erscheinen des amerikanischen Originals im vergangenen Jahr: „Ein kometenhaftes Buch – etwas, das nur sehr selten erscheint.“
Der Autor ist inzwischen Professor für Soziologie an der Harvard University. Er wollte seinerzeit wissen, wie es am untersten Ende der Betroffenheit der subprime-crisis aussieht. Er mietete sich in den ärmsten Vierteln der amerikanischen Großstadt Milwaukee ein. Zunächst in einen Trailer-Park, in dem 130 Wohnwagen an exmittierte Einzelpersonen und Familien für jeweils etwa 500 $ vermietet wurden. Danach zog er in ein nahezu ausschließlich von Schwarzen bewohntes Viertel der Stadt. Er lebte und sprach mit seinen Nachbarn, erkundete deren Wohnungssituation, hielt dabei den für seine Forschungen notwendigen Abstand, entwickelte aber aus diesem Abstand die Empathie, aus der er die Motivation für sein Buch und sein Engagement entnimmt. Er erzählt die Geschichte von acht Familien am ärmsten Rand der amerikanischen Gesellschaft. Er sieht auch auf die Lage von Vermietern, die mangels anderer Alternativen von ihrem kleinen Vermögen ein oder mehrere Miethäuser erworben haben und diese kaum instand halten können. Deshalb schmeißen sie säumige Mieter raus -oft mit ungesetzlichen Mitteln. „Zwangsgeräumt“ erzählt von Schicksalen, in denen der Lebensmittelpunkt, die eigene Wohnung, zur Quelle von Verzweiflung, Kriminalität, Drogensucht und Suizid wird.
Die aus Hunderten von Begegnungen ausgewählten acht Beispiele stehen für Millionen Amerikaner. Das spannend erzählte Buch wird zum soziologischen Meisterwerk durch die vielen, oft sehr ausführlichen Fußnoten. In ihnen werden Zahlenwerke und Forschungsergebnisse aus der eher typischen Großstadt Milwaukee aber auch aus den ganzen USA als Hintergrund zusammengetragen. Aus den Beispielen wächst ein Allgemeines zusammen. Wohnungs- und Sozialpolitik, Rassismus und familiäre Gewalt auf dem Boden unakzeptabler Wohnbedingungen, Stadtplanung und Einkommensverteilung – alles gehört auf seinen Prüfstand. Das Prekariat in einem der wohlhabendsten Länder der Welt schreit zum Himmel, der nicht helfen wird – das weiß auch der Autor, der Sohn eines Predigers ist.
Die Wohnungsnot nimmt auch hierzulande immer dramatischere Formen an. Zwar sind die sozialen Netze hier deutlich haltbarer als in den USA, wo angeblich jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und wo
der „amerikanische Traum“ für Millionen zum Alptraum geworden ist. Aber wenn hier die Zinsen deutlich steigen, die Immobilienkredite nicht mehr bezahlbar sind, wenn die Arbeitslosigkeit einmal wieder
steigen wird, stellen sich die Probleme ähnlich dar: unbezahlbarer Wohnraum wird zu dem führen, was der Autor mit seinem Buch beklagt: „Zwangsgeräumt“!
Harald Loch
Matthew Desmond: Zwangsgeräumt – Armut und Profit in der Stadt
Aus dem Amerikanischen von Volker Zimmermann und Isabelle Brandstetter
Ullstein, Berlin 2018 536 Seiten 26 Euro
Die Kunst des Interviews
Warum ist das Buch so spannend zu lesen?
Weil Sven Michaelsen in seinen besten Interviews mit den Promis dieser Welt einen Tiefgang erreicht und dabei viele Überraschungsmomente liefert. Vor allem ist es die psychologische Ebene, die beim Interviewpartner Lockerungsmomente verursacht, Offenheit herstellt. Geleitet von Geduld, Witz und sanfter Neugier, wie Benedikt Erenz im Vorwort schreibt. Ob Modemenschen oder Popliteraten, Literaturkritiker oder Literaturproduzenten, Verlegerpäpste oder Schauspielerinnen, Philosophieprofessoren oder DDR- Dissidenten, es ist eine Art langsamer Sezierprozess, eine Art Frage-Computertomographie, die diese Interviewpersonen durchleuchtet.
Handke erweist sich wieder einmal als Widerspenstiger: „Sie blättern da wie ein Untersuchungsrichter in ihren Aufzeichnungen.“ Raddatz erzählt wieder einmal sein Kindheitstrauma, von seiner
Stiefmutter verführt worden zu sein, auf Anleitung seines Vaters, warum er so gerne den Eitelkeits-Hypochonder-Dandy gibt und woran die Freundschaft mit Grass zerbrach. Die Promisekretärin von
Augstein, Kanzler Schmidt und Raddatz Heide Sommer öffnet ihr Nähkästchen und plaudert munter drauf los, wer es mit wem hatte. Ruth Klüger berichtet aus der KZ-Hölle und hält Walsers Roman Tod eines
Kritikers für antisemitisch. Sloterdijk outet sich als bekennender Bagwhan-Jünger. Er hält 90 Prozent der sexuellen Aktivitäten für „blöde Rammelei“. Er beschimpft die Wochenzeitung ZEIT:
„Anbiederung an die Massenkultur“. Und er wird sterben, weil er vom Fahrrad fällt.
Die Verlegerin Inge Feltrinelli lebte mit Hemingway auf dessen Finca auf Kuba, traf Ulrike Meinhof auf Sylt, wurde Grossverlegerin („Dr. Schiwago“, „Der Leopard“) und überlebte 57 Buchmessen.
Suhrkamp-Lektor Fellinger bearbeitete Handke-Manuskripte und Bernhard-Bücher „als großer Dulder“ und bekennt: „Welcher Schriftsteller ist kein Kotzbrocken?“ Hanna Schygulla findet sich nicht schön,
liebte den Drehbuchautor Jean Claude Carriere, bekam nie einen Heiratsantrag und hielt den chaotischen Despoten Fassbinder aus.
Und Hubert Burda, der als „Rheumadeckenverleger“ von Kollegen gehänselt wurde, nennt Peter Handke seinen Freund, spielt den Internetpropheten, kann aber nicht mal eine Mail schreiben, doch, was ihn
im Innersten beschäftigt ist: „Sterben lernen“.
Sven Michaelsen DAS DRUCKEN SIE ABER NICHT Die besten Interviews PIPER
Saviano/Lorenzo Erklär mir Italien
Titel Roberto Saviano/Giovanni di Lorenzo: Erklär mir Italien! Übersetzung Sabina Kienlechner. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017, 266 Seiten.
Autor Giovanni di Lorenzo ist deutsch-italienischer Herkunft, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Fernsehmoderator und Autor zahlreicher Bestseller: »Vom Aufstieg und anderen Niederlagen« (2014), zusammen mit Helmut Schmidt »Verstehen Sie das, Herr Schmidt?« (2012) und »Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt« (2009) sowie mit Axel Hacke »Wofür stehst Du?« (2010).
Roberto Saviano ist der heute wohl bekannteste Autor Italiens. Sein Buch »Gomorrha«, das von den Machenschaften der neapolitanischen Camorra in seinem unmittelbaren Umfeld berichtet, wurde zu einem Weltbestseller und später als preisgekrönter Film und als TV-Serie adaptiert.
Gestaltung Handliches Hardcover, Inhaltsverzeichnis, Zitate als Überschriften mit Inhaltserklärungen in der Unterzeile, ein gemeinsames selbstreflektorisches Skype-Gespräch zum Schluss über das Buch und Danksagung
Cover Beide Autoren als Porträt-Köpfe, dazwischen als Trenner die Schlagzeile und ein zweites farbiges Coverbild: Vespa und Madonna
Zitat „Es gibt keinen frommeren Menschen als einen Mafioso“.
Meinung Saviano kann analysieren, hat historischen Background. Lorenzo, Halbitaliener kann fragen und bekommt Antworten. Doch der Buchtitel: „Erklär mir Italien“ führt etwas in die Irre: „Erklär mir die Mafia und Italien“ wäre der genauere gewesen, denn mehr als ein Drittel der Kapitel beziehen sich auf das Mafia-Italien und auch auf den anderen Seiten spielt das Thema immer wieder hinein. „Wo bleibt das Positive“ über Italien, á la Kästner, möchte man fragen, ja verdammt wo bleibt es denn…
Das Buch ist düster, kein Wunder, wenn man das Thema durch die Brille eines bedrohten Journalisten sehen muss, der zeitweise in New York lebt, seine Heimat nur ab und an besuchen kann und darf und ständig seit 2006 unter Polizeischutz lebt. Wer das „Gomorrha“-Besuch des renommierten Buchautors gelesen hat, weiß schon ziemlich vier über die mafiösen Strukturen vor allem des südlichen Italiens.
Eine Kritikerin vom SPIEGEL meckert über das „platte Bild“ vom alpinen Norden bis zur südlichsten Spitze Siziliens. Platt ist es nicht, aber zuweilen „plätschernd“, eben gesprächig. Ein „Talk“ besteht eben aus Zuspitzungen, Pointen, Anekdoten, da fallen Fakten schon mal unter den Tisch, das fordert Kritiker heraus, sie haben Di Lorenzo vorgeworfen, zu sehr den eigenen Klischees und Stereotypen als Halbitaliener nachzuhängen und Saviano wird hinterfragt, weil er die vielfältige Anti-Mafia Bewegung nicht genau genug zu würdigen vermag.
Dennoch erfahren wir viel über Land und Leute, Liebe und Laster, die Mafiahochburgen und die PATEN, über Berlusconi und Babykiller, den Süden und Norden und vieles, vieles mehr. Doch das liebenswürdige, opernverrückte, kulinarische, historische Italien mit seinen Geistesgrößen und seinen Fußball-Verrückten steht etwas im Abseits.
Vielleicht stehen der Italiener und der Halbitaliener ihrer Heimat zu nahe und vielleicht sind sie auch ein bisschen zu gut befreundet. Dennoch liest sich das Buch unterhaltsam und spannend zugleich, wir hören beim Lesen des Buches mehr zu als wir es lesen. Und es gilt auch ein zweites Zitat Kästners: „Ein Friedhof ist kein Lunapark“.
Leser Italien-Fans und Kritiker
PRESSE
»Für Leser ist dieses Buch wie ein Abend bei Freunden, die einem das rätselhafte Italien begreiflich machen.« Giuseppe Di Grazia, Stern
»Ein tolles Interviewbuch, habe ich mit großer Freude gelesen.« Markus Lanz
»Wer Italien liebt, liebt es nach der Lektüre noch intensiver.« Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Spannend und im freundschaftlichen Dialog dann ansatzweise auch spannungsvoll [...].« Peter von Becker, Der Tagesspiegel
Der fremde Freund Frankreich
Jean-Christophe Bailly: Fremd gewordenes Land
Die Methode ist überzeugend und sollte ansteckend wirken. Das Ergebnis ist zweifach interessant. Der 1949 in Paris geborene Jean-Christophe Bailly „wollte verstehen, was Frankreich heute bezeichnet
und ob es zutrifft, dass es etwas bezeichnet, was per se anderswo nicht existieren könnte, jedenfalls nicht so und nicht in dieser Weise.“ Er kam zu diesem Zweck auf die Idee, sich „einfach an Ort
und Stelle umzusehen, das Land zu bereisen“. Ein Erstaunen hatte diese Neugier auf das Land ausgelöst, von dem er „abstammte“. In jungen Jahren, nicht lange nach den ihn nicht unberührt lassenden
Ereignissen vom Mai 1968 hatte er in New York einen Film von Jean Renoir gesehen und festgestellt, dass er in ihm eine „Gemütsregung der Herkunft“ aufruft, die er in sich nicht mehr vermutet hatte.
Drei Jahrzehnte später macht er Ernst mit der Erkundung des Landes, um seine Beziehung zu ihm genauer kennenzulernen. Er ist inzwischen Doktor der Philosophie und Professor an der École nationale
supérieure de la nature et du paysage in Blois. Das Buch, dessen von Andreas Riehle angemessene Übersetzung ins Deutsche hier angezeigt wird, trägt im Original den Titel „Le Dépaysement“, was so viel
wie Fremdheit, Umstellung, Abwechselung bedeuten kann. Die Methode der Erkundung des eigenen Landes kann man verallgemeinern, sie wäre auch in Deutschland, Polen oder Spanien anwendbar.
Das Ergebnis dieser Erkundung birgt doppelten Gewinn: Das in der Übersetzung „Fremd gewordenes Land“ heißende Buch schafft in seinen über 30, das Land geografisch kleinteilig vermessenden Essays so
etwas wie eine eher intime als allwissende Vertrautheit mit Frankreich. Die Reise geht von einem seit 400 Jahren in Familienbesitz befindlichen Hersteller von Fischernetzen in Bordeaux über die
Schlachtfelder und Kriegsgräber des Ersten Weltkrieges und die Obszönität der Heldendenkmäler bis zu Kuhställen von Kleinbauern im Jura oder den bunten, quirligen Randbezirken von Paris und der
angrenzenden Banlieue. Bailly erzählt von den Kleingärten der Arbeiterkolonien in Saint Etienne und ihrer sozialen Bedeutung ebenso wie von den christlichen Traditionen um Tarascon in der Provence.
Der Kenner dieses Landes wird seine „Kenntnis“ schnell vertiefen, der Neuling wird seine Neugier, es kennenzulernen nicht zähmen wollen. Das ist ein schöner, den Intentionen des Buches aber nicht
genügender Gewinn. Der zweite, wichtigere ist: Der Autor entdeckt sein Land nicht als einheitliche „Nation“, deren „gloire“ er neu besingen lernt. Er sieht und empfindet keine „Identität“ mit seinem
Land sondern eine Vielfalt von regionalen, sozialen, religiösen oder von der Herkunft zu bestimmenden Identitäten. Den in Mode gekommenen Begriff „Heimat“ belebt Bailly in seinen oft liebevollen,
zuweilen kritischen Detailvermessungen keineswegs. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen geschichtlicher Substanz und aktueller Erscheinung, zwischen Wohnsituation, Arbeit, Tradition,
Sprache und Dialekt sind groß und für den, der sie schätzen kann auch großartig. Aber „die schlimmste Bedrohung, die auf sämtlichen Zeichen von Kultur lasten kann, ist, was sie auf das Niveau eines
Diskurses über die Werte absenkt. Er kündigt im ersten Moment immer den Rückzug an (unsere Werte) und im zweiten, gleich darauf folgend, die Ausgrenzung (unsere Werte sind die einzig wirklichen). …
Es geht darum, das Land daran zu hindern, dass es in der Pose der Identität erstarrt“, resümiert der Essayist, dessen intellektueller Stil hierzulande „französisch“ anmutet, in Frankreich aber in die
Nähe des die Wissenschaften und die Künste umspannenden Gedankens der „Enzyklopädie“ des deutschen Frühromantikers Novalis gerückt wird. Baillys Prosa atmet jedoch eine Poesie, die auch in der
Übersetzung grenzenlos wirkt.
Harald Loch
Jean-Christophe Bailly: Fremd gewordenes Land. Streifzüge durch Frankreich
Aus dem Französischen von Andreas Riehle, mit einem Nachwort von Hanns Zischler
Matthes & Seitz, Berlin 2017 464 Seiten 28 Euro
Der "weibliche" Iran
Iran ist eine spielentscheidende Mittelmacht im Mittleren Osten. Das Land hat über 80 Millionen Einwohner, ist mehr als dreimal so groß wie die Bundesrepublik, verfügt über reiche Öl- und Gasvorkommen und die mit Abstand „modernste“ Bevölkerung in middle east. Deshalb lohnt es sich, mehr über das Land und die Menschen dort zu erfahren, seine Geschichte nachzuvollziehen und seine Stigmatisierung aufzulösen. Es gibt keinen besseren Weg zu einem guten Verständnis des Landes als das Buch der weitgereisten Charlotte Wiedemann: „Der neue Iran. Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten“. Dieser Schatten ist zu einem Teil von den westlichen Beobachtern selbst verursacht. Seit dem Sturz des Schahs und der iranischen Revolution, seit der Installation der Theokratie unter Ayatolla Khomeini hatte sich die Aufmerksamkeit Amerikas und der Europäer ausschließlich auf die schlimmen Nachrichten aus Iran gerichtet. Während des Iran-Irak-Kriegs von 1980 bis 1988 unterstützten die USA ihren späteren Feind Saddam Hussein und den Irak nicht nur logistisch. Sie und europäische Partner lieferten auch die Komponenten für das vom Irak gegen Iran verwendet Senfgas. Fast 100.000 Opfer dieses völkerrechtswidrigen Einsatzes von Kampfgas waren zu beklagen. Die Spätfolgen bei vielen Verletzten werden immer noch behandelt. Iran blieb in diesem Kampf ohne Verbündete, seine Anrufung des UN-Sicherheitsrats blieb immer ohne Erfolg.
Der Vorhang, den die Revolution und der Krieg vor die innere Entwicklung Irans zog, verdeckt eine rasante innere Entwicklung des Landes, in der 60% eines Jahrgangs eine Hochschule besuchen und davon mehr als die Hälfte Frauen sind. Charlotte Wiedemann hat Iran im Laufe der Jahre mehrmals besucht, hat Reportagen für Zeitschriften gefertigt und jetzt ein sehr informatives Buch vorgelegt. Es besteht aus der Wiedergabe persönlicher Gespräche über Religion und moderne Technik, über das Bildungswesen und den unübersichtlichen Staatsaufbau, über die Verschleierung von Frauen und die erstaunliche staatliche Hilfe beim Erhalt der Synagogen für die jüdische Minderheit.
Die Autorin erzählt die Geschichte mit den kolonialistischen und strategischen Besetzungen durch Großbritannien und Russland bzw. die Sowjetunion, den von der CIA herbeigeführte Sturz des ersten frei gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh im Dienste der britischen Öl-Interessen im Jahre 1953, die Diktaturen des Schahs und der Theokraten unter Khomeini in einem leicht lesbaren, immer wieder von persönlichem Erleben getragenen, lebendigen Stil. Das Buch strahlt einen von der Empathie seiner Autorin für das Land getragenen Optimismus aus – vielleicht den einzigen, den die diese so unsichere Region überhaupt erlaubt.
Harald Loch
Charlotte Wiedemann; Der neue Iran - Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten
dtv, München 2017 288 Seiten, farbiger Bildteil 22 Euro
Die USA treten in den I.Weltkrieg ein
Manfred Berg: Woodrow Wilson. Amerika und die Neuordnung der Welt. Eine Biographie
Im Jahr 1917 veränderte sich die Welt nachhaltig. Das spektakulärste Ereignis war die Oktoberrevolution in Russland, deren Ergebnisse – die Sowjetunion – das 20. Jahrhundert nicht überlebten. Als dauerhafter erwies sich der Eintritt der USA in die Weltpolitik, als das wirtschaftlich erstarkte Land seinen Isolationismus aufgab und auf Seiten der Alliierten in den Ersten Weltkrieg eintrat. Zwar fiel es zwischen den Weltkriegen noch einmal in seinen außenpolitischen Autismus zurück, aber der Grundstein zu der Vision von einer von den USA dominierten internationalen Ordnung, verbunden mit einem Messianismus für Demokratie, Kapitalismus, freiem Handel und kollektiver Sicherheit wurde vor 100 Jahren gelegt.
Die Schlüsselfigur für diese Entwicklung war Woodrow Wilson, der 28. Präsident der USA. Manfred Berg hat die erste deutschsprachige Biographie über diesen bis heute umstrittenen Präsidenten geschrieben. Berg ist an der Universität Heidelberg Professor für Amerikanische Geschichte.
Im Zentrum dieser politischen Lebenserzählung stehen der Schwenk von der anfangs eingenommenen Neutralitätspolitik und den Friedensbemühungen Wilsons zu dem Kriegseintritt „Mit aller Macht“, seine 14 Punkte zur Beendigung des Krieges und seine Rolle auf der Pariser Friedenskonferenz. Im Mittelpunkt der visionären Vorstellungen Wilsons stand die Einrichtung eines Völkerbundes zur Verhinderung weiterer Kriege. Im eigenen Land scheiterte der Präsident mit diesem Kernstück seiner Politik an dem ablehnenden Votum im amerikanischen Senat. Der Sohn eines presbyterianischen Pfarrers und einer ebenfalls auf einer Pfarrersfamilie stammenden Mutter empfand seine politische Mission gleichsam als moralischen Auftrag: „Wilson gebärde sich wie Jesus Christus, beschwerte sich Georges Clemenceau, sein französischer Verhandlungspartner auf der Pariser Friedenskonferenz einmal bei einem Vertrauten Wilsons. Aber der Allmächtige habe der Menschheit lediglich zehn Gebote auferlegt, während es Wilson nicht unter vierzehn tue.“ Mit solchen Anekdoten würzt der Biograph seine Lebens- und Epochenbeschreibung, die strengen historischen Ansprüchen genügt. Das Leben dieses Präsidenten und die dramatischen Ereignisse um den von den Deutschen als Diktatfrieden empfundenen Versailler Vertrag und den Kampf um den Völkerbund auf gut 200 Seiten darzustellen, ist ein Kunststück komprimierter Geschichtsschreibung. Dabei lässt Berg kontroverse Stimmen von Zeitgenossen und anderen Historikern im O-Ton zu Wort kommen und erzielt auf diese Weise einen lebendigen Eindruck von der zwiespältig beurteilten Rolle Wilsons.
Dessen innenpolitisches Wirken hinterlässt ebenfalls einen ambivalenten Eindruck: er sorgte einerseits für eine erste Kartellgesetzgebung, für die Gründung der Federal Reserve Bank, er setzte sich für das Wahlrecht von Frauen ein und bereitete manchen progressiven Veränderungen den Weg. Andererseits war er als Südstaaten-Repräsentant ein uneinsichtiger Rassist, der Afroamerikanern keinerlei Gleichberechtigung zuerkannte. In seiner Persönlichkeitsstruktur verbanden sich eine gewisse Sturheit und Beratungsresistenz mit dem unerschütterlichen Glauben ein die Richtigkeit seiner moralischen und religiösen Mission. Diese Eigenschaften verstärkten sich gegen Ende seiner Präsidentschaft unter dem Einfluss mehrerer Schlaganfälle ins Irrationale. Der Autor vermittelt am Schluss seiner Biographie einen interessanten Überblick über die Urteile der Nachwelt und die Wirkungsgeschichte Wilsons bis in die unmittelbare Gegenwart der USA: „Mit der Wahl des Republikaners Donald J. Trump ist ein Präsident in das Weiße Haus eingezogen, der einen neoisolationistischen und protektionistischen Nationalismus vertritt und damit historisch eher an Wilsons unversöhnliche Gegner im Kampf um den Völkerbund anschließt.“
Harald Loch
Manfred Berg: Woodrow Wilson. Amerika und die Neuordnung der Welt. Eine Biographie
C.H.Beck Paperback. Originalausgabe 227 Seiten 16,95 Euro
Kriegserben
Robert Gerwarth: Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkrieges
Als ob der Erste Weltkrieg nicht schon zu viele Opfer gekostet hätte! In den Jahren von 1918 bis 1923 forderten die zahlreichen gewaltsamen Konflikte, Bürgerkriege, Umstürze, Vertreibungen und Pogrome weitere Millionen Opfer. Der 1976 in Berlin geborene, heute am University College in Dublin lehrende Robert Gerwarth hat „Das blutige Erbe des Ersten Weltkrieges“ in seinem soeben in deutscher Übersetzung erschienen Werk „Die Besiegten“ untersucht.
Er erblickt darin wesentliche Ursachen für die Fortsetzung der Gewalt im Zweiten Weltkrieg. Der allgemeine Tenor führt die späteren Gewaltexplosionen auf die ungeheure Brutalisierung während der Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs zurück. Gerwarth fügt die in weiten Teilen Europas und Asiens nach dem Ende des Krieges fortgesetzten gewaltsamen Auseinandersetzungen als weitere Ursache hinzu. Die mörderische Idee von ethnisch „reinrassigen“ Nationalstaaten entstand entgegen den Vorgaben des amerikanischen Präsidenten Wilson in dessen 14 Punkten zur Beendigung des „Großen Krieges“. Diese Auseinandersetzungen zerstörten demokratische Ansätze in Mitteleuropa und in den neuen Staaten, die auf den Territorien der zerfallenen kontinentalen Großreiche entstanden. In diesen Kämpfen übten spätere Gewaltverbrecher in Mord und Totschlag ein. Hier gediehen Nationalismus, Rassismus, religiöser Hass, Antisemitismus und Klassenhass zu militanten Ideologien.
Gerwarth untersucht die Entwicklungen bei den Besiegten des Ersten Weltkrieges. Die weitgehend bekannten Ereignisse in den ersten Jahren der Weimarer Republik fasst er gekonnt zusammen. Ebenso die ersten Jahre der nach der Oktoberrevolution entstandenen Sowjetunion, die sich innerer wie äußerer Feinde erwehren musste und dabei selbst Opfer und Täter brutalster Auseinandersetzungen wurde. Diese fanden im Innern wie an der Peripherie des auseinandergefallenen Zarenreiches mit brutaler Intensität statt: in Polen, in der Ukraine, im Baltikum und im Kaukasus.
Die Lage in den Zerfallsprodukten der Habsburger Doppelmonarchie war genauso verheerend. Die frühe Faschisierung in Ungarn, die Versagung der Gleichberechtigung der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei, die beginnenden Auseinandersetzungen im gerade entstehenden Jugoslawien, die Entwicklung im völlig demoralisierten Österreich – überall Gewalt. Im Innern dieser Staaten und auch mit Nachbarländern gab es regelrechte Grenzkriege. Fast immer ging es um ethnische Fragen, die gewaltsam gelöst werden sollten. Das besiegte Bulgarien verlor große Gebiete und Bevölkerungsteile und erlebte im Innern wie mit seinen Nachbarn verheerende Kämpfe.
Völlig zu Recht rechnet Gerwarth nicht r die eigentlichen Besiegten sondern auch die in den Friedensverträgen zu kurz gekommenen Sieger zu den Ländern, die gewaltsam zu korrigieren versuchten, was ihnen vielleicht versprochen, dann aber vorenthalten wurde: Italien konnte sich an der Adria nicht wunschgemäß ausdehnen, weil die Ostküste dort inzwischen Jugoslawien beanspruchte. Demokratische Regierungen in Italien mussten sich für das „magere“ Ergebnis in den Pariser Friedensabkommen rechtfertigen. Der Kriegseintritt auf Seiten der Entente hatte Italien mehr Kriegstote abverlangt als Großbritannien. Die Frage „wofür“ diese Opfer gebracht wurden, beantworteten die aufgewiegelten Massen nicht mit Pazifismus sondern mit dem Sieg Mussolinis. Griechenland war der Zugriff auf die türkische Ägäis-Küste zugesagt worden, und nach Kriegsende ermunterte der britische Premier Lloyd George Griechenland zum Angriff.
Der Invasion folgten unglaublich brutale Verbrechen an den muslimischen Osmanen, die sich, als sie die Oberhand gewannen, dafür revanchierten. Das blamable Ende mit dem Sieg der Türken unter Atatürks Führung wurde mit dem verheerenden Abkommen von Lausanne 1923 besiegelt, das den zwangsweisen Bevölkerungsaustausch von über einer Million Griechen von der türkischen Westküste und 400 000 Türken aus der Gegend um Saloniki zu Folge hatte. Das Völkerrecht sanktionierte die Vertreibung statt den Schutz der Minderheiten! In Asien fühlte sich Japan um seinen Anteil am Sieg betrogen. Auf eigene Faust expandierte es in der Mandschurei und griff bald China an. Vor allem aber verschmerzte es nicht die mangelnde völkerrechtliche Anerkennung als gleichberechtigtes „nicht-weißes“ Volk. Am nachhaltigsten, bis heute wirkten die Fehlentscheidungen gegenüber den arabischen Trümmern des Osmanischen Reiches: es entstanden Irak, Syrien, Libanon, Palästina mit ungeklärten Rechten jüdischer Einwanderer – alles Länder, denen die volle Souveränität vorenthalten wurde und die unter Mandatsverwaltung Frankreichs oder Englands gestellt wurden.
Die zusammenfassende, spannend geschriebene Darstellung dieser gewaltträchtigen Nachkriegsepoche untermauert in vielen Details und im Epochenblick die These des Autors, dass hier wesentliche Ursachen der späteren, noch größeren Katastrophen liegen.
Harald Loch
Robert Gerwarth: Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkrieges
Aus dem Englischen von Alexander Weber
Siedler, München 2017 479 Seiten 29,99 Euro
INTERVIEW
Frieden schließen wird immer schwieriger
Frage: Herr Gerwarth, Sie sind Gründungsdirektor der Zentrums für Kriegsstudien am University College in Dublin. In Ihrem Buch „Die Besiegten“ behandeln Sie die missglückten Friedensschlüsse nach dem Ersten Weltkrieg. Warum konnten Versailles & Co. nicht an den Wiener Kongress anschließen, der hundert Jahre zuvor doch für längere Zeit Frieden in Europa schuf?
Gerwarth: In den napoleonischen Kriegen nahm zwar zum ersten Mal ein Volksheer an den Kämpfen teil. Aber auf Seiten der Sieger waren es die bis dahin klassischen stehenden Heere, die von den Kabinetten in den Krieg geschickt wurden. Herrscher und ihre Regierungen erklärten Kriege und schlossen Frieden über die Köpfe der Menschen hinweg. Im Ersten Weltkrieg dagegen kämpften nationalistisch aufgewühlte Völker gegeneinander. Angesichts der enormen Opfer waren die Friedensbedingungen von 1919 in erster Linie an die Bevölkerungen der Siegermächte gerichtet. Die wollten „Wiedergutmachung“ der enormen Schäden und Genugtuung für den Blutzoll.
Frage: Die Regierungen der Sieger wollten vor ihre Bevölkerungen treten können, wollten wiedergewählt werden. Hinderte deren demokratische Verfassung einen klügeren Frieden?
Gerwarth: Das kann man so sehen und das gilt natürlich für alle späteren Kriege und ihre Friedensschlüsse auch. Es ist viel schwerer geworden, einen guten Frieden zu schließen, wenn man vorher die Völker für die Opfer aufpeitschend und nationalistisch motiviert hatte.
Aber nehmen wir Versailles! Nur in der deutschen Binnensicht war das „Diktat“ besonders streng. Vergleicht man es mit den Russland von Deutschland 1917 im Frieden von Brest-Litowski auferlegten territorialen Abtrennungen, vergleicht man es mit der völligen Zerschlagung Österreich-Ungarns im Frieden von Trianon oder mit der Atomisierung des Osmanischen Reiches im Frieden von Sèvres, war Versailles noch die mildere Variante. Vor allem Lloyd George als britischer Premier verhinderte die von Frankreich angestrebte Zerstückelung Deutschlands.
Frage: Warum wurde Versailles in Deutschland so negativ aufgenommen?
Gerwarth: Das lag einerseits an der noch kurz vor Kriegsende von der Obersten Heeresleitung geschürten Siegeshoffnung. Und die territorialen Verluste vor allem im Osten, die Höhe der Reparationen, die Zuweisung der alleinigen Schuld am Krieg, die teilweise überzogene Behauptung von Kriegsverbrechen und vor allem die Tatsache, dass Deutschland an den Friedensverhandlungen gar nicht beteiligt war – anders als Frankreich am Wiener Kongress, auf dem Taillerand eine herausragende Rolle spielte – das alles war ein brisantes Gemisch. Hinzu kam, dass von den 14 Punkten Wilsons, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker betont hatten, keine Rede mehr war. Das waren aber die Erwartungen in Deutschland, als der Krieg endlich vorüber war.
Frage: Nicht nur bei den Besiegten folgten Bürgerkriege, Revolutionen, Aufstände aus den missglückten Friedensverträgen. Auch einige der Sieger fühlten sich zu kurz gekommen. Italien und Japan z.B. Wie kam es dazu?
Gerwarth: Italien waren größere Gebietsgewinne an der Adria in Aussicht gestellt worden, die dann wegen des neuen Staates Jugoslawien nicht realisiert wurden. Japan fühlte sich als „farbige“ Rasse vom neu gegründeten Völkerbund diskriminiert. Fast folgerichtig bildeten sie später mit dem Hitlerreich ein Kriegsbündnis gegen die westlichen Demokratien und gegen „den Bolschewismus“.
Frage: Am Schlimmsten bewerten Sie den Vertrag von Lausanne, mit dem 1923 der Krieg zwischen der neuen Türkei und Griechenland beendet wurde. Was war daran so verheerend?
Gerwarth: Nicht der Frieden an sich, der den von Griechenland entfesselten opferreichen Krieg beendete war schlimm. Aber die Vereinbarung des millionenfachen Bevölkerungsaustauschs in der Ägäis, der Wechsel von der über Jahrhunderte bewährten Bevölkerungsmischung in den großen Staaten zu einer „ethnisch gesäuberten“ Nation machte Schule und führte von diesem Zeitpunkt an zu rassistischen und nationalistischen, auch religiös einheitlichen Nationalstaaten, zu Vertreibungen, neuen Kriegen, Pogromen. Der Zerfallsprozess in Jugoslawien, viele postkoloniale Auseinandersetzungen in Asien und Afrika, ganz aktuell die Situation in der Ukraine – alles sind Folgen des Paradigmenwechsels von 1923.
Frage: Die Zerschlagung des Osmanischen Reiches beurteilen Sie besonders kritisch.
Gerwarth: Auf den Trümmern des Osmanischen Reiches liegen heute Länder wie Syrien, Irak, Jordanien, Israel. Den arabischen Bevölkerungen hatten die westlichen Alliierten Souveränität gegen Hilfe im Kampf gegen die mit Deutschland verbündete Türkei versprochen. Aus Egoismus lösten sie die Versprechen nicht ein. Den Juden war ein eigenes Land an historischer Stätte versprochen worden – nichts davon wurde eingehalten. Der Frieden mit dem Osmanischen Reich hinterließ eine chaotische Landschaft, die bis heute nicht zu Ruhe gekommen ist – im Gegenteil, sie ist explosiv wie nie zuvor.
Frieden schließen muss man aus den verheerenden Folgen der Friedensschlüsse im 20. Jahrhundert lernen. Dazu muss man die Bevölkerungen vorbereiten. Besser noch – wenn es schon so schwer geworden ist, einen guten Frieden zu schließen – man fängt keinen Krieg erst an ...
... sagt der Direktor des Dubliner Zentrums für Kriegsforschung Robert Gerwarth, dem wir für dieses Gespräch herzlich danken.
Das Gespräch wurde am 15. Februar 2017 in Berlin geführt. Die Fragen stelle Harald Loch
Wellengang und Gedankenorkane
Titel Gunter Scholtz Philosophie des Meeres
Inhalt 281 Seiten „Kreuzfahrt“ durch das Meer menschlichen Denkens über die Meere und das Meer an sich
Autor Gunter Scholtz, geboren 1941, war bis zur Pensionierung Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Publikationen gelten der Theorie der Geisteswissenschaften sowie der Geschichts-, Religions- und Kunstphilosophie. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Begriffsgeschichte. Er lebt in Bochum.
Lesart anspruchsvoll, aber verständlich, philosophische Grundkenntnisse nicht erforderlich aber hilfreich
Cover dunkles meeresgrün als Einband, 288 Seiten, gebunden, Leineneinband mit Lesebändchen, Meereswellen, Wellenkamm als Zeichnung, Einleitungskapitel, 7 Einzelkapitel, , abschließend kurzer Reiserückblick Anhang mit Anmerkungen und Register
Gestaltung Schrift Minion pro, keine Fotos oder Zeichnungen
Zitat „Die Wiege der Philosophie stand am Meer und ihr Grundprinzip war das Wasser“.
Meinung Das Buch versteht sich als „allgemein“ philosophisches Buch, nicht als naturphilosophisches und orientiert sich an der einzigen Leitfrage nach dem Verhältnis des philosophischen Denkens zum Meer. Wobei das Denkens der Menschen von der Perspektive des Landbewohners geprägt ist.
Die „Gedankenreise“ des Autors ermöglicht es „kühner zu kreuzen“ zwischen entfernten Positionen.
Thales war der erste Meeres-Philosoph, für den die Landmasse auf dem Wasser schwamm , der tragende Grund, und das Meer war zugleich der Ursprungsort des Lebens, Quellgrund, aus dem die Dinge hervorgehen. Heraklit dachte, alles ist im Fluss. Panta rhei, alles fließt.
Philosophen wie Grotius entwickeln die Idee, dass das Meer nur Gemeineigentum sein kann, niemand darf Besitzrechte geltend machen. Man solle Ehrfurcht vor der Größe und Schönheit des Meeres haben. Das Meer fördert kosmopolitisches Denken, es verbindet die Völker.
Kant fordert ein verbindliches Völkerrecht für die Nutzung des freien Meeres. Herder hofft auf die sich ausbreitende Moral und Hegel vertraut auf die sich ausbreitende Vernünftigkeit der Verhältnisse.
Für Jaspers ist das Meer Gleichnis von Freiheit und Transzendenz. Und Camus philosophiert: “Ich wuchs im Meer auf“. Ein Buch, das einen weiten Wellenbogen schlägt– wie Ebbe und Flut – von immer wiederkehrenden Gedankenflügen der Menschen über das Meer. Tiefgründig erkennend, die Fundamente der Philosophie suchend und die dazu passenden Gedankenstürme.
Leser Landratten und Ozeanfans, Schwimmer und Nichtschwimmer
Multimedia http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/gunter-scholtz100.html
Verlag: mare
Pressestimmen: … „mehr als lehrreiche Reise zu den Denkern einer „Philosophie des Meeres“. Frankfurter Rundschau online
Der Erzählinstinkt
Jeder Mensch erzählt, jeder hat einen Erzählinstinkt, Mann und Frau und Völker auch. Unser Gedächtnis, unsere Ziele, Wünsche, ja das ganze Leben organisieren wir auf erzählende Art und Weise. Wir
folgen unserem narrativen Instinkt, entwickeln eine Lebensstory. Gerade im Internet hat Erzählung ja gerade eine Hochkonjunktur.
Erzählen – so der Autor – ist die wichtigste Form unseres Denkens. Wir leben einer Story hinterher. Schon als Kleinkind lernt der Mensch, wie man eine Geschichte erzählt. Trotz neuer Medien, Menschen
lesen Romane aus purem Vergnügen. Und Erzählen hält die Gruppe zusammen, hat Bindewirkung. Lesen schult Verständnis, ermöglicht die Perspektive sich in den anderen hineinzuversetzen: „Romanlesen ist
wie fliegen im Simulator“. Lesen ermöglicht soziale Beziehungen und weckt Verständnis für dieselben. Mitmenschen können sicherer beurteilt werden.
Dabei empfinden wir ein „Grundbedürfnis“ „poetischer Gerechtigkeit“. Das Gute muss siegen. Im Film wie im Roman: „Ende gut – alles gut“.
Über die Welt ist aber nur zu berichten, indem man weglässt, ausblendet. Erzählungen steuern dabei die Aufmerksamkeit des Empfängers. Erzählungen müssen jedoch in sich schlüssig sein. Die Sätze
beziehen sich als einzelne Elemente aufeinander und schaffen so ein Gesamtverständnis. Ändert man aber die Reihenfolge, wird das Gesamtbild die Schlüssigkeit zerstört.
Geschichten bestehen aus Erzähl-Schemata, vor dem Hintergrund gemeinsamer kultureller Muster, die gemeinsames Verstehen ermöglichen.
Drei Wahrheiten liegen zugrunde; das empirisch Vorfindbare, also die uns umgebende Realität. Die zweite Wahrheit ist die, auf die sich alle geeinigt haben, und die dritte ist die persönliche bzw.
gesellschaftliche Relevanz, zum Beispiel verbrennen wir fossile Brennstoffe weiter, obwohl wir wissen, dass sie zum Klimawandel beitragen.
Am Beispiel Europas verdeutlicht der Autor seine Erzählanalyse. Es fehlt eine identitätsstiftende europäische Erzählung – oder sind wir nur blind für sie, wie Werner Siefer abschließend fragt, doch
Krisen seien eben Brutstätten für neue Narrative.
Ein kluges, außergewöhnliches, anspruchsvolles Buch, das an vielen Beispielen den „Erzählinstinkt“ nachvollziehbar „erzählt“.
Werner Siefer Der Erzählinstinkt. Warum das Gehirn in Geschichten denkt.“ CARL HANSER VERLAG
Werner Siefer, Jahrgang 1964, ein Autor und Wissenschaftsjournalist, studierte in Regensburg und München Philosophie und Biologie. Sein Spezialgebiet ist die Hirnforschung.
Link www.wernersiefer.de
Joseph Stiglitz: Europa spart sich kaputt
Die Ohrfeige für den Euro sitzt! Joseph Stiglitz, Träger des Nobelpreises für Wirtschaft von 2001 und Wirtschaftswissenschaftler an der Columbia University rechnet mit der von ihm behaupteten Fehlkonstruktion des Euro, mit der gefesselten Europäischen Zentralbank und mit der Politik der Bundesregierung ab. In Deutschland würde man Stiglitz wohl einen Sozialdemokraten nennen. In der Volkswirtschaftslehre ist er ein Keynesianer. Er misstraut der Weisheit der Märkte und fordert stärkere, angemessene Regulierungen. Auf marktfundamentalistischen Annahmen sei die europäische Gemeinschaftswährung gegründet worden, obwohl die große Unterschiedlichkeit der beteiligten Länder zusätzlich wirksame institutionelle politische Instrumente erfordert hätte. Diese seien aus ideologischen, „neoliberalen“ Gründen bewusst nicht geschaffen worden. Mit ihnen hätten die Unterschiede der nationalen Volkswirtschaften der beteiligen Länder in der Euro-Zone berücksichtigt werden können. Die Kräfte des Marktes, auf die die Gründer des Euro vertraut hätten, konnten diese Aufgabe nie erfüllen.
Wenn sich Staaten zu einer Währungsunion zusammenschließen, also ihre Währung an eine andere, gemeinschaftliche binden, begeben sie sich der souveränen Entscheidung über den Außenwert ihres Geldes. Sie können ihre Währung nicht mehr abwerten, um ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn es in Schieflage gerät und sie können über Anpassungen des Wechselkurses auch keine Arbeitslosigkeit bekämpfen, Vollbeschäftigung anstreben. Hierzu hätte es bei Einführung des Euro der Schaffung institutioneller Strukturen der Regulierung in der Gemeinschaft bedurft. Bei diesem Geburtsfehler, die Stiglitz in seinem Buch im Einzelnen seziert, gäbe es eigentlich nur zwei Richtungen: Entweder mehr oder weniger Europa. Für beide Richtungen schlägt der Autor, der jahrelang Chefvolkswirt der Weltbank war, Auswege vor, die von einer Vollendung der Währungsunion bis zu ihrer geordneten oder auch nur teilweisen Auflösung reichen. Als einen der Hauptkritikpunkte nimmt Stiglitz die EZB ins Visier. Sie sei, vor allem auf deutsches Betreiben, ausschließlich der Geldwertstabilität, der Inflationsbekämpfung verpflichtet und sei politisch keiner demokratischen Institution verantwortlich. Ihre Aufgaben müssten auf das Ziel der Vollbeschäftigung, auf ein angemessenes Wirtschaftswachstums und auf die Sicherung des Finanzsystems erweitert werden.
Die neoliberale Grundstruktur der europäischen Währungsunion hätte sowohl das Wirtschaftswachstum in den Jahren seit Einführung des Euro gebremst, die Ungleichheit sowohl zwischen den ärmeren und den reicheren Mitgliedsstaaten als auch innerhalb der jeweiligen Gesellschaften zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten erhöht und die Lebenschancen vieler Jugendlicher durch hohe Arbeitslosigkeit beeinträchtigt. Das auf ideologischer Verblendung resultierende Vertrauen in die selbstregulierenden Kräfte des Marktes sei von vornherein falsch gewesen. Der Markt sei irrational, er entwickle sich unvorhersehbar und sorge nicht für Konvergenz unterschiedlicher Volkswirtschaften sondern für die in Europa zu beobachtende Divergenz.
Stiglitz belegt seine Auffassungen mit empirischen Hinweisen auf frühere Krisen in Lateinamerika oder Asien und die Fehler, die bei deren Bekämpfung begangen wurden. Er bleibt seiner eigenen, auf Keynes aufbauenden Theorie treu, die er in zahlreichen Werken zuvor ausgebreitet hat. Er ficht mit kraftvollen und deutlichen Worten für Solidarität mit den Armen und den jugendlichen Arbeitslosen und auch mit den armen Staaten, besonders mit Griechenland. In diesem neuen Buch setzt er sich qualifiziert mit der Fehlentwicklung im Euro-Raum auseinander. Auch wenn man nicht allen seinen Analysen und Vorschlägen folgt – wo findet im politischen Raum eine Auseinandersetzung mit seinen, von der modernen Volkswirtschaftslehre weitgehend geteilten Ansichten statt, wo stehen sie zur Wahl?
Harald Loch
Joseph Stiglitz: Europa spart sich kaputt. Warum die Krisenpolitik gescheitert ist und der Euro einen Neustart braucht Aus dem amerikanischen Englisch von Thorsten Schmidt
Siedler, München 2016 526 Seiten 24,99 Euro